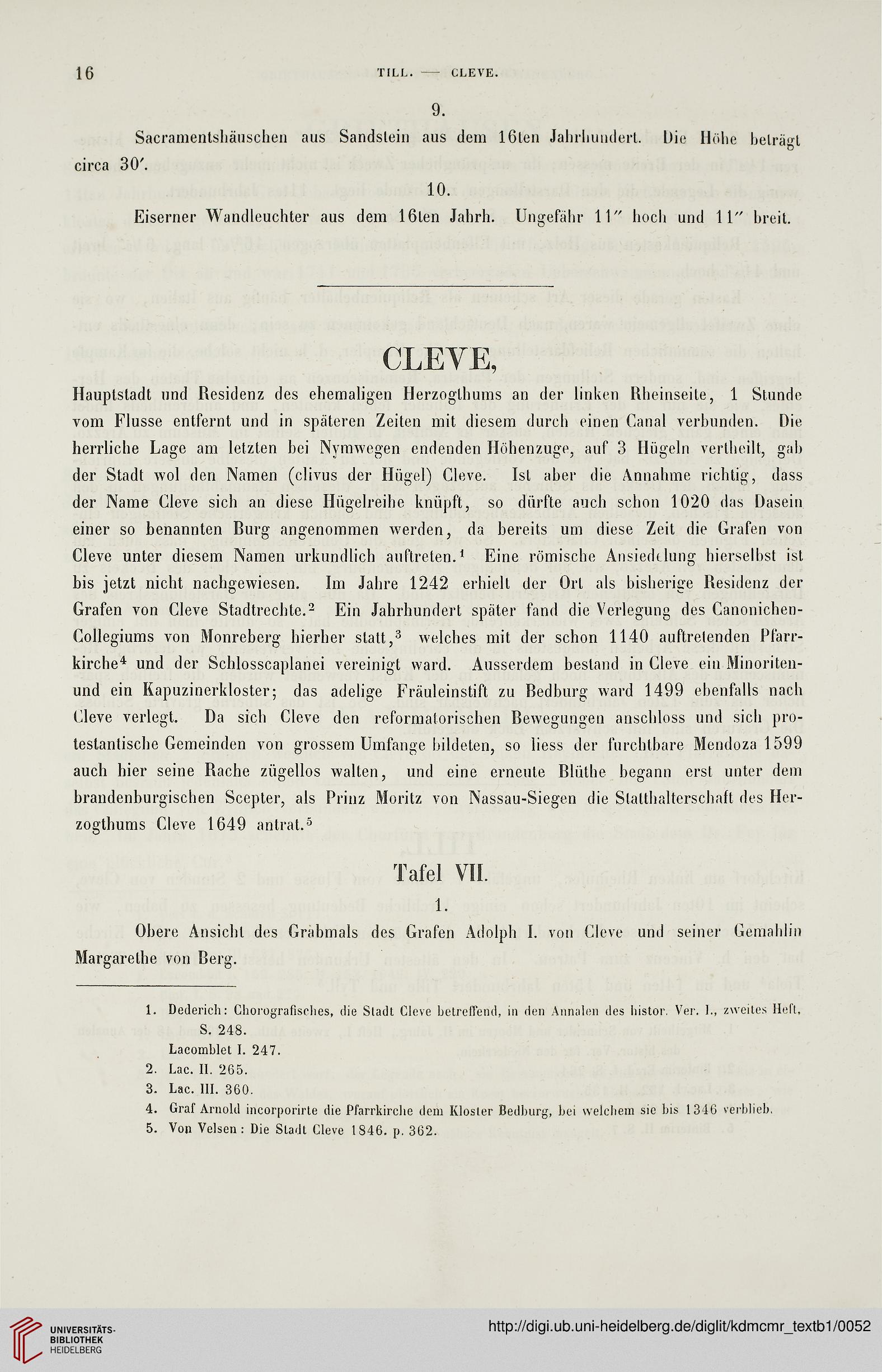16 TILL. - CLEVE.
9.
Sacramentshäuschen aus Sandstein aus dem lGlen Jahrhundert. Die Höhe beträgt
circa 30'.
10.
Eiserner Wandleuchter aus dem löten Jahrh. Ungefähr 11" hoch und 11" breit.
CLEYE,
Hauptstadt und Residenz des ehemaligen Herzogthums an der linken Rheinseite, 1 Stunde
vom Flusse entfernt und in späteren Zeiten mit diesem durch einen Canal verbunden. Die
herrliche Lage am letzten bei Nymwegen endenden Höhenzuge, auf 3 Hügeln vertheilt, gab
der Stadt wol den Namen (clivus der Hügel) Cleve. Ist aber die Annahme richtig, dass
der Name Cleve sich an diese Hügelreihe knüpft, so dürfte auch schon 1020 das Dasein
einer so benannten Rurg angenommen werden, da bereits um diese Zeit die Grafen von
Cleve unter diesem Namen urkundlich auftreten.1 Eine römische Ansiedelung hierselbst ist
bis jetzt nicht nachgewiesen. Im Jahre 1242 erhielt der Ort als bisherige Residenz der
Grafen von Cleve Stadtrechte.2 Ein Jahrhundert später fand die Verlegung des Canonichen-
Collegiums von Monreberg hierher statt,3 welches mit der schon 1140 auftretenden Pfarr-
kirche4 und der Schlosscaplanei vereinigt ward. Ausserdem bestand in Cleve ein Minoriten-
und ein Kapuzinerkloster; das adelige Fräuleinstift zu Redburg ward 1499 ebenfalls nach
Cleve verlegt. Da sich Cleve den reformatorischen Bewegungen anschloss und sich pro-
testantische Gemeinden von grossem Umfange bildeten, so liess der furchtbare Mendozal599
auch hier seine Rache zügellos walten, und eine erneute Rlüthe begann erst unter dem
brandenburgischen Scepter, als Prinz Moritz von Nassau-Siegen die Statthalterschaft des Her-
zogthums Cleve 1649 antrat.5
Tafel VII.
l.
Obere Ansicht des Grabmals des Grafen Adolph I. von Cleve und seiner Gemahlin
Margarethe von Rerg.
1. Dederich: Chorografisehes, die Stadt Cleve betreffend, in den Annalen des Iiistor. Ver. 1., zweites Heft,
S. 248.
Lacomblet I. 247.
2. Lac. II. 265.
3. Lac. III. 360.
4. Graf Arnold incorporirte die Pfarrkirche dem Kloster Bedburg, bei welchem sie bis 1346 verblieb.
5. Von Velsen: Die Stadt Cleve 1846. p. 362.
9.
Sacramentshäuschen aus Sandstein aus dem lGlen Jahrhundert. Die Höhe beträgt
circa 30'.
10.
Eiserner Wandleuchter aus dem löten Jahrh. Ungefähr 11" hoch und 11" breit.
CLEYE,
Hauptstadt und Residenz des ehemaligen Herzogthums an der linken Rheinseite, 1 Stunde
vom Flusse entfernt und in späteren Zeiten mit diesem durch einen Canal verbunden. Die
herrliche Lage am letzten bei Nymwegen endenden Höhenzuge, auf 3 Hügeln vertheilt, gab
der Stadt wol den Namen (clivus der Hügel) Cleve. Ist aber die Annahme richtig, dass
der Name Cleve sich an diese Hügelreihe knüpft, so dürfte auch schon 1020 das Dasein
einer so benannten Rurg angenommen werden, da bereits um diese Zeit die Grafen von
Cleve unter diesem Namen urkundlich auftreten.1 Eine römische Ansiedelung hierselbst ist
bis jetzt nicht nachgewiesen. Im Jahre 1242 erhielt der Ort als bisherige Residenz der
Grafen von Cleve Stadtrechte.2 Ein Jahrhundert später fand die Verlegung des Canonichen-
Collegiums von Monreberg hierher statt,3 welches mit der schon 1140 auftretenden Pfarr-
kirche4 und der Schlosscaplanei vereinigt ward. Ausserdem bestand in Cleve ein Minoriten-
und ein Kapuzinerkloster; das adelige Fräuleinstift zu Redburg ward 1499 ebenfalls nach
Cleve verlegt. Da sich Cleve den reformatorischen Bewegungen anschloss und sich pro-
testantische Gemeinden von grossem Umfange bildeten, so liess der furchtbare Mendozal599
auch hier seine Rache zügellos walten, und eine erneute Rlüthe begann erst unter dem
brandenburgischen Scepter, als Prinz Moritz von Nassau-Siegen die Statthalterschaft des Her-
zogthums Cleve 1649 antrat.5
Tafel VII.
l.
Obere Ansicht des Grabmals des Grafen Adolph I. von Cleve und seiner Gemahlin
Margarethe von Rerg.
1. Dederich: Chorografisehes, die Stadt Cleve betreffend, in den Annalen des Iiistor. Ver. 1., zweites Heft,
S. 248.
Lacomblet I. 247.
2. Lac. II. 265.
3. Lac. III. 360.
4. Graf Arnold incorporirte die Pfarrkirche dem Kloster Bedburg, bei welchem sie bis 1346 verblieb.
5. Von Velsen: Die Stadt Cleve 1846. p. 362.