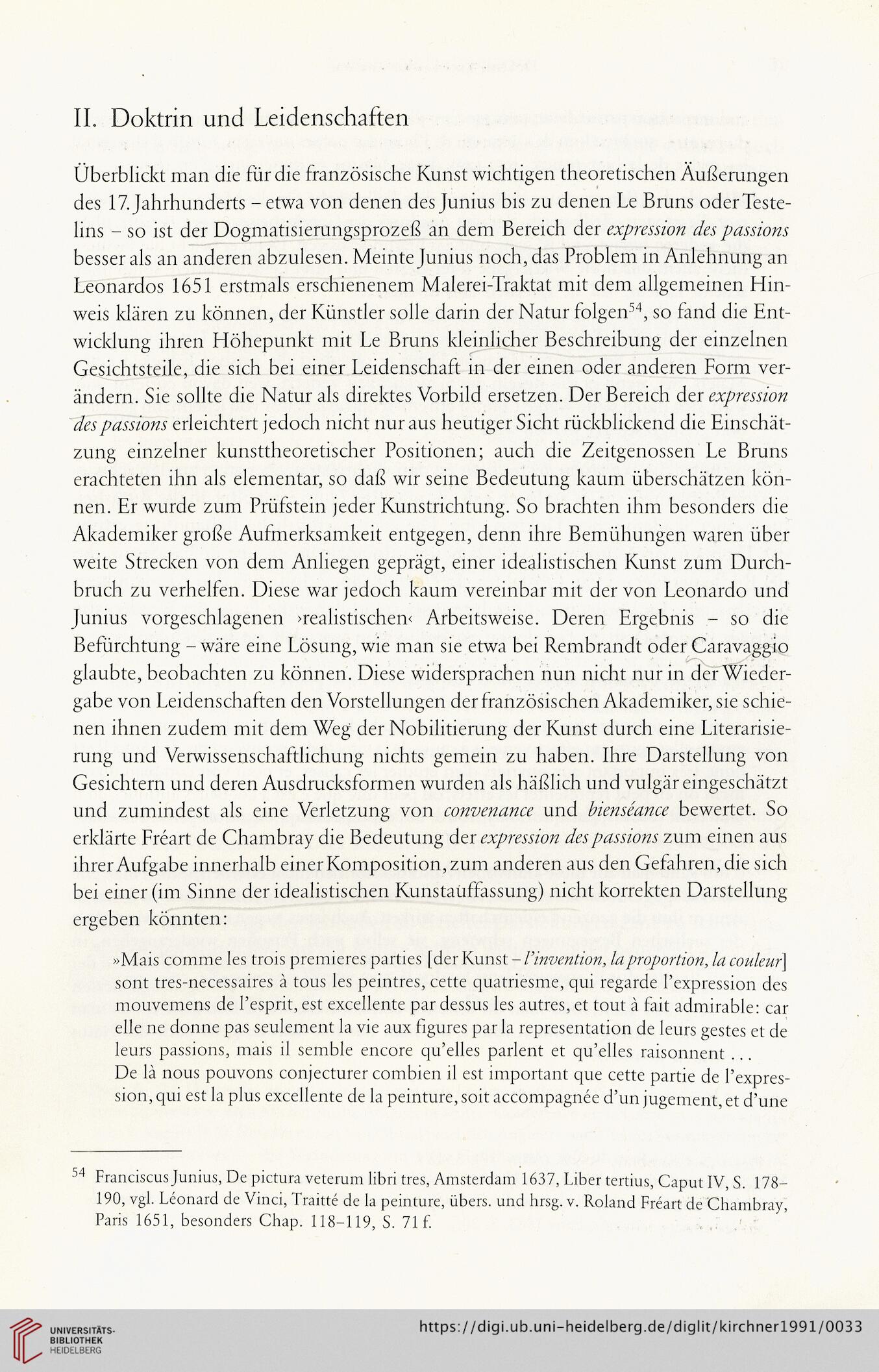II. Doktrin und Leidenschaften
Überblickt man die für die französische Kunst wichtigen theoretischen Äußerungen
des 17. Jahrhunderts - etwa von denen des Junius bis zu denen Le Bruns oder Teste-
lins - so ist der Dogmatisierungsprozeß an dem Bereich der expression des passions
besser als an anderen abzulesen. Meinte Junius noch, das Problem in Anlehnung an
Leonardos 1651 erstmals erschienenem Malerei-Traktat mit dem allgemeinen Hin-
weis klären zu können, der Künstler solle darin der Natur folgen54, so fand die Ent-
wicklung ihren Höhepunkt mit Le Bruns kleinlicher Beschreibung der einzelnen
Gesichtsteile, die sich bei einer Leidenschaft in der einen oder anderen Form ver-
ändern. Sie sollte die Natur als direktes Vorbild ersetzen. Der Bereich der expression
des passions erleichtert jedoch nicht nur aus heutiger Sicht rückblickend die Einschät-
zung einzelner kunsttheoretischer Positionen; auch die Zeitgenossen Le Bruns
erachteten ihn als elementar, so daß wir seine Bedeutung kaum überschätzen kön-
nen. Er wurde zum Prüfstein jeder Kunstrichtung. So brachten ihm besonders die
Akademiker große Aufmerksamkeit entgegen, denn ihre Bemühungen waren über
weite Strecken von dem Anliegen geprägt, einer idealistischen Kunst zum Durch-
bruch zu verhelfen. Diese war jedocli kaum vereinbar mit der von Leonardo und
Junius vorgeschlagenen >realistischen< Arbeitsweise. Deren Ergebnis - so die
Befürchtung - wäre eine Lösung, wie man sie etwa bei Rembrandt oder Caravaggio
glaubte, beobachten zu können. Diese widersprachen nun nicht nur in der Wieder-
gabe von Leidenschaften den Vorstellungen der französischen Akademiker, sie schie-
nen ihnen zudem mit dem Weg der Nobilitierung der Kunst durch eine Literarisie-
rung und Verwissenschaftlichung nichts gemein zu haben. Ihre Darstellung von
Gesichtern und deren Ausdrucksformen wurden als häßlich und vulgär eingeschätzt
und zumindest als eine Verletzung von convenance und bienséance bewertet. So
erklärte Fréart de Chambray die Bedeutung der expression des passions zum einen aus
ihrer Aufgabe innerhalb einer Komposition,zum anderen aus den Gefahren, die sich
bei einer (im Sinne der idealistischen Kunstaüffassung) nicht korrekten Darstellung
ergeben könnten:
»Mais comme les trois premières parties [der Kunst - l'invention, la proportion, la couleur]
sont tres-necessaires à tous les peintres, cette quatriesme, qui regarde l'expression des
mouvemens de l'esprit, est excellente par dessus les autres, et tout à fait admirable: car
elle ne donne pas seulement la vie aux figures par la representation de leurs gestes et de
leurs passions, mais il semble encore qu'elles parlent et qu'elles raisonnent...
De là nous pouvons conjecturer combien il est important que cette partie de l'expres-
sion, qui est la plus excellente de la peinture, soit accompagnée d'un jugement, et d'une
54 Franciscus Junius, De pictura veterum libri tres, Amsterdam 1637, Liber tertius, Caput IV, S. 178-
190, vgl. Léonard de Vinci, Traitté de la peinture, übers, und hrsg. v. Roland Fréart de Chambray,
Paris 1651, besonders Chap. 118-119, S. 71 f.
Überblickt man die für die französische Kunst wichtigen theoretischen Äußerungen
des 17. Jahrhunderts - etwa von denen des Junius bis zu denen Le Bruns oder Teste-
lins - so ist der Dogmatisierungsprozeß an dem Bereich der expression des passions
besser als an anderen abzulesen. Meinte Junius noch, das Problem in Anlehnung an
Leonardos 1651 erstmals erschienenem Malerei-Traktat mit dem allgemeinen Hin-
weis klären zu können, der Künstler solle darin der Natur folgen54, so fand die Ent-
wicklung ihren Höhepunkt mit Le Bruns kleinlicher Beschreibung der einzelnen
Gesichtsteile, die sich bei einer Leidenschaft in der einen oder anderen Form ver-
ändern. Sie sollte die Natur als direktes Vorbild ersetzen. Der Bereich der expression
des passions erleichtert jedoch nicht nur aus heutiger Sicht rückblickend die Einschät-
zung einzelner kunsttheoretischer Positionen; auch die Zeitgenossen Le Bruns
erachteten ihn als elementar, so daß wir seine Bedeutung kaum überschätzen kön-
nen. Er wurde zum Prüfstein jeder Kunstrichtung. So brachten ihm besonders die
Akademiker große Aufmerksamkeit entgegen, denn ihre Bemühungen waren über
weite Strecken von dem Anliegen geprägt, einer idealistischen Kunst zum Durch-
bruch zu verhelfen. Diese war jedocli kaum vereinbar mit der von Leonardo und
Junius vorgeschlagenen >realistischen< Arbeitsweise. Deren Ergebnis - so die
Befürchtung - wäre eine Lösung, wie man sie etwa bei Rembrandt oder Caravaggio
glaubte, beobachten zu können. Diese widersprachen nun nicht nur in der Wieder-
gabe von Leidenschaften den Vorstellungen der französischen Akademiker, sie schie-
nen ihnen zudem mit dem Weg der Nobilitierung der Kunst durch eine Literarisie-
rung und Verwissenschaftlichung nichts gemein zu haben. Ihre Darstellung von
Gesichtern und deren Ausdrucksformen wurden als häßlich und vulgär eingeschätzt
und zumindest als eine Verletzung von convenance und bienséance bewertet. So
erklärte Fréart de Chambray die Bedeutung der expression des passions zum einen aus
ihrer Aufgabe innerhalb einer Komposition,zum anderen aus den Gefahren, die sich
bei einer (im Sinne der idealistischen Kunstaüffassung) nicht korrekten Darstellung
ergeben könnten:
»Mais comme les trois premières parties [der Kunst - l'invention, la proportion, la couleur]
sont tres-necessaires à tous les peintres, cette quatriesme, qui regarde l'expression des
mouvemens de l'esprit, est excellente par dessus les autres, et tout à fait admirable: car
elle ne donne pas seulement la vie aux figures par la representation de leurs gestes et de
leurs passions, mais il semble encore qu'elles parlent et qu'elles raisonnent...
De là nous pouvons conjecturer combien il est important que cette partie de l'expres-
sion, qui est la plus excellente de la peinture, soit accompagnée d'un jugement, et d'une
54 Franciscus Junius, De pictura veterum libri tres, Amsterdam 1637, Liber tertius, Caput IV, S. 178-
190, vgl. Léonard de Vinci, Traitté de la peinture, übers, und hrsg. v. Roland Fréart de Chambray,
Paris 1651, besonders Chap. 118-119, S. 71 f.