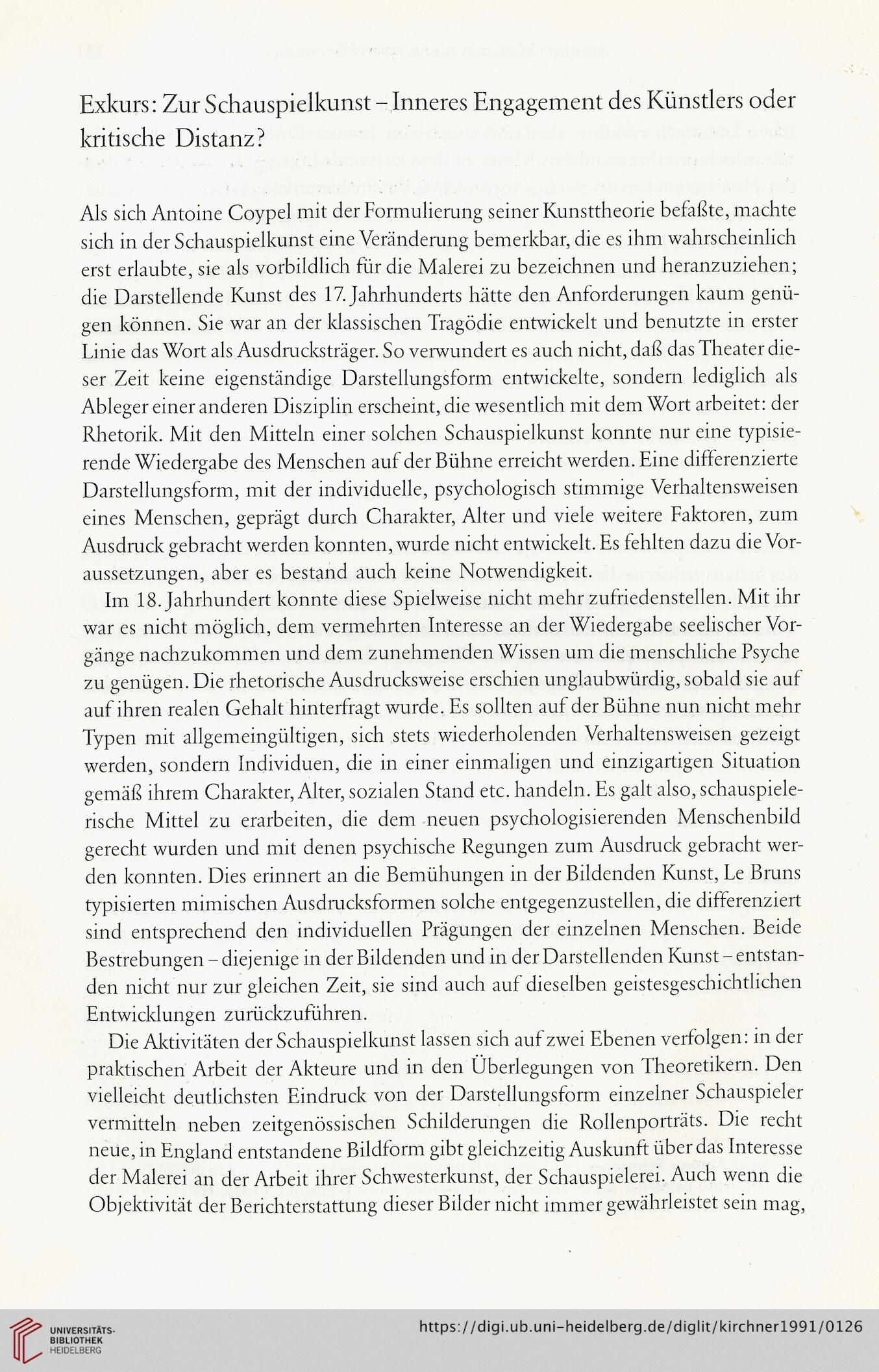Exkurs: Zur Schauspielkunst - Inneres Engagement des Künstlers oder
kritische Distanz?
Als sich Antoine Coypel mit der Formulierung seiner Kunsttheorie befaßte, machte
sich in der Schauspielkunst eine Veränderung bemerkbar, die es ihm wahrscheinlich
erst erlaubte, sie als vorbildlich für die Malerei zu bezeichnen und heranzuziehen;
die Darstellende Kunst des 17. Jahrhunderts hätte den Anforderungen kaum genü-
gen können. Sie war an der klassischen Tragödie entwickelt und benutzte in erster
Linie das Wort als Ausdrucksträger. So verwundert es auch nicht, daß das Theater die-
ser Zeit keine eigenständige Darstellungsform entwickelte, sondern lediglich als
Ableger einer anderen Disziplin erscheint, die wesentlich mit dem Wort arbeitet: der
Rhetorik. Mit den Mitteln einer solchen Schauspielkunst konnte nur eine typisie-
rende Wiedergabe des Menschen auf der Bühne erreicht werden. Eine differenzierte
Darstellungsform, mit der individuelle, psychologisch stimmige Verhaltensweisen
eines Menschen, geprägt durch Charakter, Alter und viele weitere Faktoren, zum
Ausdruck gebracht werden konnten, wurde nicht entwickelt. Es fehlten dazu die Vor-
aussetzungen, aber es bestand auch keine Notwendigkeit.
Im 18. Jahrhundert konnte diese Spielweise nicht mehr zufriedenstellen. Mit ihr
war es nicht möglich, dem vermehrten Interesse an der Wiedergabe seelischer Vor-
gänge nachzukommen und dem zunehmenden Wissen um die menschliche Psyche
zu genügen. Die rhetorische Ausdrucksweise erschien unglaubwürdig, sobald sie auf
auf ihren realen Gehalt hinterfragt wurde. Es sollten auf der Bühne nun nicht mehr
Typen mit allgemeingültigen, sich stets wiederholenden Verhaltensweisen gezeigt
werden, sondern Individuen, die in einer einmaligen und einzigartigen Situation
gemäß ihrem Charakter, Alter, sozialen Stand etc. handeln. Es galt also, schauspiele-
rische Mittel zu erarbeiten, die dem neuen psychologisierenden Menschenbild
gerecht wurden und mit denen psychische Regungen zum Ausdruck gebracht wer-
den konnten. Dies erinnert an die Bemühungen in der Bildenden Kunst, Le Bruns
typisierten mimischen Ausdrucksformen solche entgegenzustellen, die differenziert
sind entsprechend den individuellen Prägungen der einzelnen Menschen. Beide
Bestrebungen - diejenige in der Bildenden und in der Darstellenden Kunst - entstan-
den nicht nur zur gleichen Zeit, sie sind auch auf dieselben geistesgeschichtlichen
Entwicklungen zurückzuführen.
Die Aktivitäten der Schauspielkunst lassen sich auf zwei Ebenen verfolgen: in der
praktischen Arbeit der Akteure und in den Überlegungen von Theoretikern. Den
vielleicht deutlichsten Eindruck von der Darstellungsform einzelner Schauspieler
vermitteln neben zeitgenössischen Schilderungen die Rollenporträts. Die recht
neue, in England entstandene Bildform gibt gleichzeitig Auskunft über das Interesse
der Malerei an der Arbeit ihrer Schwesterkunst, der Schauspielerei. Auch wenn die
Objektivität der Berichterstattung dieser Bilder nicht immer gewährleistet sein mag,
kritische Distanz?
Als sich Antoine Coypel mit der Formulierung seiner Kunsttheorie befaßte, machte
sich in der Schauspielkunst eine Veränderung bemerkbar, die es ihm wahrscheinlich
erst erlaubte, sie als vorbildlich für die Malerei zu bezeichnen und heranzuziehen;
die Darstellende Kunst des 17. Jahrhunderts hätte den Anforderungen kaum genü-
gen können. Sie war an der klassischen Tragödie entwickelt und benutzte in erster
Linie das Wort als Ausdrucksträger. So verwundert es auch nicht, daß das Theater die-
ser Zeit keine eigenständige Darstellungsform entwickelte, sondern lediglich als
Ableger einer anderen Disziplin erscheint, die wesentlich mit dem Wort arbeitet: der
Rhetorik. Mit den Mitteln einer solchen Schauspielkunst konnte nur eine typisie-
rende Wiedergabe des Menschen auf der Bühne erreicht werden. Eine differenzierte
Darstellungsform, mit der individuelle, psychologisch stimmige Verhaltensweisen
eines Menschen, geprägt durch Charakter, Alter und viele weitere Faktoren, zum
Ausdruck gebracht werden konnten, wurde nicht entwickelt. Es fehlten dazu die Vor-
aussetzungen, aber es bestand auch keine Notwendigkeit.
Im 18. Jahrhundert konnte diese Spielweise nicht mehr zufriedenstellen. Mit ihr
war es nicht möglich, dem vermehrten Interesse an der Wiedergabe seelischer Vor-
gänge nachzukommen und dem zunehmenden Wissen um die menschliche Psyche
zu genügen. Die rhetorische Ausdrucksweise erschien unglaubwürdig, sobald sie auf
auf ihren realen Gehalt hinterfragt wurde. Es sollten auf der Bühne nun nicht mehr
Typen mit allgemeingültigen, sich stets wiederholenden Verhaltensweisen gezeigt
werden, sondern Individuen, die in einer einmaligen und einzigartigen Situation
gemäß ihrem Charakter, Alter, sozialen Stand etc. handeln. Es galt also, schauspiele-
rische Mittel zu erarbeiten, die dem neuen psychologisierenden Menschenbild
gerecht wurden und mit denen psychische Regungen zum Ausdruck gebracht wer-
den konnten. Dies erinnert an die Bemühungen in der Bildenden Kunst, Le Bruns
typisierten mimischen Ausdrucksformen solche entgegenzustellen, die differenziert
sind entsprechend den individuellen Prägungen der einzelnen Menschen. Beide
Bestrebungen - diejenige in der Bildenden und in der Darstellenden Kunst - entstan-
den nicht nur zur gleichen Zeit, sie sind auch auf dieselben geistesgeschichtlichen
Entwicklungen zurückzuführen.
Die Aktivitäten der Schauspielkunst lassen sich auf zwei Ebenen verfolgen: in der
praktischen Arbeit der Akteure und in den Überlegungen von Theoretikern. Den
vielleicht deutlichsten Eindruck von der Darstellungsform einzelner Schauspieler
vermitteln neben zeitgenössischen Schilderungen die Rollenporträts. Die recht
neue, in England entstandene Bildform gibt gleichzeitig Auskunft über das Interesse
der Malerei an der Arbeit ihrer Schwesterkunst, der Schauspielerei. Auch wenn die
Objektivität der Berichterstattung dieser Bilder nicht immer gewährleistet sein mag,