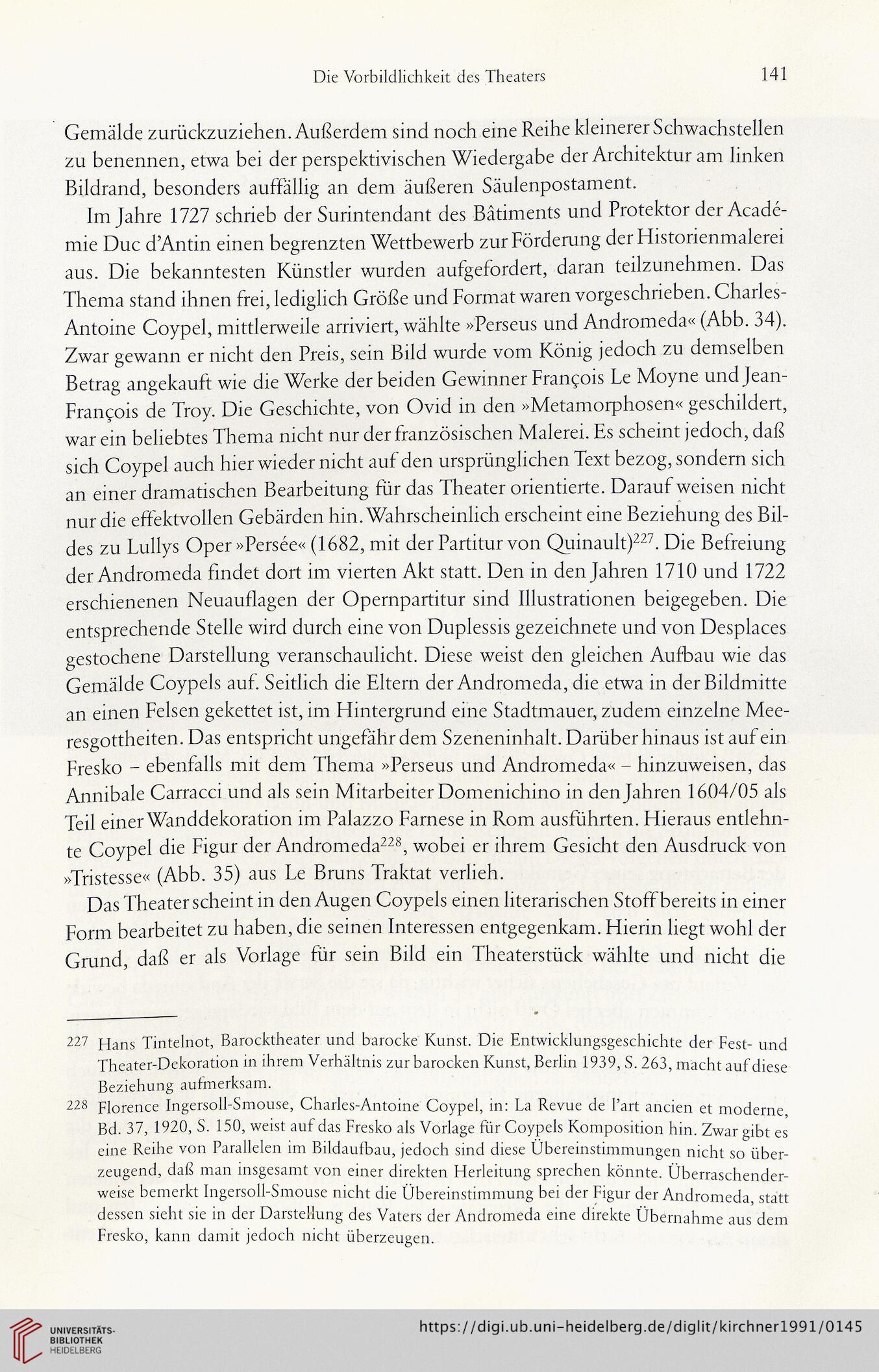Die Vorbildlichkeit des Theaters
141
Gemälde zurückzuziehen. Außerdem sind noch eine Reihe kleinerer Schwachstellen
zu benennen, etwa bei der perspektivischen Wiedergabe der Architektur am linken
Bildrand, besonders auffällig an dem äußeren Säulenpostament.
Im Jahre 1727 schrieb der Surintendant des Bâtiments und Protektor der Acadé-
mie Duc d'Antin einen begrenzten Wettbewerb zur Förderung der Historienmalerei
aus. Die bekanntesten Künstler wurden aufgefordert, daran teilzunehmen. Das
Thema stand ihnen frei, lediglich Größe und Format waren vorgeschrieben. Charles-
Antoine Coypel, mittlerweile arriviert, wählte »Perseus und Andromeda« (Abb. 34).
Zwar gewann er nicht den Preis, sein Bild wurde vom König jedoch zu demselben
Betrag angekauft wie die Werke der beiden Gewinner François Le Moyne und Jean-
François de Troy. Die Geschichte, von Ovid in den »Metamorphosen« geschildert,
war ein beliebtes Thema nicht nur der französischen Malerei. Es scheint jedoch, daß
sich Coypel auch hier wieder nicht auf den ursprünglichen Text bezog, sondern sich
an einer dramatischen Bearbeitung für das Theater orientierte. Darauf weisen nicht
nur die effektvollen Gebärden hin.Wahrscheinlich erscheint eine Beziehung des Bil-
des zu Lullys Oper »Persée« (1682, mit der Partitur von Quinault)227. Die Befreiung
der Andromeda findet dort im vierten Akt statt. Den in den Jahren 1710 und 1722
erschienenen Neuauflagen der Opernpartitur sind Illustrationen beigegeben. Die
entsprechende Stelle wird durch eine von Duplessis gezeichnete und von Desplaces
gestochene Darstellung veranschaulicht. Diese weist den gleichen Aufbau wie das
Gemälde Coypels auf. Seitlich die Eltern der Andromeda, die etwa in der Bildmitte
an einen Felsen gekettet ist, im Hintergrund eine Stadtmauer, zudem einzelne Mee-
resgottheiten. Das entspricht ungefähr dem Szeneninhalt. Darüber hinaus ist auf ein
Fresko - ebenfalls mit dem Thema »Perseus und Andromeda« - hinzuweisen, das
Annibale Carracci und als sein Mitarbeiter Domenichino in den Jahren 1604/05 als
Teil einer Wanddekoration im Palazzo Farnese in Rom ausführten. Hieraus entlehn-
te Coypel die Figur der Andromeda228, wobei er ihrem Gesicht den Ausdruck von
»Tristesse« (Abb. 35) aus Le Bruns Traktat verlieh.
Das Theater scheint in den Augen Coypels einen literarischen Stoff bereits in einer
Form bearbeitet zu haben, die seinen Interessen entgegenkam. Hierin liegt wohl der
Grund, daß er als Vorlage für sein Bild ein Theaterstück wählte und nicht die
227 Hans Tintelnot, Barocktheater und barocke Kunst. Die Entwicklungsgeschichte der Fest- und
Theater-Dekoration in ihrem Verhältnis zur barocken Kunst, Berlin 1939, S. 263, macht auf diese
Beziehung aufmerksam.
228 Florence Ingersoll-Smouse, Charles-Antoine Coypel, in: La Revue de l'art ancien et moderne
Bd. 37, 1920, S. 150, weist auf das Fresko als Vorlage für Coypels Komposition hin. Zwar gibt es
eine Reihe von Parallelen im Bildaufbau, jedoch sind diese Übereinstimmungen nicht so über-
zeugend, daß man insgesamt von einer direkten Herleitung sprechen könnte. Überraschender-
weise bemerkt Ingersoll-Smouse nicht die Übereinstimmung bei der Figur der Andromeda statt
dessen sieht sie in der Darstellung des Vaters der Andromeda eine direkte Übernahme aus dem
Fresko, kann damit jedoch nicht überzeugen.
141
Gemälde zurückzuziehen. Außerdem sind noch eine Reihe kleinerer Schwachstellen
zu benennen, etwa bei der perspektivischen Wiedergabe der Architektur am linken
Bildrand, besonders auffällig an dem äußeren Säulenpostament.
Im Jahre 1727 schrieb der Surintendant des Bâtiments und Protektor der Acadé-
mie Duc d'Antin einen begrenzten Wettbewerb zur Förderung der Historienmalerei
aus. Die bekanntesten Künstler wurden aufgefordert, daran teilzunehmen. Das
Thema stand ihnen frei, lediglich Größe und Format waren vorgeschrieben. Charles-
Antoine Coypel, mittlerweile arriviert, wählte »Perseus und Andromeda« (Abb. 34).
Zwar gewann er nicht den Preis, sein Bild wurde vom König jedoch zu demselben
Betrag angekauft wie die Werke der beiden Gewinner François Le Moyne und Jean-
François de Troy. Die Geschichte, von Ovid in den »Metamorphosen« geschildert,
war ein beliebtes Thema nicht nur der französischen Malerei. Es scheint jedoch, daß
sich Coypel auch hier wieder nicht auf den ursprünglichen Text bezog, sondern sich
an einer dramatischen Bearbeitung für das Theater orientierte. Darauf weisen nicht
nur die effektvollen Gebärden hin.Wahrscheinlich erscheint eine Beziehung des Bil-
des zu Lullys Oper »Persée« (1682, mit der Partitur von Quinault)227. Die Befreiung
der Andromeda findet dort im vierten Akt statt. Den in den Jahren 1710 und 1722
erschienenen Neuauflagen der Opernpartitur sind Illustrationen beigegeben. Die
entsprechende Stelle wird durch eine von Duplessis gezeichnete und von Desplaces
gestochene Darstellung veranschaulicht. Diese weist den gleichen Aufbau wie das
Gemälde Coypels auf. Seitlich die Eltern der Andromeda, die etwa in der Bildmitte
an einen Felsen gekettet ist, im Hintergrund eine Stadtmauer, zudem einzelne Mee-
resgottheiten. Das entspricht ungefähr dem Szeneninhalt. Darüber hinaus ist auf ein
Fresko - ebenfalls mit dem Thema »Perseus und Andromeda« - hinzuweisen, das
Annibale Carracci und als sein Mitarbeiter Domenichino in den Jahren 1604/05 als
Teil einer Wanddekoration im Palazzo Farnese in Rom ausführten. Hieraus entlehn-
te Coypel die Figur der Andromeda228, wobei er ihrem Gesicht den Ausdruck von
»Tristesse« (Abb. 35) aus Le Bruns Traktat verlieh.
Das Theater scheint in den Augen Coypels einen literarischen Stoff bereits in einer
Form bearbeitet zu haben, die seinen Interessen entgegenkam. Hierin liegt wohl der
Grund, daß er als Vorlage für sein Bild ein Theaterstück wählte und nicht die
227 Hans Tintelnot, Barocktheater und barocke Kunst. Die Entwicklungsgeschichte der Fest- und
Theater-Dekoration in ihrem Verhältnis zur barocken Kunst, Berlin 1939, S. 263, macht auf diese
Beziehung aufmerksam.
228 Florence Ingersoll-Smouse, Charles-Antoine Coypel, in: La Revue de l'art ancien et moderne
Bd. 37, 1920, S. 150, weist auf das Fresko als Vorlage für Coypels Komposition hin. Zwar gibt es
eine Reihe von Parallelen im Bildaufbau, jedoch sind diese Übereinstimmungen nicht so über-
zeugend, daß man insgesamt von einer direkten Herleitung sprechen könnte. Überraschender-
weise bemerkt Ingersoll-Smouse nicht die Übereinstimmung bei der Figur der Andromeda statt
dessen sieht sie in der Darstellung des Vaters der Andromeda eine direkte Übernahme aus dem
Fresko, kann damit jedoch nicht überzeugen.