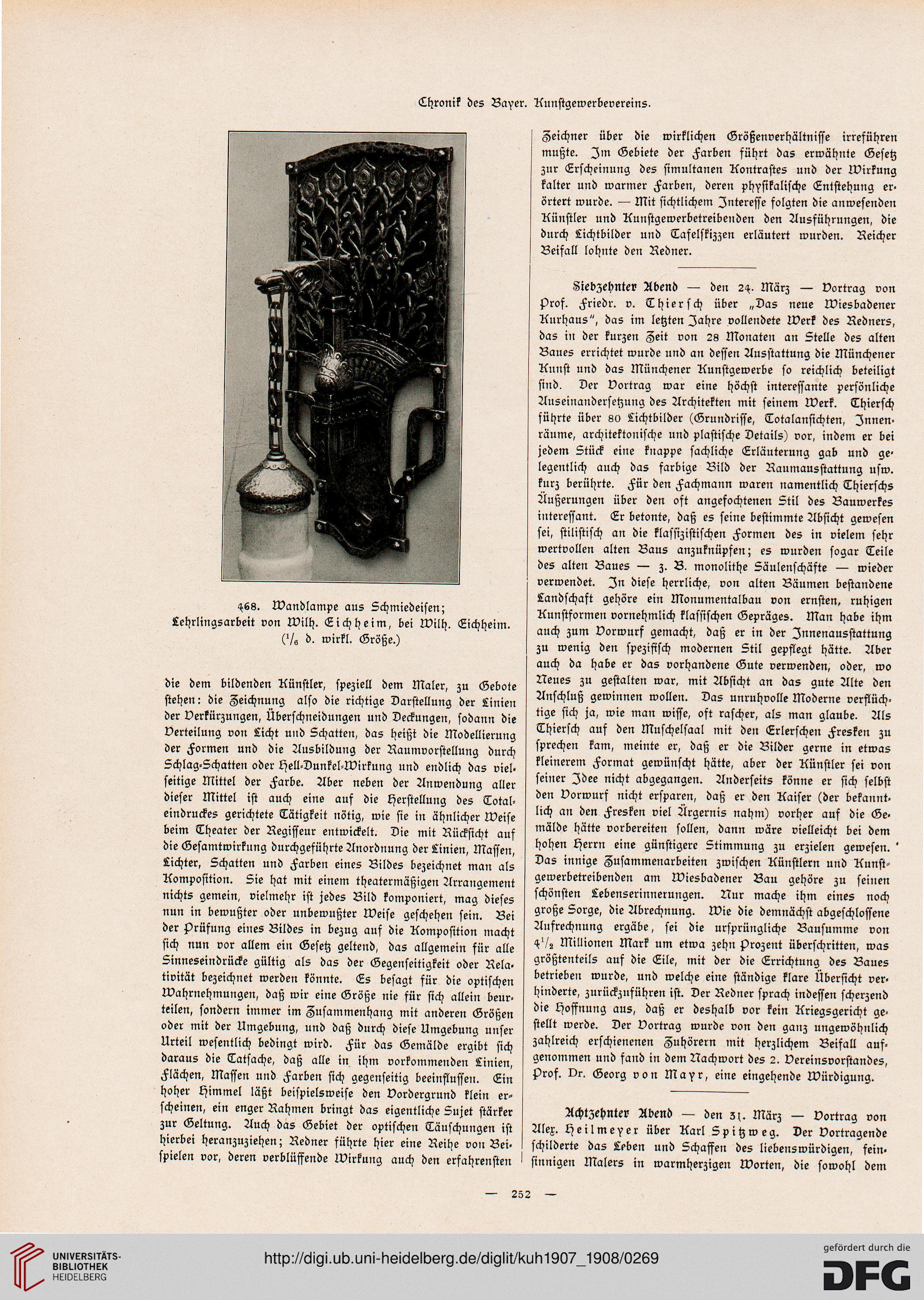Lhronik des Bayer. Kunstgewerbevereins.
q.S8. Wandlampe aus Schmiedeisen;
Lehrlingsarbeit von Wilh. Eich heim, bei Wilh. Eichheim.
(l/0 d. wirkl. Größe.)
die dem bildenden Künstler, speziell dem Maler, zu Gebote
stehen: die Zeichnung also die richtige Darstellung der Linien
der Verkürzungen, Überschneidungen und Deckungen, sodann die
Verteilung von Licht und Schatten, das heißt die Modellierung
der Formen und die Ausbildung der Raumvorstellung durch
Schlag-Schatten oder kfell-Dunkel-wirkung und endlich das viel-
seitige Mittel der Farbe. Aber neben der Anwendung aller
dieser Mittel ist auch eine auf die Herstellung des Total-
eindruckes gerichtete Tätigkeit nötig, wie sie in ähnlicher Weise
beim Theater der Regisseur entwickelt. Die mit Rücksicht auf
die Gesamtwirkung durchgeführte Anordnung der Linien, Massen,
Lichter, Schatten und Farben eines Bildes bezeichnet man als
Komposition. Sie hat mit einem theatermäßigen Arrangement
nichts gemein, vielmehr ist jedes Bild komponiert, mag dieses
nun in bewußter oder unbewußter weise geschehen sein. Bei
der Prüfung eines Bildes in bezug auf die Komposition macht
sich nun vor allem ein Gesetz geltend, das allgemein für alle
Sinneseindrücke gültig als das der Gegenseitigkeit oder Rela-
tivität bezeichnet werden könnte. Es besagt für die optischen
Wahrnehmungen, daß wir eine Größe nie für sich allein beur-
teilen, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Größen
oder mit der Umgebung, und daß durch diese Umgebung unser
Urteil wesentlich bedingt wird. Für das Gemälde ergibt sich
daraus die Tatsache, daß alle in ihm vorkommenden Linien,
Flächen, Massen und Farben sich gegenseitig beeinflussen. Lin
hoher Himmel läßt beispielsweise den Vordergrund klein er-
scheinen, ein enger Rahmen bringt das eigentliche Sujet stärker
zur Geltung. Auch das Gebiet der optischen Täuschungen ist
hierbei heranzuziehen; Redner führte hier eine Reihe von Bei-
spielen vor, deren verblüffende Wirkung auch den erfahrensten I
Zeichner über die wirklichen Größenverhältnisse irreführen
mußte. Im Gebiete der Farben führt das erwähnte Gesetz
zur Erscheinung des simultanen Kontrastes und der Wirkung
kalter und warmer Farben, deren physikalische Entstehung er-
örtert wurde. — Mit sichtlichem Interesse folgten die anwesenden
Künstler und Kunstgewerbetreibenden den Ausführungen, die
durch Lichtbilder und Tafelskizzen erläutert wurden. Reicher
Beifall lohnte den Redner.
Ziebzehnter Abend — den 24. März — Vortrag von
Prof. Friedr. v. Thiersch über „Das neue Wiesbadener
Kurhaus", das im letzten Jahre vollendete Werk des Redners,
das in der kurzen Zeit von 28 Monaten an Stelle des alten
Baues errichtet wurde und an dessen Ausstattung die Münchener
Kunst und das Münchener Kunstgewerbe so reichlich beteiligt
sind. Der Vortrag war eine höchst interessante persönliche
Auseinandersetzung des Architekten mit seinem Werk. Thiersch
führte über 80 Lichtbilder (Grundrisse, Totalansichten, Innen-
räume, architektonische und plastische Details) vor, indem er bei
jedem Stück eine knappe sachliche Erläuterung gab und ge-
legentlich auch das farbige Bild der Raumausstattung usw.
kurz berührte. Für den Fachmann waren namentlich Thierschs
Äußerungen über den oft angefochtenen Stil des Bauwerkes
interessant. Er betonte, daß es seine bestimmte Absicht gewesen
sei, stilistisch an die klassizistischen Formen des in vielem sehr
wertvollen alten Baus anzuknüpfen; es wurden sogar Teile
des alten Baues — z. B. monolithe Säulenschäfte — wieder
verwendet. In diese herrliche, von alten Bäumen bestandene
Landschaft gehöre ein Monumentalbau von ernsten, ruhigen
Kunstformen vornehmlich klassischen Gepräges. Man habe ihm
auch zum Vorwurf gemacht, daß er in der Innenausstattung
zu wenig den spezifisch modernen Stil gepflegt hätte. Aber
auch da habe er das vorhandene Gute verwenden, oder, wo
Neues zu gestalten war, mit Absicht an das gute Alte den
Anschluß gewinnen wollen. Das unruhvolle Moderne verflüch-
tige sich ja, wie man wisse, oft rascher, als man glaube. Als
Thiersch auf den Muschelsaal mit den Erlerschen Fresken zu
sprechen kam, meinte er, daß er die Bilder gerne in etwas
kleinerem Format gewünscht hätte, aber der Künstler sei von
seiner Idee nicht abgegangen. Anderseits könne er sich selbst
den Vorwurf nicht ersparen, daß er den Kaiser (der bekannt-
lich an den Fresken viel Ärgernis nahm) vorher auf die Ge-
mälde hätte vorbereiten sollen, dann wäre vielleicht bei dem
hohen Herrn eine günstigere Stimmung zu erzielen gewesen. '
Das innige Zusammenarbeiten zwischen Künstlern und Kunst-
gewerbetreibenden am Wiesbadener Bau gehöre zu feinen
schönsten Lebenserinnerungen. Nur mache ihm eines noch
große Sorge, die Abrechnung, wie die demnächst abgeschlossene
Aufrechnung ergäbe, sei die ursprüngliche Bausumme von
V/a Millionen Mark um etwa zehn Prozent überschritten, was
größtenteils auf die Eile, mit der die Errichtung des Baues
betrieben wurde, und welche eine ständige klare Übersicht ver-
hinderte, zurückzuführen ist. Der Redner sprach indessen scherzend
die Hoffnung aus, daß er deshalb vor kein Kriegsgericht ge-
stellt werde. Der Vortrag wurde von den ganz ungewöhnlich
zahlreich erschienenen Zuhörern mit herzlichem Beifall aus-
genommen und fand in dem Nachwort des 2. Vereinsvorstandes,
Prof. vr. Georg von Mayr, eine eingehende Würdigung.
Achtzehnter Abend — den 3(. März — Vortrag von
Alex, Heilmeyer über Karl Spitzweg. Der Vortragende
schilderte das Leben und Schaffen des liebenswürdigen, fein-
sinnigen Malers in warmherzigen Worten, die sowohl dem
252
q.S8. Wandlampe aus Schmiedeisen;
Lehrlingsarbeit von Wilh. Eich heim, bei Wilh. Eichheim.
(l/0 d. wirkl. Größe.)
die dem bildenden Künstler, speziell dem Maler, zu Gebote
stehen: die Zeichnung also die richtige Darstellung der Linien
der Verkürzungen, Überschneidungen und Deckungen, sodann die
Verteilung von Licht und Schatten, das heißt die Modellierung
der Formen und die Ausbildung der Raumvorstellung durch
Schlag-Schatten oder kfell-Dunkel-wirkung und endlich das viel-
seitige Mittel der Farbe. Aber neben der Anwendung aller
dieser Mittel ist auch eine auf die Herstellung des Total-
eindruckes gerichtete Tätigkeit nötig, wie sie in ähnlicher Weise
beim Theater der Regisseur entwickelt. Die mit Rücksicht auf
die Gesamtwirkung durchgeführte Anordnung der Linien, Massen,
Lichter, Schatten und Farben eines Bildes bezeichnet man als
Komposition. Sie hat mit einem theatermäßigen Arrangement
nichts gemein, vielmehr ist jedes Bild komponiert, mag dieses
nun in bewußter oder unbewußter weise geschehen sein. Bei
der Prüfung eines Bildes in bezug auf die Komposition macht
sich nun vor allem ein Gesetz geltend, das allgemein für alle
Sinneseindrücke gültig als das der Gegenseitigkeit oder Rela-
tivität bezeichnet werden könnte. Es besagt für die optischen
Wahrnehmungen, daß wir eine Größe nie für sich allein beur-
teilen, sondern immer im Zusammenhang mit anderen Größen
oder mit der Umgebung, und daß durch diese Umgebung unser
Urteil wesentlich bedingt wird. Für das Gemälde ergibt sich
daraus die Tatsache, daß alle in ihm vorkommenden Linien,
Flächen, Massen und Farben sich gegenseitig beeinflussen. Lin
hoher Himmel läßt beispielsweise den Vordergrund klein er-
scheinen, ein enger Rahmen bringt das eigentliche Sujet stärker
zur Geltung. Auch das Gebiet der optischen Täuschungen ist
hierbei heranzuziehen; Redner führte hier eine Reihe von Bei-
spielen vor, deren verblüffende Wirkung auch den erfahrensten I
Zeichner über die wirklichen Größenverhältnisse irreführen
mußte. Im Gebiete der Farben führt das erwähnte Gesetz
zur Erscheinung des simultanen Kontrastes und der Wirkung
kalter und warmer Farben, deren physikalische Entstehung er-
örtert wurde. — Mit sichtlichem Interesse folgten die anwesenden
Künstler und Kunstgewerbetreibenden den Ausführungen, die
durch Lichtbilder und Tafelskizzen erläutert wurden. Reicher
Beifall lohnte den Redner.
Ziebzehnter Abend — den 24. März — Vortrag von
Prof. Friedr. v. Thiersch über „Das neue Wiesbadener
Kurhaus", das im letzten Jahre vollendete Werk des Redners,
das in der kurzen Zeit von 28 Monaten an Stelle des alten
Baues errichtet wurde und an dessen Ausstattung die Münchener
Kunst und das Münchener Kunstgewerbe so reichlich beteiligt
sind. Der Vortrag war eine höchst interessante persönliche
Auseinandersetzung des Architekten mit seinem Werk. Thiersch
führte über 80 Lichtbilder (Grundrisse, Totalansichten, Innen-
räume, architektonische und plastische Details) vor, indem er bei
jedem Stück eine knappe sachliche Erläuterung gab und ge-
legentlich auch das farbige Bild der Raumausstattung usw.
kurz berührte. Für den Fachmann waren namentlich Thierschs
Äußerungen über den oft angefochtenen Stil des Bauwerkes
interessant. Er betonte, daß es seine bestimmte Absicht gewesen
sei, stilistisch an die klassizistischen Formen des in vielem sehr
wertvollen alten Baus anzuknüpfen; es wurden sogar Teile
des alten Baues — z. B. monolithe Säulenschäfte — wieder
verwendet. In diese herrliche, von alten Bäumen bestandene
Landschaft gehöre ein Monumentalbau von ernsten, ruhigen
Kunstformen vornehmlich klassischen Gepräges. Man habe ihm
auch zum Vorwurf gemacht, daß er in der Innenausstattung
zu wenig den spezifisch modernen Stil gepflegt hätte. Aber
auch da habe er das vorhandene Gute verwenden, oder, wo
Neues zu gestalten war, mit Absicht an das gute Alte den
Anschluß gewinnen wollen. Das unruhvolle Moderne verflüch-
tige sich ja, wie man wisse, oft rascher, als man glaube. Als
Thiersch auf den Muschelsaal mit den Erlerschen Fresken zu
sprechen kam, meinte er, daß er die Bilder gerne in etwas
kleinerem Format gewünscht hätte, aber der Künstler sei von
seiner Idee nicht abgegangen. Anderseits könne er sich selbst
den Vorwurf nicht ersparen, daß er den Kaiser (der bekannt-
lich an den Fresken viel Ärgernis nahm) vorher auf die Ge-
mälde hätte vorbereiten sollen, dann wäre vielleicht bei dem
hohen Herrn eine günstigere Stimmung zu erzielen gewesen. '
Das innige Zusammenarbeiten zwischen Künstlern und Kunst-
gewerbetreibenden am Wiesbadener Bau gehöre zu feinen
schönsten Lebenserinnerungen. Nur mache ihm eines noch
große Sorge, die Abrechnung, wie die demnächst abgeschlossene
Aufrechnung ergäbe, sei die ursprüngliche Bausumme von
V/a Millionen Mark um etwa zehn Prozent überschritten, was
größtenteils auf die Eile, mit der die Errichtung des Baues
betrieben wurde, und welche eine ständige klare Übersicht ver-
hinderte, zurückzuführen ist. Der Redner sprach indessen scherzend
die Hoffnung aus, daß er deshalb vor kein Kriegsgericht ge-
stellt werde. Der Vortrag wurde von den ganz ungewöhnlich
zahlreich erschienenen Zuhörern mit herzlichem Beifall aus-
genommen und fand in dem Nachwort des 2. Vereinsvorstandes,
Prof. vr. Georg von Mayr, eine eingehende Würdigung.
Achtzehnter Abend — den 3(. März — Vortrag von
Alex, Heilmeyer über Karl Spitzweg. Der Vortragende
schilderte das Leben und Schaffen des liebenswürdigen, fein-
sinnigen Malers in warmherzigen Worten, die sowohl dem
252