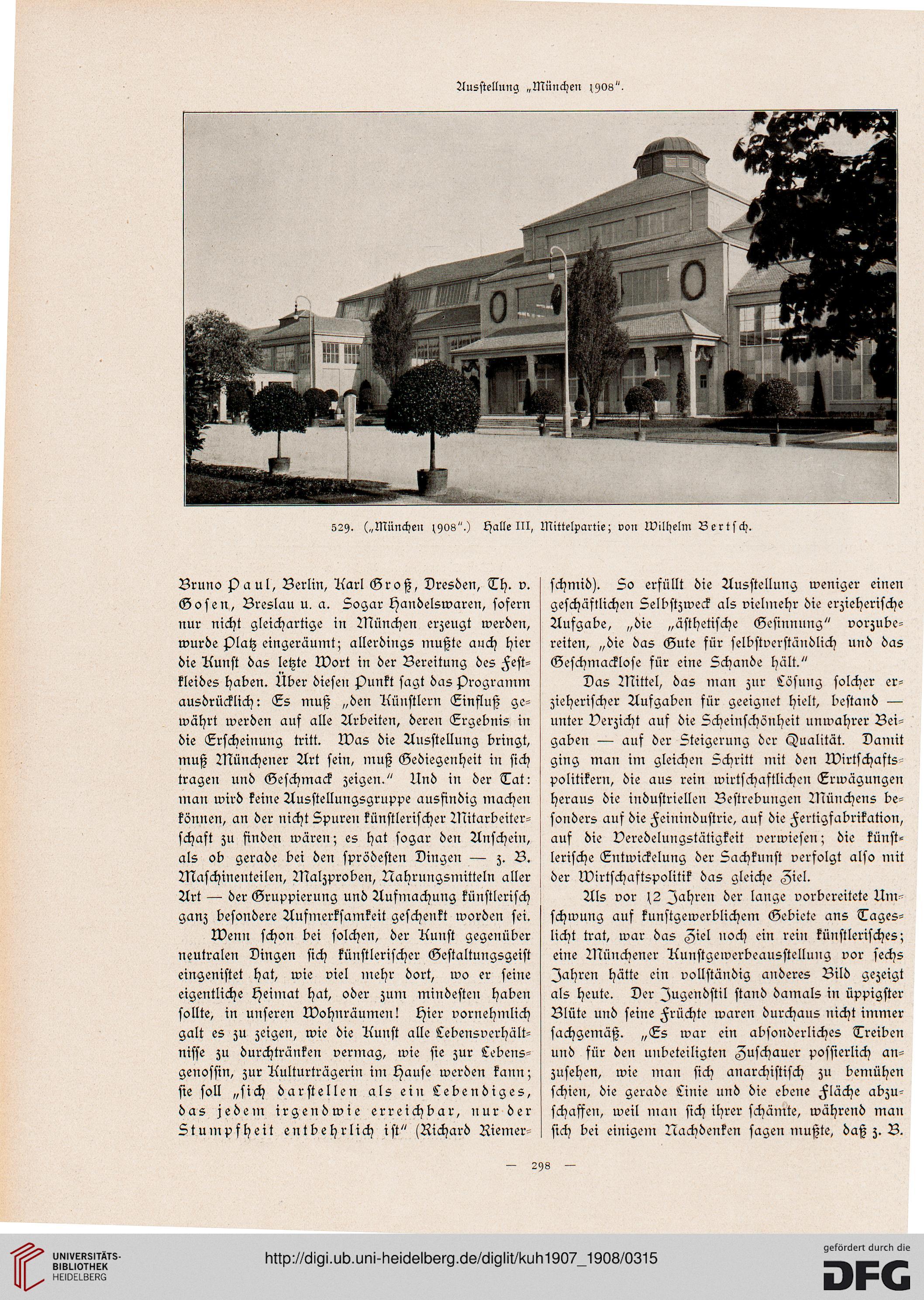Ausstellung „München jgos".
529. („München 1908".) Halle III, Mittelpartie; von Wilhelm Bertsch.
Bruno Paul, Berlin, Karl Groß, Dresden, Th. v.
Gosen, Breslau u. a. Sogar Handelswaren, sofern
nur nicht gleichartige in München erzeugt werden,
wurde Platz eingeräumt; allerdings mußte auch hier
die Kunst das letzte Wort in der Bereitung des Fest-
kleides haben. Über diesen Punkt sagt das Programm
ausdrücklich: Ts muß „den Künstlern Tinfluß ge-
währt werden auf alle Arbeiten, deren Ergebnis in
die Erscheinung tritt. Was die Ausstellung bringt,
muß Münchener Art sein, muß Gediegenheit in sich
tragen und Geschmack zeigen." Und in der Tat:
man wird keine Ausstellungsgruppe ausfindig machen
können, an der nicht Spuren künstlerischer Mitarbeiter-
schast zu finden wären; es hat sogar den Anschein,
als ob gerade bei den sprödesten Dingen — z. B.
Maschinenteilen, Malzproben, Nahrungsmitteln aller
Art — der Gruppierung und Aufmachung künstlerisch
ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.
Wenn schon bei solchen, der Ärmst gegenüber
neutralen Dingen sich künstlerischer Gestaltungsgeist
eingenistet hat, wie viel mehr dort, wo er seine
eigentliche Heimat hat, oder zum mindesten haben
sollte, in unseren Wohnräumen! Hier vornehmlich
galt es zu zeigen, wie die Aunst alle Lebensverhält-
nisse zu durchtränken vermag, wie sie zur Lebens-
genossin, zur Kulturträgern im Hause werden kann;
sie soll „sich darstellen als ein Lebendiges,
das jedem irgendwie erreichbar, nur der
Stumpfheit entbehrlich ist" (Richard Riemer
fchmid). So erfüllt die Ausstellung weniger einen
geschäftlichen Selbstzweck als vielmehr die erzieherische
Aufgabe, „die „ästhetische Gesinnung" vorzube-
reiten, „die das Gute für selbstverständlich und das
Geschmacklose für eine Schande hält."
Das Mittel, das man zur Lösung solcher er-
zieherischer Aufgaben für geeignet hielt, bestand —
unter Verzicht auf die Scheinschönheit unwahrer Bei-
gaben — auf der Steigerung der Qualität. Damit
ging man im gleichen Schritt mit den Wirtschafts-
politikern, dis aus rein wirtschaftlichen Erwägungen
heraus die industriellen Bestrebungen Münchens be-
sonders aus die Feinindustrie, aus die Ferligfabrikation,
auf die Veredelungstätigkeit verwiesen; die künst-
lerische Entwickelung der Sachkunst verfolgt also mit
der Wirtschaftspolitik das gleiche Ziel.
Als vor \2 Jahren der lange vorbereitete Um-
schwung auf kunstgewerblichem Gebiete ans Tages-
licht trat, war das Ziel noch ein rein künstlerisches;
eine Münchener Aunstgewerbeausstellung vor sechs
Jahren hätte ein vollständig anderes Bild gezeigt
als heute. Der Jugendstil stand damals in üppigster
Blüte und seine Früchte waren durchaus nicht immer
sachgemäß. „Es war ein absonderliches Treiben
und für den unbeteiligten Zuschauer possierlich an-
zusehen, wie man sich anarchistisch zu beniühen
schien, die gerade Linie und die ebene Fläche abzu-
schaffen, weil man sich ihrer schämte, während man
sich bei einigem Nachdenken sagen mußte, daß z. B.
2Y8
529. („München 1908".) Halle III, Mittelpartie; von Wilhelm Bertsch.
Bruno Paul, Berlin, Karl Groß, Dresden, Th. v.
Gosen, Breslau u. a. Sogar Handelswaren, sofern
nur nicht gleichartige in München erzeugt werden,
wurde Platz eingeräumt; allerdings mußte auch hier
die Kunst das letzte Wort in der Bereitung des Fest-
kleides haben. Über diesen Punkt sagt das Programm
ausdrücklich: Ts muß „den Künstlern Tinfluß ge-
währt werden auf alle Arbeiten, deren Ergebnis in
die Erscheinung tritt. Was die Ausstellung bringt,
muß Münchener Art sein, muß Gediegenheit in sich
tragen und Geschmack zeigen." Und in der Tat:
man wird keine Ausstellungsgruppe ausfindig machen
können, an der nicht Spuren künstlerischer Mitarbeiter-
schast zu finden wären; es hat sogar den Anschein,
als ob gerade bei den sprödesten Dingen — z. B.
Maschinenteilen, Malzproben, Nahrungsmitteln aller
Art — der Gruppierung und Aufmachung künstlerisch
ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.
Wenn schon bei solchen, der Ärmst gegenüber
neutralen Dingen sich künstlerischer Gestaltungsgeist
eingenistet hat, wie viel mehr dort, wo er seine
eigentliche Heimat hat, oder zum mindesten haben
sollte, in unseren Wohnräumen! Hier vornehmlich
galt es zu zeigen, wie die Aunst alle Lebensverhält-
nisse zu durchtränken vermag, wie sie zur Lebens-
genossin, zur Kulturträgern im Hause werden kann;
sie soll „sich darstellen als ein Lebendiges,
das jedem irgendwie erreichbar, nur der
Stumpfheit entbehrlich ist" (Richard Riemer
fchmid). So erfüllt die Ausstellung weniger einen
geschäftlichen Selbstzweck als vielmehr die erzieherische
Aufgabe, „die „ästhetische Gesinnung" vorzube-
reiten, „die das Gute für selbstverständlich und das
Geschmacklose für eine Schande hält."
Das Mittel, das man zur Lösung solcher er-
zieherischer Aufgaben für geeignet hielt, bestand —
unter Verzicht auf die Scheinschönheit unwahrer Bei-
gaben — auf der Steigerung der Qualität. Damit
ging man im gleichen Schritt mit den Wirtschafts-
politikern, dis aus rein wirtschaftlichen Erwägungen
heraus die industriellen Bestrebungen Münchens be-
sonders aus die Feinindustrie, aus die Ferligfabrikation,
auf die Veredelungstätigkeit verwiesen; die künst-
lerische Entwickelung der Sachkunst verfolgt also mit
der Wirtschaftspolitik das gleiche Ziel.
Als vor \2 Jahren der lange vorbereitete Um-
schwung auf kunstgewerblichem Gebiete ans Tages-
licht trat, war das Ziel noch ein rein künstlerisches;
eine Münchener Aunstgewerbeausstellung vor sechs
Jahren hätte ein vollständig anderes Bild gezeigt
als heute. Der Jugendstil stand damals in üppigster
Blüte und seine Früchte waren durchaus nicht immer
sachgemäß. „Es war ein absonderliches Treiben
und für den unbeteiligten Zuschauer possierlich an-
zusehen, wie man sich anarchistisch zu beniühen
schien, die gerade Linie und die ebene Fläche abzu-
schaffen, weil man sich ihrer schämte, während man
sich bei einigem Nachdenken sagen mußte, daß z. B.
2Y8