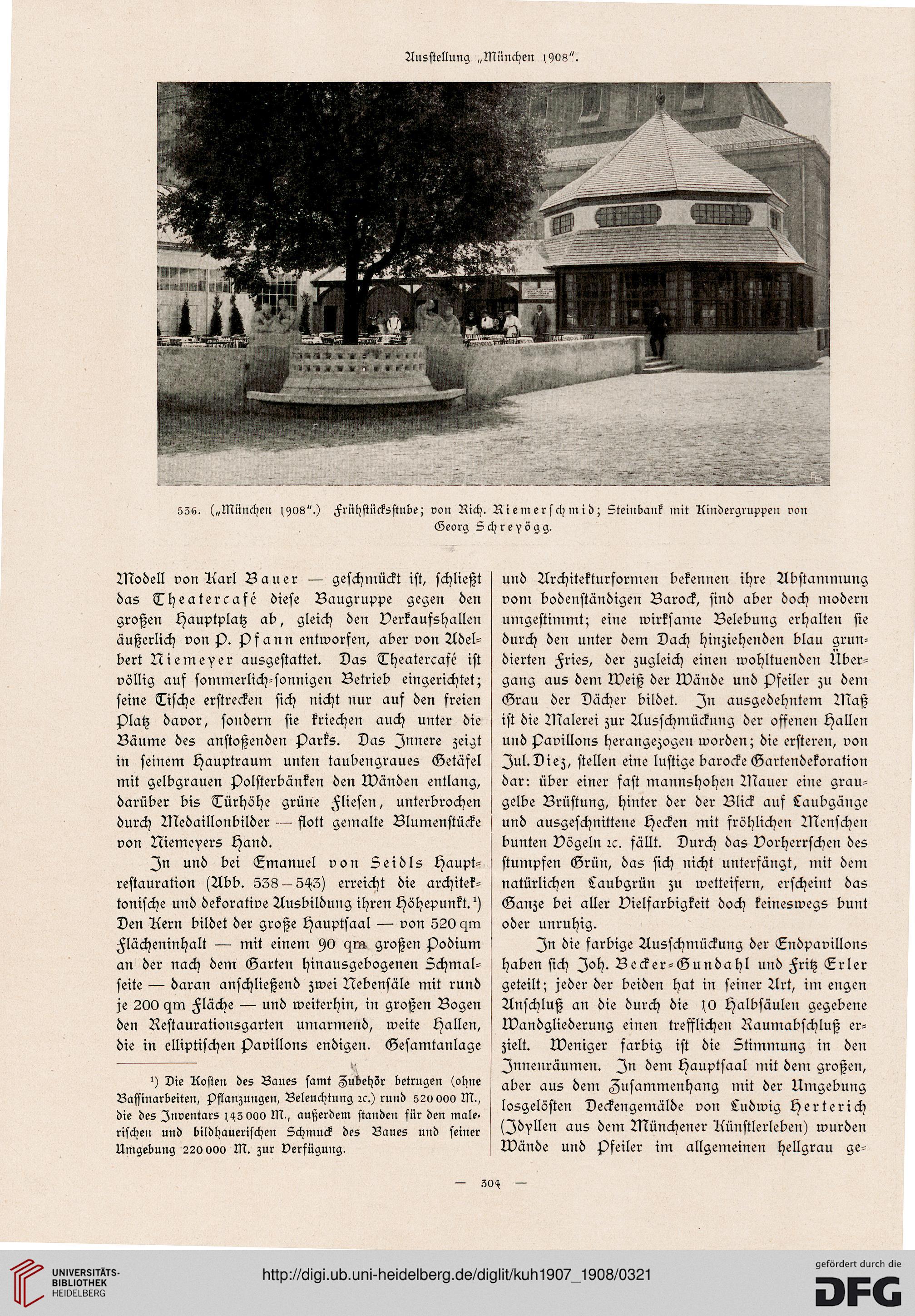Ausstellung „München ;908".
556. („München 1908".) Frühstücks sinke; von Rich. Riemerschmid; Steinbank mit Rindergruppen von
Georg 5 ch r e y ö g g.
Modell von Aarl Bauer — geschmückt ist, schließt
das Theatercafe diese Baugruppe gegen den
großen pauptplatz ab, gleich den Verkaufshallen
äußerlich von p. pfann entworfen, aber von Adel-
bert Niemeyer ausgestattet. Das Theatercafe ist
völlig auf sommerlich-sonnigen Betrieb eingerichtet;
seine Tische erstrecken sich nicht nur auf den freien
Platz davor, sondern sie kriechen auch unter die
Bäume des anstoßenden Parks. Das Innere zeigt
in seinem pauptraum unten taubengraues Getäfel
mit gelbgrauen Polsterbänken den Wänden entlang,
darüber bis Türhöhe grüne fliesen, unterbrochen
durch Medaillonbilder — flott gemalte Blumenstücke
von Niemcyers pand.
In und bei Emanuel von Seidls paupt-
restauration (Abb. 538 — 5^3) erreicht die architek-
tonische und dekorative Ausbildung ihren Höhepunkt?)
Den Aern bildet der große pauptsaal — von 520 qm
Flächeninhalt — mit einem stO qm großen Podium
an der nach dem Garten hinausgebogenen Schmal-
seite — daran anschließend zwei Nebensäle mit rund
je 200 qm Fläche — und weiterhin, in großen Bogen
den Restaurationsgarten umarmend, weite pallen,
die in elliptischen Pavillons endigen. Gesamtanlage
') Die Rosten des Baues samt Zubehör betrugen (ohne
Bassinarbeiten, Pflanzungen, Beleuchtung rc.) rund 520000 M.,
die des Inventars (43000 M., außerdem standen für den male-
rischen und bildhauerischen Schmuck des Laues und seiner
Umgebung 220000 M. zur Verfügung.
und Architektursormen bekennen ihre Abstammung
voni bodenständigen Barock, sind aber doch modern
umgestimmt; eine wirksame Belebung erhalten sie
durch den unter dem Dach hinziehenden blau grun-
dierten Fries, der zugleich einen wohltuenden Über-
gang aus dem Weiß der Wände und Pfeiler zu dem
Grau der Dächer bildet. In ausgedehntem Maß
ist die Malerei zur Ausschmückung der offenen pallen
und Pavillons herangezogen worden; die ersteren, von
Iul.Diez, stellen eine lustige barocke Gartendekoration
dar: über einer fast mannshohen Mauer eine grau-
gelbe Brüstung, hinter der der Blick auf Laubgänge
und ausgeschnittene pecken mit fröhlichen Menschen
bunten Vögeln rc. fällt. Durch das Vorherrschen des
stumpfen Grün, das sich nicht unterfängt, mit dem
natürlichen Laubgrün zu wetteifern, erscheint das
Ganze bei aller Vielfarbigkeit doch keineswegs bunt
oder unruhig.
In die farbige Ausschmückung der Endpavillons
haben sich Ioh. Becker-Gundahl und Fritz Erler
geteilt; jeder der beiden hat in seiner Art, im engen
Anschluß an die durch die \0 palbsäulen gegebene
Wandgliederung einen trefflichen Raumabschluß er-
zielt. Weniger farbig ist die Stimmung in den
Innenräumen. In dem pauptsaal mit dem großen,
aber aus dem Zusammenhang mit der Umgebung
losgelösten Deckengemälde von Ludwig perterich
(Idyllen aus dem Münchener Aünstlerleben) wurden
Wände und Pfeiler im allgeineinen hellgrau ge-
556. („München 1908".) Frühstücks sinke; von Rich. Riemerschmid; Steinbank mit Rindergruppen von
Georg 5 ch r e y ö g g.
Modell von Aarl Bauer — geschmückt ist, schließt
das Theatercafe diese Baugruppe gegen den
großen pauptplatz ab, gleich den Verkaufshallen
äußerlich von p. pfann entworfen, aber von Adel-
bert Niemeyer ausgestattet. Das Theatercafe ist
völlig auf sommerlich-sonnigen Betrieb eingerichtet;
seine Tische erstrecken sich nicht nur auf den freien
Platz davor, sondern sie kriechen auch unter die
Bäume des anstoßenden Parks. Das Innere zeigt
in seinem pauptraum unten taubengraues Getäfel
mit gelbgrauen Polsterbänken den Wänden entlang,
darüber bis Türhöhe grüne fliesen, unterbrochen
durch Medaillonbilder — flott gemalte Blumenstücke
von Niemcyers pand.
In und bei Emanuel von Seidls paupt-
restauration (Abb. 538 — 5^3) erreicht die architek-
tonische und dekorative Ausbildung ihren Höhepunkt?)
Den Aern bildet der große pauptsaal — von 520 qm
Flächeninhalt — mit einem stO qm großen Podium
an der nach dem Garten hinausgebogenen Schmal-
seite — daran anschließend zwei Nebensäle mit rund
je 200 qm Fläche — und weiterhin, in großen Bogen
den Restaurationsgarten umarmend, weite pallen,
die in elliptischen Pavillons endigen. Gesamtanlage
') Die Rosten des Baues samt Zubehör betrugen (ohne
Bassinarbeiten, Pflanzungen, Beleuchtung rc.) rund 520000 M.,
die des Inventars (43000 M., außerdem standen für den male-
rischen und bildhauerischen Schmuck des Laues und seiner
Umgebung 220000 M. zur Verfügung.
und Architektursormen bekennen ihre Abstammung
voni bodenständigen Barock, sind aber doch modern
umgestimmt; eine wirksame Belebung erhalten sie
durch den unter dem Dach hinziehenden blau grun-
dierten Fries, der zugleich einen wohltuenden Über-
gang aus dem Weiß der Wände und Pfeiler zu dem
Grau der Dächer bildet. In ausgedehntem Maß
ist die Malerei zur Ausschmückung der offenen pallen
und Pavillons herangezogen worden; die ersteren, von
Iul.Diez, stellen eine lustige barocke Gartendekoration
dar: über einer fast mannshohen Mauer eine grau-
gelbe Brüstung, hinter der der Blick auf Laubgänge
und ausgeschnittene pecken mit fröhlichen Menschen
bunten Vögeln rc. fällt. Durch das Vorherrschen des
stumpfen Grün, das sich nicht unterfängt, mit dem
natürlichen Laubgrün zu wetteifern, erscheint das
Ganze bei aller Vielfarbigkeit doch keineswegs bunt
oder unruhig.
In die farbige Ausschmückung der Endpavillons
haben sich Ioh. Becker-Gundahl und Fritz Erler
geteilt; jeder der beiden hat in seiner Art, im engen
Anschluß an die durch die \0 palbsäulen gegebene
Wandgliederung einen trefflichen Raumabschluß er-
zielt. Weniger farbig ist die Stimmung in den
Innenräumen. In dem pauptsaal mit dem großen,
aber aus dem Zusammenhang mit der Umgebung
losgelösten Deckengemälde von Ludwig perterich
(Idyllen aus dem Münchener Aünstlerleben) wurden
Wände und Pfeiler im allgeineinen hellgrau ge-