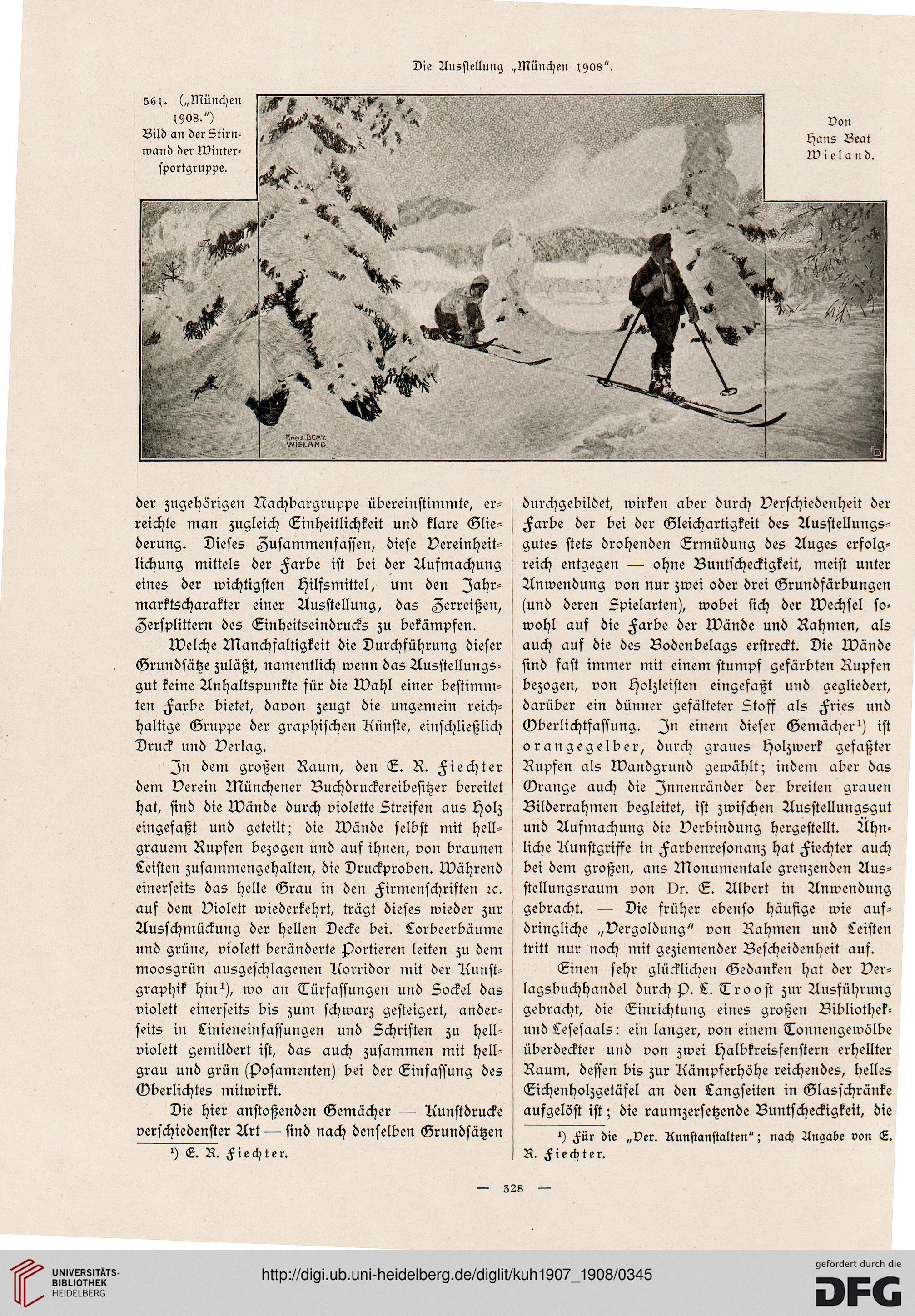Die Ausstellung „München (908".
56 (. („München
(908.")
Bild an der Stirn-
wand der Winter-
sxortgruppe.
von
tsans Beat
Wieland.
der zugehörigen Nachbargruppe übereinstimmte, er-
reichte man zugleich Einheitlichkeit und klare Glie-
derung. Dieses Zusammenfassen, diese Vereinheit-
lichung mittels der Farbe ist bei der Aufmachung
eines der wichtigsten Hilfsmittel, um den Zahr-
marktscharakter einer Ausstellung, das Zerreißen,
Zersplittern des Einheitseindrucks zu bekämpfen.
Welche Nkanchfaltigkeit die Durchführung dieser
Grundsätze zuläßt, namentlich wenn das Ausstellungs-
gut keine Anhaltspunkte für die Wahl einer bestimm-
ten Farbe bietet, davon zeugt die ungemein reich-
haltige Gruppe der graphischen Künste, einschließlich
Druck und Verlag.
In dem großen Raum, den E. R. Fiechter
dem Verein Amnchener Buchdruckereibesitzer bereitet
hat, sind die Wände durch violette Streifen aus Holz
eingefaßt und geteilt; die Wände selbst mit hell-
grauem Rupfen bezogen und aus ihnen, von braunen
Leisten zusammengehalten, die Druckproben. Während
einerseits das Helle Grau in den Firmenschriften ic.
auf dem Violett wiederkehrt, trägt dieses wieder zur
Ausschmückung der Hellen Decke bei. Lorbeerbäume
und grüne, violett beränderte Portieren leiten zu dem
moosgrün ausgeschlagenen Korridor mit der Kunst-
graphik f?in1), wo an Türfassungen und Sockel das
violett einerseits bis zum schwarz gesteigert, ander-
seits in Linieneinfassungen und Schriften zu hell-
violett gemildert ist, das auch zusammen mit hell-
grau und grün (Posamenten) bei der Einfassung des
Oberlichtes mitwirkt.
Die hier anstoßenden Gemächer — Kunstdrucke
verschiedenster Art — sind nach denselben Grundsätzen
*) <£. R. Fiechter.
durchgebildet, wirken aber durch Verschiedenheit der
Farbe der bei der Gleichartigkeit des Ausstellungs-
gutes stets drohenden Ermüdung des Auges erfolg-
reich entgegen — ohne Buntfcheckigkeit, meist unter
Anwendung von nur zwei oder drei Grundfärbungen
(und deren Spielarten), wobei sich der Wechsel so-
wohl auf die Farbe der Wände und Rahmen, als
auch auf die des Bodenbelags erstreckt. Die Wände
sind fast immer mit einem stumpf gefärbten Rupfen
bezogen, von Holzleisten eingefaßt und gegliedert,
darüber ein dünner gefälteter Stoff als Fries und
Oberlichtfaffung. Zn einem dieser Gemächerx) ist
orangegelber, durch graues Holzwerk gefaßter
Rupfen als Wandgrund gewählt; indem aber das
Orange auch die Znnenränder der breiten grauen
Bilderrahmen begleitet, ist zwischen Ausstellungsgut
und Aufmachung die Verbindung hergestellt. Ähn-
liche Kunstgriffe in Farbenresonanz hat Fiechter auch
bei dem großen, ans Nkonumentale grenzenden Aus-
stellungsraum von Dr. E. Albert in Anwendung
gebracht. — Die früher ebenso häufige wie auf-
dringliche ,,Vergoldung" von Rahmen und Leisten
tritt nur noch mit geziemender Bescheidenheit auf.
Einen sehr glücklichen Gedanken hat der Ver-
lagsbuchhandel durch p. L. Trooft zur Ausführung
gebracht, die Einrichtung eines großen Bibliothek-
und Lesesaals: ein langer, von einem Tonnengewölbe
überdeckter und von zwei Halbkreisfenstern erhellter
Raum, dessen bis zur Kämpferhöhe reichendes, Helles
Eichenholzgetäfel an den Langseiten in Glasschränke
aufgelöst ist; die raumzersetzende Buntfcheckigkeit, die
l) Für die „Der. Kunftanftalten"; nach Angabe von L.
R. Fiechter.
528
56 (. („München
(908.")
Bild an der Stirn-
wand der Winter-
sxortgruppe.
von
tsans Beat
Wieland.
der zugehörigen Nachbargruppe übereinstimmte, er-
reichte man zugleich Einheitlichkeit und klare Glie-
derung. Dieses Zusammenfassen, diese Vereinheit-
lichung mittels der Farbe ist bei der Aufmachung
eines der wichtigsten Hilfsmittel, um den Zahr-
marktscharakter einer Ausstellung, das Zerreißen,
Zersplittern des Einheitseindrucks zu bekämpfen.
Welche Nkanchfaltigkeit die Durchführung dieser
Grundsätze zuläßt, namentlich wenn das Ausstellungs-
gut keine Anhaltspunkte für die Wahl einer bestimm-
ten Farbe bietet, davon zeugt die ungemein reich-
haltige Gruppe der graphischen Künste, einschließlich
Druck und Verlag.
In dem großen Raum, den E. R. Fiechter
dem Verein Amnchener Buchdruckereibesitzer bereitet
hat, sind die Wände durch violette Streifen aus Holz
eingefaßt und geteilt; die Wände selbst mit hell-
grauem Rupfen bezogen und aus ihnen, von braunen
Leisten zusammengehalten, die Druckproben. Während
einerseits das Helle Grau in den Firmenschriften ic.
auf dem Violett wiederkehrt, trägt dieses wieder zur
Ausschmückung der Hellen Decke bei. Lorbeerbäume
und grüne, violett beränderte Portieren leiten zu dem
moosgrün ausgeschlagenen Korridor mit der Kunst-
graphik f?in1), wo an Türfassungen und Sockel das
violett einerseits bis zum schwarz gesteigert, ander-
seits in Linieneinfassungen und Schriften zu hell-
violett gemildert ist, das auch zusammen mit hell-
grau und grün (Posamenten) bei der Einfassung des
Oberlichtes mitwirkt.
Die hier anstoßenden Gemächer — Kunstdrucke
verschiedenster Art — sind nach denselben Grundsätzen
*) <£. R. Fiechter.
durchgebildet, wirken aber durch Verschiedenheit der
Farbe der bei der Gleichartigkeit des Ausstellungs-
gutes stets drohenden Ermüdung des Auges erfolg-
reich entgegen — ohne Buntfcheckigkeit, meist unter
Anwendung von nur zwei oder drei Grundfärbungen
(und deren Spielarten), wobei sich der Wechsel so-
wohl auf die Farbe der Wände und Rahmen, als
auch auf die des Bodenbelags erstreckt. Die Wände
sind fast immer mit einem stumpf gefärbten Rupfen
bezogen, von Holzleisten eingefaßt und gegliedert,
darüber ein dünner gefälteter Stoff als Fries und
Oberlichtfaffung. Zn einem dieser Gemächerx) ist
orangegelber, durch graues Holzwerk gefaßter
Rupfen als Wandgrund gewählt; indem aber das
Orange auch die Znnenränder der breiten grauen
Bilderrahmen begleitet, ist zwischen Ausstellungsgut
und Aufmachung die Verbindung hergestellt. Ähn-
liche Kunstgriffe in Farbenresonanz hat Fiechter auch
bei dem großen, ans Nkonumentale grenzenden Aus-
stellungsraum von Dr. E. Albert in Anwendung
gebracht. — Die früher ebenso häufige wie auf-
dringliche ,,Vergoldung" von Rahmen und Leisten
tritt nur noch mit geziemender Bescheidenheit auf.
Einen sehr glücklichen Gedanken hat der Ver-
lagsbuchhandel durch p. L. Trooft zur Ausführung
gebracht, die Einrichtung eines großen Bibliothek-
und Lesesaals: ein langer, von einem Tonnengewölbe
überdeckter und von zwei Halbkreisfenstern erhellter
Raum, dessen bis zur Kämpferhöhe reichendes, Helles
Eichenholzgetäfel an den Langseiten in Glasschränke
aufgelöst ist; die raumzersetzende Buntfcheckigkeit, die
l) Für die „Der. Kunftanftalten"; nach Angabe von L.
R. Fiechter.
528