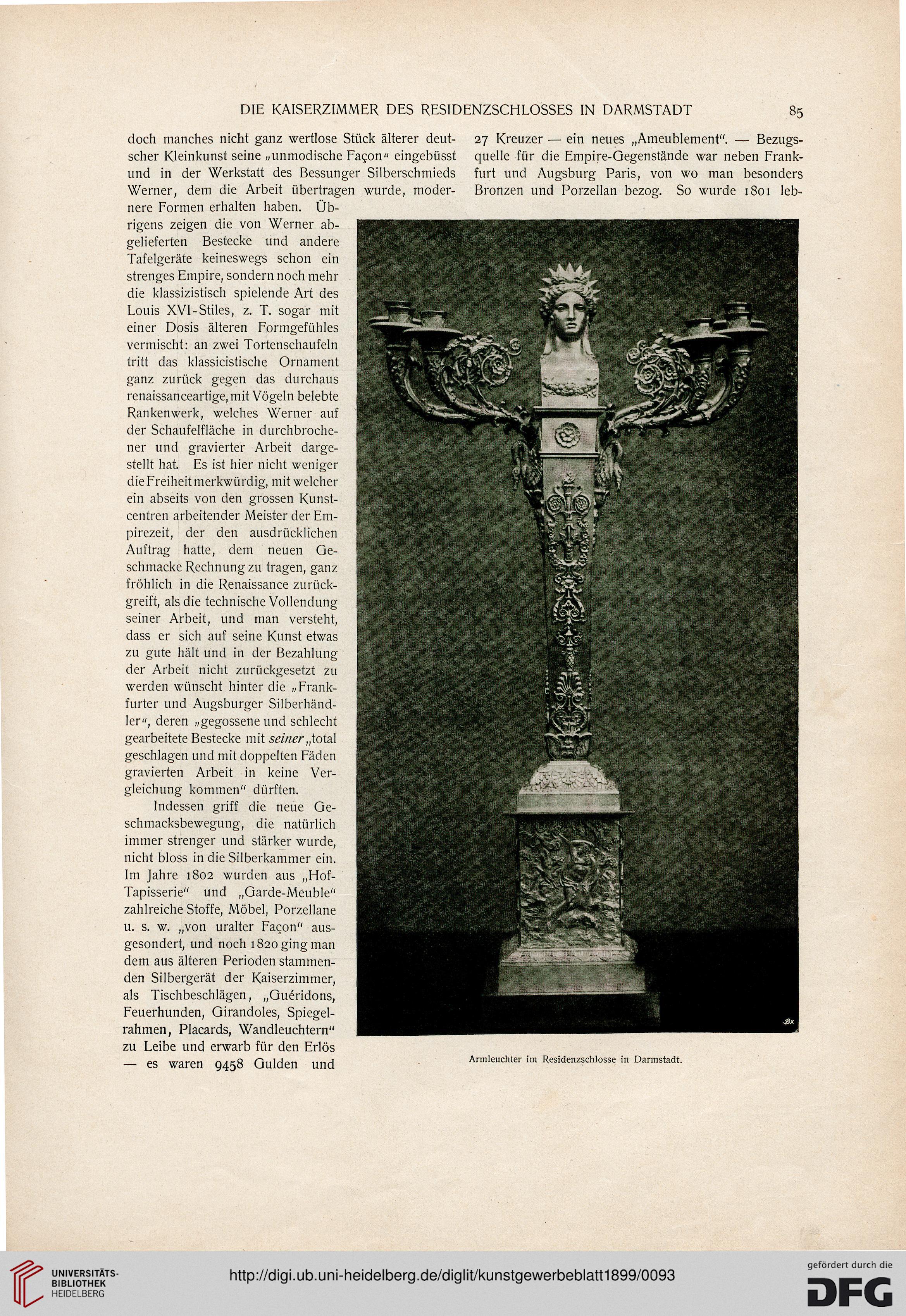DIE KAISERZIMMER DES RESIDENZSCHLOSSES IN DARMSTADT
85
doch manches nicht ganz wertlose Stück älterer deut-
scher Kleinkunst seine „unmodische Faqon« eingebüsst
und in der Werkstatt des Bessunger Silberschmieds
Werner, dem die Arbeit übertragen wurde, moder-
nere Formen erhalten haben. Üb-
rigens zeigen die von Werner ab-
gelieferten Bestecke und andere
Tafelgeräte keineswegs schon ein
strenges Empire, sondern noch mehr
die klassizistisch spielende Art des
Louis XVI-Stiles, z. T. sogar mit
einer Dosis älteren Formgefühles
vermischt: an zwei Tortenschaufeln
tritt das klassicistische Ornament
ganz zurück gegen das durchaus
renaissanceartige, mit Vögeln belebte
Rankenwerk, welches Werner auf
der Schaufelfläche in durchbroche-
ner und gravierter Arbeit darge-
stellt hat. Es ist hier nicht weniger
die Freiheit merkwürdig, mit welcher
ein abseits von den grossen Kunst-
centren arbeitender Meister der Em-
pirezeit, der den ausdrücklichen
Auftrag hatte, dem neuen Ge-
schmacke Rechnung zu tragen, ganz
fröhlich in die Renaissance zurück-
greift, als die technische Vollendung
seiner Arbeit, und man versteht,
dass er sich auf seine Kunst etwas
zu gute hält und in der Bezahlung
der Arbeit nicht zurückgesetzt zu
werden wünscht hinter die „Frank-
furter und Augsburger Silberhänd-
ler", deren „gegossene und schlecht
gearbeitete Bestecke mit seiner „total
geschlagen und mit doppelten Fäden
gravierten Arbeit in keine Ver-
gleichung kommen" dürften.
Indessen griff die neue Ge-
schmacksbewegung, die natürlich
immer strenger und stärker wurde,
nicht bloss in die Silberkammer ein.
Im Jahre 1802 wurden aus „Hof-
Tapisserie" und „Garde-Meuble"
zahlreiche Stoffe, Möbel, Porzellane
u. s. w. „von uralter Faqon" aus-
gesondert, und noch 1820 ging man
dem aus älteren Perioden stammen-
den Silbergerät der Kaiserzimmer,
als Tischbeschlägen, „Gueridons,
Feuerhunden, Girandoles, Spiegel-
rahmen, Piacards, Wandleuchtern"
zu Leibe und erwarb für den Erlös
— es waren 9458 Gulden und
27 Kreuzer — ein neues „Ameublement". — Bezugs-
quelle für die Empire-Gegenstände war neben Frank-
furt und Augsburg Paris, von wo man besonders
Bronzen und Porzellan bezog. So wurde 1801 leb-
Armleuchter im Residenzschlosse in Darmstadt.
85
doch manches nicht ganz wertlose Stück älterer deut-
scher Kleinkunst seine „unmodische Faqon« eingebüsst
und in der Werkstatt des Bessunger Silberschmieds
Werner, dem die Arbeit übertragen wurde, moder-
nere Formen erhalten haben. Üb-
rigens zeigen die von Werner ab-
gelieferten Bestecke und andere
Tafelgeräte keineswegs schon ein
strenges Empire, sondern noch mehr
die klassizistisch spielende Art des
Louis XVI-Stiles, z. T. sogar mit
einer Dosis älteren Formgefühles
vermischt: an zwei Tortenschaufeln
tritt das klassicistische Ornament
ganz zurück gegen das durchaus
renaissanceartige, mit Vögeln belebte
Rankenwerk, welches Werner auf
der Schaufelfläche in durchbroche-
ner und gravierter Arbeit darge-
stellt hat. Es ist hier nicht weniger
die Freiheit merkwürdig, mit welcher
ein abseits von den grossen Kunst-
centren arbeitender Meister der Em-
pirezeit, der den ausdrücklichen
Auftrag hatte, dem neuen Ge-
schmacke Rechnung zu tragen, ganz
fröhlich in die Renaissance zurück-
greift, als die technische Vollendung
seiner Arbeit, und man versteht,
dass er sich auf seine Kunst etwas
zu gute hält und in der Bezahlung
der Arbeit nicht zurückgesetzt zu
werden wünscht hinter die „Frank-
furter und Augsburger Silberhänd-
ler", deren „gegossene und schlecht
gearbeitete Bestecke mit seiner „total
geschlagen und mit doppelten Fäden
gravierten Arbeit in keine Ver-
gleichung kommen" dürften.
Indessen griff die neue Ge-
schmacksbewegung, die natürlich
immer strenger und stärker wurde,
nicht bloss in die Silberkammer ein.
Im Jahre 1802 wurden aus „Hof-
Tapisserie" und „Garde-Meuble"
zahlreiche Stoffe, Möbel, Porzellane
u. s. w. „von uralter Faqon" aus-
gesondert, und noch 1820 ging man
dem aus älteren Perioden stammen-
den Silbergerät der Kaiserzimmer,
als Tischbeschlägen, „Gueridons,
Feuerhunden, Girandoles, Spiegel-
rahmen, Piacards, Wandleuchtern"
zu Leibe und erwarb für den Erlös
— es waren 9458 Gulden und
27 Kreuzer — ein neues „Ameublement". — Bezugs-
quelle für die Empire-Gegenstände war neben Frank-
furt und Augsburg Paris, von wo man besonders
Bronzen und Porzellan bezog. So wurde 1801 leb-
Armleuchter im Residenzschlosse in Darmstadt.