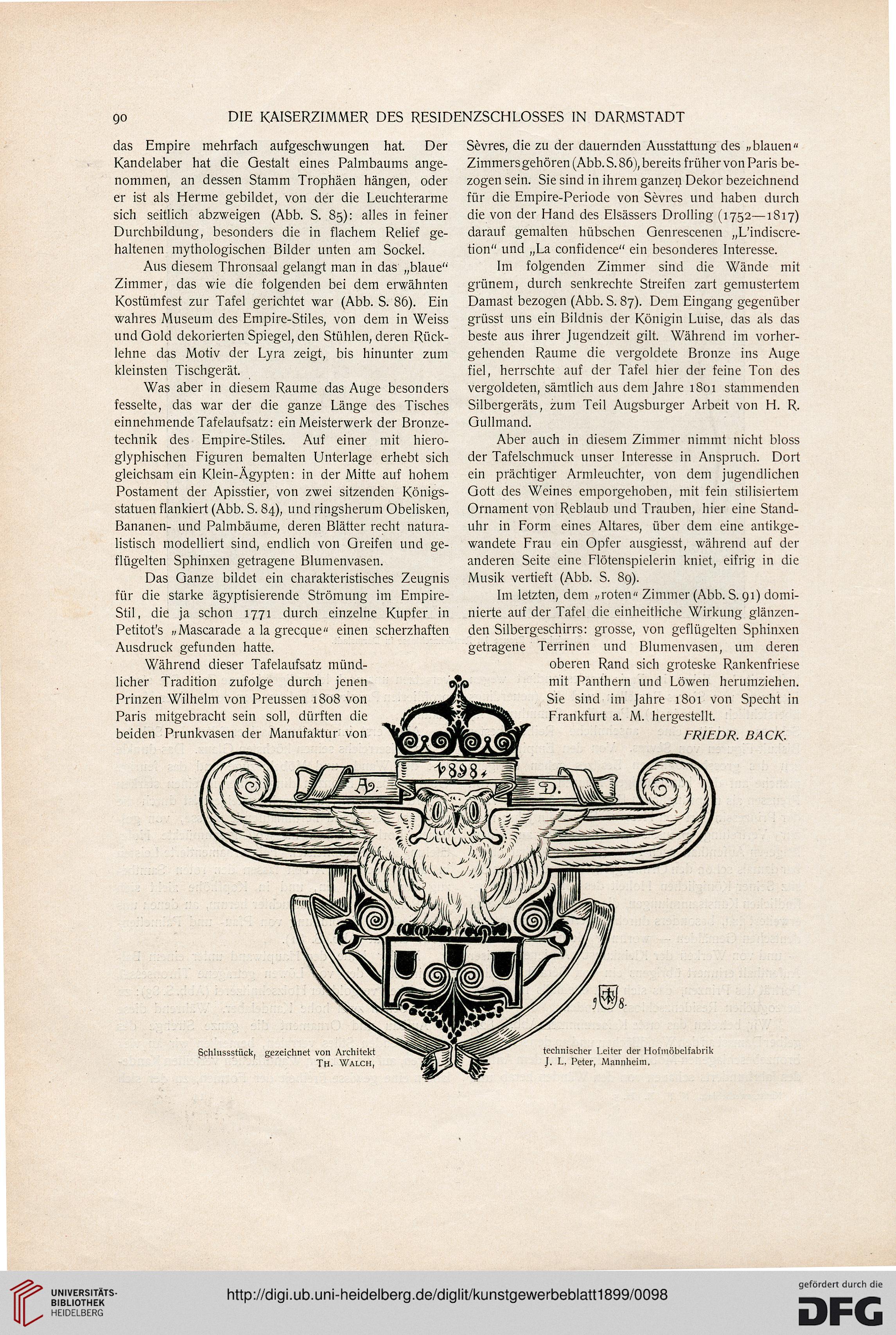go
DIE KAISERZIMMER DES RESIDENZSCHLOSSES IN DARMSTADT
das Empire mehrfach aufgeschwungen hat. Der
Kandelaber hat die Gestalt eines Palmbaums ange-
nommen, an dessen Stamm Trophäen hängen, oder
er ist als Herme gebildet, von der die Leuchterarme
sich seitlich abzweigen (Abb. S. 85): alles in feiner
Durchbildung, besonders die in flachem Relief ge-
haltenen mythologischen Bilder unten am Sockel.
Aus diesem Thronsaal gelangt man in das „blaue"
Zimmer, das wie die folgenden bei dem erwähnten
Kostümfest zur Tafel gerichtet war (Abb. S. 86). Ein
wahres Museum des Empire-Stiles, von dem in Weiss
und Gold dekorierten Spiegel, den Stühlen, deren Rück-
lehne das Motiv der Lyra zeigt, bis hinunter zum
kleinsten Tischgerät.
Was aber in diesem Räume das Auge besonders
fesselte, das war der die ganze Länge des Tisches
einnehmende Tafelaufsatz: ein Meisterwerk der Bronze-
technik des Empire-Stiles. Auf einer mit hiero-
glyphischen Figuren bemalten Unterlage erhebt sich
gleichsam ein Klein-Ägypten: in der Mitte auf hohem
Postament der Apisstier, von zwei sitzenden Königs-
statuen flankiert (Abb. S. 84), und ringsherum Obelisken,
Bananen- und Palmbäume, deren Blätter recht natura-
listisch modelliert sind, endlich von Greifen und ge-
flügelten Sphinxen getragene Blumenvasen.
Das Ganze bildet ein charakteristisches Zeugnis
für die starke ägyptisierende Strömung im Empire-
Stil, die ja schon 1771 durch einzelne Kupfer in
Petitot's »Mascarade a la grecque" einen scherzhaften
Ausdruck gefunden hatte.
Während dieser Tafelaufsatz münd-
licher Tradition zufolge durch jenen
Prinzen Wilhelm von Preussen 1808 von
Paris mitgebracht sein soll, dürften die
beiden Prunkvasen der Manufaktur von
Sevres, die zu der dauernden Ausstattung des „blauen"
Zimmers gehören (Abb. S. 86), bereits früher von Paris be-
zogen sein. Sie sind in ihrem ganzen Dekor bezeichnend
für die Empire-Periode von Sevres und haben durch
die von der Hand des Elsässers Drolling (1752—1817)
darauf gemalten hübschen Genrescenen „L'indiscre-
tion" und „La confidence" ein besonderes Interesse.
Im folgenden Zimmer sind die Wände mit
grünem, durch senkrechte Streifen zart gemustertem
Damast bezogen (Abb. S. 87). Dem Eingang gegenüber
grüsst uns ein Bildnis der Königin Luise, das als das
beste aus ihrer Jugendzeit gilt. Während im vorher-
gehenden Räume die vergoldete Bronze ins Auge
fiel, herrschte auf der Tafel hier der feine Ton des
vergoldeten, sämtlich aus dem Jahre 1801 stammenden
Silbergeräts, zum Teil Augsburger Arbeit von H. R.
Gullmand.
Aber auch in diesem Zimmer nimmt nicht bloss
der Tafelschmuck unser Interesse in Anspruch. Dort
ein prächtiger Armleuchter, von dem jugendlichen
Gott des Weines emporgehoben, mit fein stilisiertem
Ornament von Reblaub und Trauben, hier eine Stand-
uhr in Form eines Altares, über dem eine antikge-
wandete Frau ein Opfer ausgiesst, während auf der
anderen Seite eine Flötenspielerin kniet, eifrig in die
Musik vertieft (Abb. S. 89).
Im letzten, dem „roten" Zimmer (Abb. S. 91) domi-
nierte auf der Tafel die einheitliche Wirkung glänzen-
den Silbergeschirrs: grosse, von geflügelten Sphinxen
getragene Terrinen und Blumenvasen, um deren
oberen Rand sich groteske Rankenfriese
mit Panthern und Löwen herumziehen.
Sie sind im Jahre 1801 von Specht in
Frankfurt a. M. hergestellt.
FRIEDR. BACK.
Schhissstück, gezeichnet von Architekt
Th. Walch,
technischer Leiter der Hotmöbelfabrik
J. L. Peter, Mannheim.
DIE KAISERZIMMER DES RESIDENZSCHLOSSES IN DARMSTADT
das Empire mehrfach aufgeschwungen hat. Der
Kandelaber hat die Gestalt eines Palmbaums ange-
nommen, an dessen Stamm Trophäen hängen, oder
er ist als Herme gebildet, von der die Leuchterarme
sich seitlich abzweigen (Abb. S. 85): alles in feiner
Durchbildung, besonders die in flachem Relief ge-
haltenen mythologischen Bilder unten am Sockel.
Aus diesem Thronsaal gelangt man in das „blaue"
Zimmer, das wie die folgenden bei dem erwähnten
Kostümfest zur Tafel gerichtet war (Abb. S. 86). Ein
wahres Museum des Empire-Stiles, von dem in Weiss
und Gold dekorierten Spiegel, den Stühlen, deren Rück-
lehne das Motiv der Lyra zeigt, bis hinunter zum
kleinsten Tischgerät.
Was aber in diesem Räume das Auge besonders
fesselte, das war der die ganze Länge des Tisches
einnehmende Tafelaufsatz: ein Meisterwerk der Bronze-
technik des Empire-Stiles. Auf einer mit hiero-
glyphischen Figuren bemalten Unterlage erhebt sich
gleichsam ein Klein-Ägypten: in der Mitte auf hohem
Postament der Apisstier, von zwei sitzenden Königs-
statuen flankiert (Abb. S. 84), und ringsherum Obelisken,
Bananen- und Palmbäume, deren Blätter recht natura-
listisch modelliert sind, endlich von Greifen und ge-
flügelten Sphinxen getragene Blumenvasen.
Das Ganze bildet ein charakteristisches Zeugnis
für die starke ägyptisierende Strömung im Empire-
Stil, die ja schon 1771 durch einzelne Kupfer in
Petitot's »Mascarade a la grecque" einen scherzhaften
Ausdruck gefunden hatte.
Während dieser Tafelaufsatz münd-
licher Tradition zufolge durch jenen
Prinzen Wilhelm von Preussen 1808 von
Paris mitgebracht sein soll, dürften die
beiden Prunkvasen der Manufaktur von
Sevres, die zu der dauernden Ausstattung des „blauen"
Zimmers gehören (Abb. S. 86), bereits früher von Paris be-
zogen sein. Sie sind in ihrem ganzen Dekor bezeichnend
für die Empire-Periode von Sevres und haben durch
die von der Hand des Elsässers Drolling (1752—1817)
darauf gemalten hübschen Genrescenen „L'indiscre-
tion" und „La confidence" ein besonderes Interesse.
Im folgenden Zimmer sind die Wände mit
grünem, durch senkrechte Streifen zart gemustertem
Damast bezogen (Abb. S. 87). Dem Eingang gegenüber
grüsst uns ein Bildnis der Königin Luise, das als das
beste aus ihrer Jugendzeit gilt. Während im vorher-
gehenden Räume die vergoldete Bronze ins Auge
fiel, herrschte auf der Tafel hier der feine Ton des
vergoldeten, sämtlich aus dem Jahre 1801 stammenden
Silbergeräts, zum Teil Augsburger Arbeit von H. R.
Gullmand.
Aber auch in diesem Zimmer nimmt nicht bloss
der Tafelschmuck unser Interesse in Anspruch. Dort
ein prächtiger Armleuchter, von dem jugendlichen
Gott des Weines emporgehoben, mit fein stilisiertem
Ornament von Reblaub und Trauben, hier eine Stand-
uhr in Form eines Altares, über dem eine antikge-
wandete Frau ein Opfer ausgiesst, während auf der
anderen Seite eine Flötenspielerin kniet, eifrig in die
Musik vertieft (Abb. S. 89).
Im letzten, dem „roten" Zimmer (Abb. S. 91) domi-
nierte auf der Tafel die einheitliche Wirkung glänzen-
den Silbergeschirrs: grosse, von geflügelten Sphinxen
getragene Terrinen und Blumenvasen, um deren
oberen Rand sich groteske Rankenfriese
mit Panthern und Löwen herumziehen.
Sie sind im Jahre 1801 von Specht in
Frankfurt a. M. hergestellt.
FRIEDR. BACK.
Schhissstück, gezeichnet von Architekt
Th. Walch,
technischer Leiter der Hotmöbelfabrik
J. L. Peter, Mannheim.