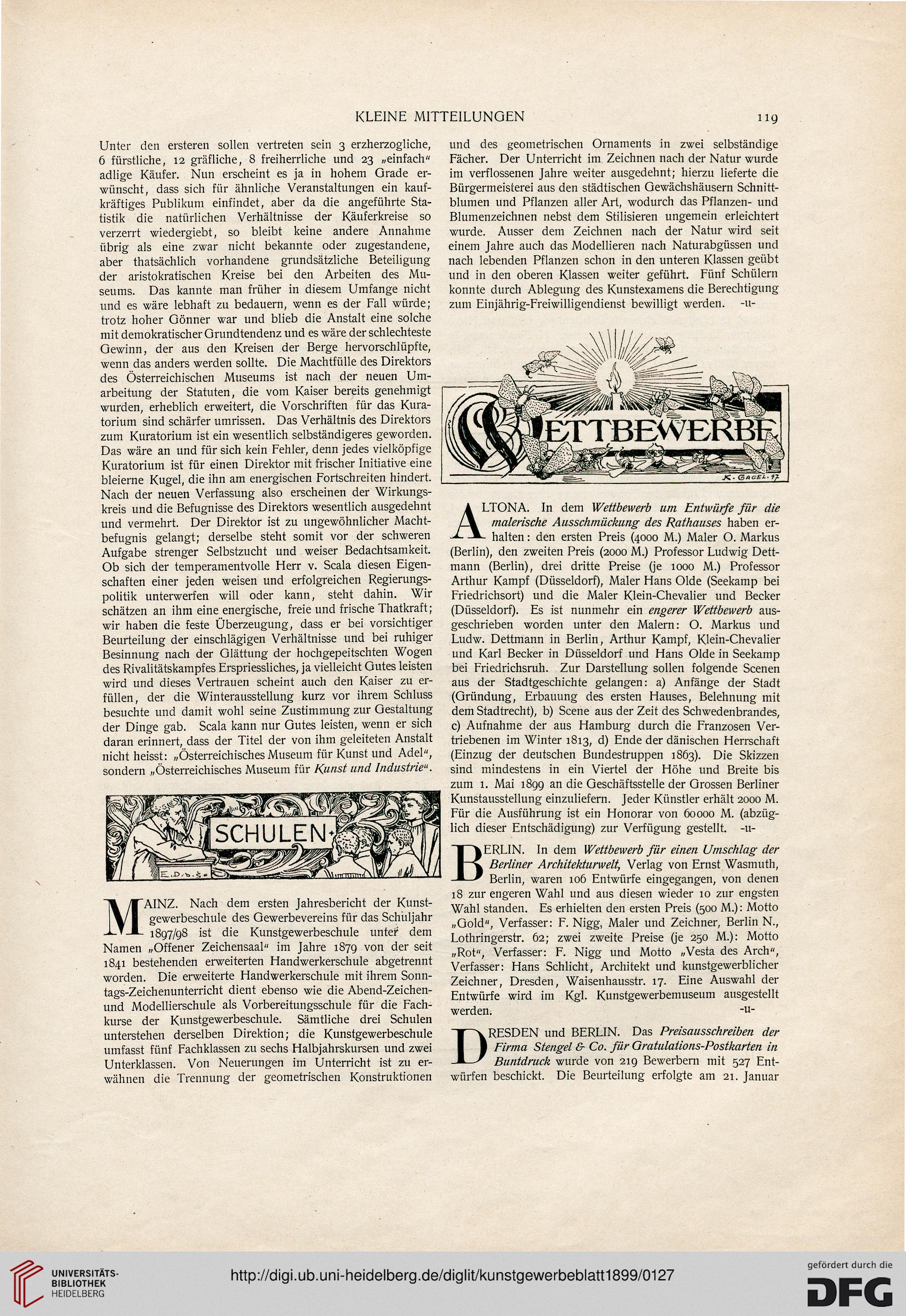KLEINE MITTEILUNGEN
119
Unter den ersteren sollen vertreten sein 3 erzherzogliche,
6 fürstliche, 12 gräfliche, 8 freiherrliche und 23 „einfach"
adlige Käufer. Nun erscheint es ja in hohem Grade er-
wünscht, dass sich für ähnliche Veranstaltungen ein kauf-
kräftiges Publikum einfindet, aber da die angeführte Sta-
tistik die natürlichen Verhältnisse der Käuferkreise so
verzerrt wiedergiebt, so bleibt keine andere Annahme
übrig als eine zwar nicht bekannte oder zugestandene,
aber thatsächlich vorhandene grundsätzliche Beteiligung
der aristokratischen Kreise bei den Arbeiten des Mu-
seums. Das kannte man früher in diesem Umfange nicht
und es wäre lebhaft zu bedauern, wenn es der Fall würde;
trotz hoher Gönner war und blieb die Anstalt eine solche
mit demokratischer Grundtendenz und es wäre der schlechteste
Gewinn, der aus den Kreisen der Berge hervorschlüpfte,
wenn das anders werden sollte. Die Machtfülle des Direktors
des Österreichischen Museums ist nach der neuen Um-
arbeitung der Statuten, die vom Kaiser bereits genehmigt
wurden, erheblich erweitert, die Vorschriften für das Kura-
torium sind schärfer umrissen. Das Verhältnis des Direktors
zum Kuratorium ist ein wesentlich selbständigeres geworden.
Das wäre an und für sich kein Fehler, denn jedes vielköpfige
Kuratorium ist für einen Direktor mit frischer Initiative eine
bleierne Kugel, die ihn am energischen Fortschreiten hindert.
Nach der neuen Verfassung also erscheinen der Wirkungs-
kreis und die Befugnisse des Direktors wesentlich ausgedehnt
und vermehrt. Der Direktor ist zu ungewöhnlicher Macht-
befugnis gelangt; derselbe steht somit vor der schweren
Aufgabe strenger Selbstzucht und weiser Bedachtsamkeit.
Ob sich der temperamentvolle Herr v. Scala diesen Eigen-
schaften einer jeden weisen und erfolgreichen Regierungs-
politik unterwerfen will oder kann, steht dahin. Wir
schätzen an ihm eine energische, freie und frische Thatkraft;
wir haben die feste Überzeugung, dass er bei vorsichtiger
Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse und bei ruhiger
Besinnung nach der Glättung der hochgepeitschten Wogen
des Rivalitätskampfes Erspriessliches, ja vielleicht Gutes leisten
wird und dieses Vertrauen scheint auch den Kaiser zu er-
füllen, der die Winterausstellung kurz vor ihrem Schluss
besuchte und damit wohl seine Zustimmung zur Gestaltung
der Dinge gab. Scala kann nur Gutes leisten, wenn er sich
daran erinnert, dass der Titel der von ihm geleiteten Anstalt
nicht heisst: „ÖsterreichischesMuseum für Kunst und Adel",
sondern „Österreichisches Museum für Kunst und Industrie".
~Ä /I~AINZ. Nach dem ersten Jahresbericht der Kunst-
\\/t gewerbeschule des Gewerbevereins für das Schuljahr
-i-T-1- 1897/98 ist die Kunstgewerbeschule unter dem
Namen „Offener Zeichensaal" im Jahre 1879 von der seit
1841 bestehenden erweiterten Handwerkerschule abgetrennt
worden. Die erweiterte Handwerkerschule mit ihrem Sonn-
tags-Zeichenunterricht dient ebenso wie die Abend-Zeichen-
und Modellierschule als Vorbereitungsschule für die Fach-
kurse der Kunstgewerbeschule. Sämtliche drei Schulen
unterstehen derselben Direktion; die Kunstgewerbeschule
umfasst fünf Fachklassen zu sechs Halbjahrskursen und zwei
Unterklassen. Von Neuerungen im Unterricht ist zu er-
wähnen die Trennung der geometrischen Konstruktionen
und des geometrischen Ornaments in zwei selbständige
Fächer. Der Unterricht im Zeichnen nach der Natur wurde
im verflossenen Jahre weiter ausgedehnt; hierzu lieferte die
Bürgermeisterei aus den städtischen Gewächshäusern Schnitt-
blumen und Pflanzen aller Art, wodurch das Pflanzen- und
Blumenzeichnen nebst dem Stilisieren ungemein erleichtert
wurde. Ausser dem Zeichnen nach der Natur wird seit
einem Jahre auch das Modellieren nach Naturabgüssen und
nach lebenden Pflanzen schon in den unteren Klassen geübt
und in den oberen Klassen weiter geführt. Fünf Schülern
konnte durch Ablegung des Kunstexamens die Berechtigung
zum Einjährig-Freiwilligendienst bewilligt werden, -u-
ALTONA. In dem Wettbewerb um Entwürfe für die
malerische Ausschmückung des Rathauses haben er-
- halten: den ersten Preis (4000 M.) Maler O. Markus
(Berlin), den zweiten Preis (2000 M.) Professor Ludwig Dett-
mann (Berlin), drei dritte Preise (je 1000 M.) Professor
Arthur Kampf (Düsseldorf), Maler Hans Olde (Seekamp bei
Friedrichsort) und die Maler Klein-Chevalier und Becker
(Düsseldorf). Es ist nunmehr ein engerer Wettbewerb aus-
geschrieben worden unter den Malern: O. Markus und
Ludw. Dettmann in Berlin, Arthur Kampf, Klein-Chevalier
und Karl Becker in Düsseldorf und Hans Olde in Seekamp
bei Friedrichsruh. Zur Darstellung sollen folgende Scenen
aus der Stadtgeschichte gelangen: a) Anfänge der Stadt
(Gründung, Erbauung des ersten Hauses, Belehnung mit
dem Stadtrecht), b) Scene aus der Zeit des Schwedenbrandes,
c) Aufnahme der aus Hamburg durch die Franzosen Ver-
triebenen im Winter 1813, d) Ende der dänischen Herrschaft
(Einzug der deutschen Bundestruppen 1863). Die Skizzen
sind mindestens in ein Viertel der Höhe und Breite bis
zum 1. Mai 1899 an die Geschäftsstelle der Grossen Berliner
Kunstausstellung einzuliefern. Jeder Künstler erhält 2000 M.
Für die Ausführung ist ein Honorar von 60000 M. (abzüg-
lich dieser Entschädigung) zur Verfügung gestellt, -u-
BERLIN. In dem Wettbewerb für einen Umschlag der
Berliner Architekturwelt, Verlag von Ernst Wasmuth,
Berlin, waren 106 Entwürfe eingegangen, von denen
18 zur engeren Wahl und aus diesen wieder 10 zur engsten
Wahl standen. Es erhielten den ersten Preis (500 M.): Motto
„Gold", Verfasser: F. Nigg, Maler und Zeichner, Berlin N.,
Lothringerstr. 62; zwei zweite Preise (je 250 M.): Motto
„Rot", Verfasser: F. Nigg und Motto „Vesta des Arch",
Verfasser: Hans Schlicht, Architekt und kunstgewerblicher
Zeichner, Dresden, Waisenhausstr. 17. Eine Auswahl der
Entwürfe wird im Kgl- Kunstgewerbemuseum ausgestellt
werden. -u-
DRESDEN und BERLIN. Das Preisausschreiben der
Firma Stengel & Co. für Gratulations-Postkarten in
Buntdruck wurde von 219 Bewerbern mit 527 Ent-
würfen beschickt. Die Beurteilung erfolgte am 21. Januar
119
Unter den ersteren sollen vertreten sein 3 erzherzogliche,
6 fürstliche, 12 gräfliche, 8 freiherrliche und 23 „einfach"
adlige Käufer. Nun erscheint es ja in hohem Grade er-
wünscht, dass sich für ähnliche Veranstaltungen ein kauf-
kräftiges Publikum einfindet, aber da die angeführte Sta-
tistik die natürlichen Verhältnisse der Käuferkreise so
verzerrt wiedergiebt, so bleibt keine andere Annahme
übrig als eine zwar nicht bekannte oder zugestandene,
aber thatsächlich vorhandene grundsätzliche Beteiligung
der aristokratischen Kreise bei den Arbeiten des Mu-
seums. Das kannte man früher in diesem Umfange nicht
und es wäre lebhaft zu bedauern, wenn es der Fall würde;
trotz hoher Gönner war und blieb die Anstalt eine solche
mit demokratischer Grundtendenz und es wäre der schlechteste
Gewinn, der aus den Kreisen der Berge hervorschlüpfte,
wenn das anders werden sollte. Die Machtfülle des Direktors
des Österreichischen Museums ist nach der neuen Um-
arbeitung der Statuten, die vom Kaiser bereits genehmigt
wurden, erheblich erweitert, die Vorschriften für das Kura-
torium sind schärfer umrissen. Das Verhältnis des Direktors
zum Kuratorium ist ein wesentlich selbständigeres geworden.
Das wäre an und für sich kein Fehler, denn jedes vielköpfige
Kuratorium ist für einen Direktor mit frischer Initiative eine
bleierne Kugel, die ihn am energischen Fortschreiten hindert.
Nach der neuen Verfassung also erscheinen der Wirkungs-
kreis und die Befugnisse des Direktors wesentlich ausgedehnt
und vermehrt. Der Direktor ist zu ungewöhnlicher Macht-
befugnis gelangt; derselbe steht somit vor der schweren
Aufgabe strenger Selbstzucht und weiser Bedachtsamkeit.
Ob sich der temperamentvolle Herr v. Scala diesen Eigen-
schaften einer jeden weisen und erfolgreichen Regierungs-
politik unterwerfen will oder kann, steht dahin. Wir
schätzen an ihm eine energische, freie und frische Thatkraft;
wir haben die feste Überzeugung, dass er bei vorsichtiger
Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse und bei ruhiger
Besinnung nach der Glättung der hochgepeitschten Wogen
des Rivalitätskampfes Erspriessliches, ja vielleicht Gutes leisten
wird und dieses Vertrauen scheint auch den Kaiser zu er-
füllen, der die Winterausstellung kurz vor ihrem Schluss
besuchte und damit wohl seine Zustimmung zur Gestaltung
der Dinge gab. Scala kann nur Gutes leisten, wenn er sich
daran erinnert, dass der Titel der von ihm geleiteten Anstalt
nicht heisst: „ÖsterreichischesMuseum für Kunst und Adel",
sondern „Österreichisches Museum für Kunst und Industrie".
~Ä /I~AINZ. Nach dem ersten Jahresbericht der Kunst-
\\/t gewerbeschule des Gewerbevereins für das Schuljahr
-i-T-1- 1897/98 ist die Kunstgewerbeschule unter dem
Namen „Offener Zeichensaal" im Jahre 1879 von der seit
1841 bestehenden erweiterten Handwerkerschule abgetrennt
worden. Die erweiterte Handwerkerschule mit ihrem Sonn-
tags-Zeichenunterricht dient ebenso wie die Abend-Zeichen-
und Modellierschule als Vorbereitungsschule für die Fach-
kurse der Kunstgewerbeschule. Sämtliche drei Schulen
unterstehen derselben Direktion; die Kunstgewerbeschule
umfasst fünf Fachklassen zu sechs Halbjahrskursen und zwei
Unterklassen. Von Neuerungen im Unterricht ist zu er-
wähnen die Trennung der geometrischen Konstruktionen
und des geometrischen Ornaments in zwei selbständige
Fächer. Der Unterricht im Zeichnen nach der Natur wurde
im verflossenen Jahre weiter ausgedehnt; hierzu lieferte die
Bürgermeisterei aus den städtischen Gewächshäusern Schnitt-
blumen und Pflanzen aller Art, wodurch das Pflanzen- und
Blumenzeichnen nebst dem Stilisieren ungemein erleichtert
wurde. Ausser dem Zeichnen nach der Natur wird seit
einem Jahre auch das Modellieren nach Naturabgüssen und
nach lebenden Pflanzen schon in den unteren Klassen geübt
und in den oberen Klassen weiter geführt. Fünf Schülern
konnte durch Ablegung des Kunstexamens die Berechtigung
zum Einjährig-Freiwilligendienst bewilligt werden, -u-
ALTONA. In dem Wettbewerb um Entwürfe für die
malerische Ausschmückung des Rathauses haben er-
- halten: den ersten Preis (4000 M.) Maler O. Markus
(Berlin), den zweiten Preis (2000 M.) Professor Ludwig Dett-
mann (Berlin), drei dritte Preise (je 1000 M.) Professor
Arthur Kampf (Düsseldorf), Maler Hans Olde (Seekamp bei
Friedrichsort) und die Maler Klein-Chevalier und Becker
(Düsseldorf). Es ist nunmehr ein engerer Wettbewerb aus-
geschrieben worden unter den Malern: O. Markus und
Ludw. Dettmann in Berlin, Arthur Kampf, Klein-Chevalier
und Karl Becker in Düsseldorf und Hans Olde in Seekamp
bei Friedrichsruh. Zur Darstellung sollen folgende Scenen
aus der Stadtgeschichte gelangen: a) Anfänge der Stadt
(Gründung, Erbauung des ersten Hauses, Belehnung mit
dem Stadtrecht), b) Scene aus der Zeit des Schwedenbrandes,
c) Aufnahme der aus Hamburg durch die Franzosen Ver-
triebenen im Winter 1813, d) Ende der dänischen Herrschaft
(Einzug der deutschen Bundestruppen 1863). Die Skizzen
sind mindestens in ein Viertel der Höhe und Breite bis
zum 1. Mai 1899 an die Geschäftsstelle der Grossen Berliner
Kunstausstellung einzuliefern. Jeder Künstler erhält 2000 M.
Für die Ausführung ist ein Honorar von 60000 M. (abzüg-
lich dieser Entschädigung) zur Verfügung gestellt, -u-
BERLIN. In dem Wettbewerb für einen Umschlag der
Berliner Architekturwelt, Verlag von Ernst Wasmuth,
Berlin, waren 106 Entwürfe eingegangen, von denen
18 zur engeren Wahl und aus diesen wieder 10 zur engsten
Wahl standen. Es erhielten den ersten Preis (500 M.): Motto
„Gold", Verfasser: F. Nigg, Maler und Zeichner, Berlin N.,
Lothringerstr. 62; zwei zweite Preise (je 250 M.): Motto
„Rot", Verfasser: F. Nigg und Motto „Vesta des Arch",
Verfasser: Hans Schlicht, Architekt und kunstgewerblicher
Zeichner, Dresden, Waisenhausstr. 17. Eine Auswahl der
Entwürfe wird im Kgl- Kunstgewerbemuseum ausgestellt
werden. -u-
DRESDEN und BERLIN. Das Preisausschreiben der
Firma Stengel & Co. für Gratulations-Postkarten in
Buntdruck wurde von 219 Bewerbern mit 527 Ent-
würfen beschickt. Die Beurteilung erfolgte am 21. Januar