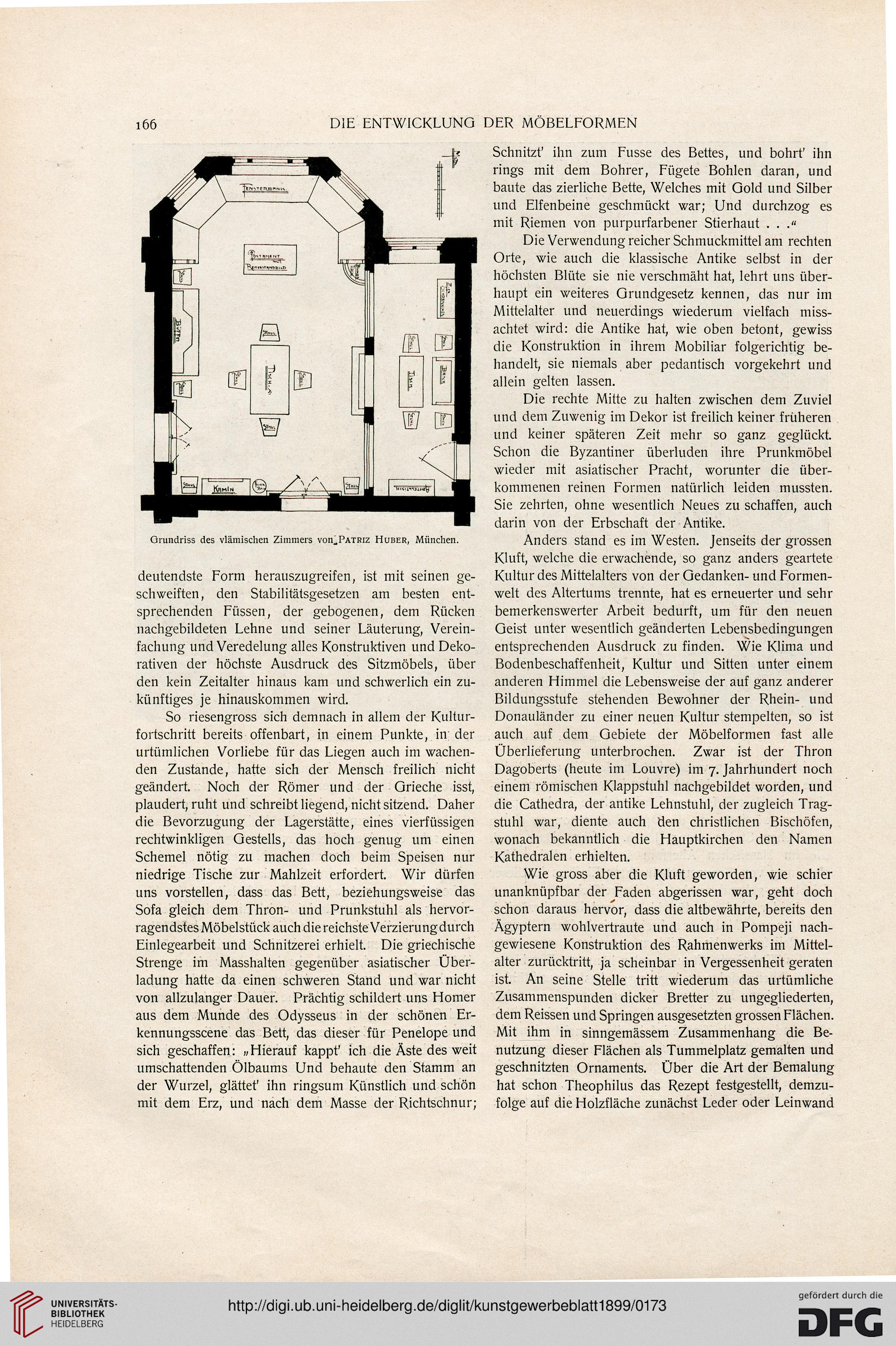i66
DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN
Grundriss des vlämischen Zimmers von„PATRiz Hubi:r, München.
deutendste Form herauszugreifen, ist mit seinen ge-
schweiften, den Stabilitätsgesetzen am besten ent-
sprechenden Füssen, der gebogenen, dem Rücken
nachgebildeten Lehne und seiner Läuterung, Verein-
fachung und Veredelung alles Konstruktiven und Deko-
rativen der höchste Ausdruck des Sitzmöbels, über
den kein Zeitalter hinaus kam und schwerlich ein zu-
künftiges je hinauskommen wird.
So riesengross sich demnach in allem der Kultur-
fortschritt bereits offenbart, in einem Punkte, in der
urtümlichen Vorliebe für das Liegen auch im wachen-
den Zustande, hatte sich der Mensch freilich nicht
geändert. Noch der Römer und der Grieche isst,
plaudert, ruht und schreibt liegend, nicht sitzend. Daher
die Bevorzugung der Lagerstätte, eines vierfüssigen
rechtwinkligen Gestells, das hoch genug um einen
Schemel nötig zu machen doch beim Speisen nur
niedrige Tische zur Mahlzeit erfordert. Wir dürfen
uns vorstellen, dass das Bett, beziehungsweise das
Sofa gleich dem Thron- und Prunkstuhl als hervor-
ragendstes Möbelstück auch die reichste Verzierungdurch
Einlegearbeit und Schnitzerei erhielt. Die griechische
Strenge im Masshalten gegenüber asiatischer Ober-
ladung hatte da einen schweren Stand und war nicht
von allzulanger Dauer. Prächtig schildert uns Homer
aus dem Munde des Odysseus in der schönen Er-
kennungsscene das Bett, das dieser für Penelope und
sich geschaffen: «Hierauf kappt' ich die Äste des weit
umschattenden Ölbaums Und behaute den Stamm an
der Wurzel, glättet' ihn ringsum Künstlich und schön
mit dem Erz, und nach dem Masse der Richtschnur;
Schnitzt' ihn zum Fusse des Bettes, und bohrt' ihn
rings mit dem Bohrer, Fügete Bohlen daran, und
baute das zierliche Bette, Welches mit Gold und Silber
und Elfenbeine geschmückt war; Und durchzog es
mit Riemen von purpurfarbener Stierhaut . . ."
Die Verwendung reicher Schmuckmittel am rechten
Orte, wie auch die klassische Antike selbst in der
höchsten Blüte sie nie verschmäht hat, lehrt uns über-
haupt ein weiteres Grundgesetz kennen, das nur im
Mittelalter und neuerdings wiederum vielfach miss-
achtet wird: die Antike hat, wie oben betont, gewiss
die Konstruktion in ihrem Mobiliar folgerichtig be-
handelt, sie niemals aber pedantisch vorgekehrt und
allein gelten lassen.
Die rechte Mitte zu halten zwischen dem Zuviel
und dem Zuwenig im Dekor ist freilich keiner früheren
und keiner späteren Zeit mehr so ganz geglückt.
Schon die Byzantiner überluden ihre Prunkmöbel
wieder mit asiatischer Pracht, worunter die über-
kommenen reinen Formen natürlich leiden mussten.
Sie zehrten, ohne wesentlich Neues zu schaffen, auch
darin von der Erbschaft der Antike.
Anders stand es im Westen. Jenseits der grossen
Kluft, welche die erwachende, so ganz anders geartete
Kultur des Mittelalters von der Gedanken- und Formen-
welt des Altertums trennte, hat es erneuerter und sehr
bemerkenswerter Arbeit bedurft, um für den neuen
Geist unter wesentlich geänderten Lebensbedingungen
entsprechenden Ausdruck zu finden. Wie Klima und
Bodenbeschaffenheit, Kultur und Sitten unter einem
anderen Himmel die Lebensweise der auf ganz anderer
Bildungsstufe stehenden Bewohner der Rhein- und
Donauländer zu einer neuen Kultur stempelten, so ist
auch auf dem Gebiete der Möbelformen fast alle
Überlieferung unterbrochen. Zwar ist der Thron
Dagoberts (heute im Louvre) im 7. Jahrhundert noch
einem römischen Klappstuhl nachgebildet worden, und
die Cathedra, der antike Lehnstuhl, der zugleich Trag-
stuhl war, diente auch den christlichen Bischöfen,
wonach bekanntlich die Hauptkirchen den Namen
Kathedralen erhielten.
Wie gross aber die Kluft geworden, wie schier
unanknüpfbar der Faden abgerissen war, geht doch
schon daraus hervor, dass die altbewährte, bereits den
Ägyptern wohlvertraute und auch in Pompeji nach-
gewiesene Konstruktion des Rahmenwerks im Mittel-
alter zurücktritt, ja scheinbar in Vergessenheit geraten
ist. An seine Stelle tritt wiederum das urtümliche
Zusammenspunden dicker Bretter zu ungegliederten,
dem Reissen und Springen ausgesetzten grossen Flächen.
Mit ihm in sinngemässem Zusammenhang die Be-
nutzung dieser Flächen als Tummelplatz gemalten und
geschnitzten Ornaments. Über die Art der Bemalung
hat schon Theophilus das Rezept festgestellt, demzu-
folge auf die Holzfläche zunächst Leder oder Leinwand
DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN
Grundriss des vlämischen Zimmers von„PATRiz Hubi:r, München.
deutendste Form herauszugreifen, ist mit seinen ge-
schweiften, den Stabilitätsgesetzen am besten ent-
sprechenden Füssen, der gebogenen, dem Rücken
nachgebildeten Lehne und seiner Läuterung, Verein-
fachung und Veredelung alles Konstruktiven und Deko-
rativen der höchste Ausdruck des Sitzmöbels, über
den kein Zeitalter hinaus kam und schwerlich ein zu-
künftiges je hinauskommen wird.
So riesengross sich demnach in allem der Kultur-
fortschritt bereits offenbart, in einem Punkte, in der
urtümlichen Vorliebe für das Liegen auch im wachen-
den Zustande, hatte sich der Mensch freilich nicht
geändert. Noch der Römer und der Grieche isst,
plaudert, ruht und schreibt liegend, nicht sitzend. Daher
die Bevorzugung der Lagerstätte, eines vierfüssigen
rechtwinkligen Gestells, das hoch genug um einen
Schemel nötig zu machen doch beim Speisen nur
niedrige Tische zur Mahlzeit erfordert. Wir dürfen
uns vorstellen, dass das Bett, beziehungsweise das
Sofa gleich dem Thron- und Prunkstuhl als hervor-
ragendstes Möbelstück auch die reichste Verzierungdurch
Einlegearbeit und Schnitzerei erhielt. Die griechische
Strenge im Masshalten gegenüber asiatischer Ober-
ladung hatte da einen schweren Stand und war nicht
von allzulanger Dauer. Prächtig schildert uns Homer
aus dem Munde des Odysseus in der schönen Er-
kennungsscene das Bett, das dieser für Penelope und
sich geschaffen: «Hierauf kappt' ich die Äste des weit
umschattenden Ölbaums Und behaute den Stamm an
der Wurzel, glättet' ihn ringsum Künstlich und schön
mit dem Erz, und nach dem Masse der Richtschnur;
Schnitzt' ihn zum Fusse des Bettes, und bohrt' ihn
rings mit dem Bohrer, Fügete Bohlen daran, und
baute das zierliche Bette, Welches mit Gold und Silber
und Elfenbeine geschmückt war; Und durchzog es
mit Riemen von purpurfarbener Stierhaut . . ."
Die Verwendung reicher Schmuckmittel am rechten
Orte, wie auch die klassische Antike selbst in der
höchsten Blüte sie nie verschmäht hat, lehrt uns über-
haupt ein weiteres Grundgesetz kennen, das nur im
Mittelalter und neuerdings wiederum vielfach miss-
achtet wird: die Antike hat, wie oben betont, gewiss
die Konstruktion in ihrem Mobiliar folgerichtig be-
handelt, sie niemals aber pedantisch vorgekehrt und
allein gelten lassen.
Die rechte Mitte zu halten zwischen dem Zuviel
und dem Zuwenig im Dekor ist freilich keiner früheren
und keiner späteren Zeit mehr so ganz geglückt.
Schon die Byzantiner überluden ihre Prunkmöbel
wieder mit asiatischer Pracht, worunter die über-
kommenen reinen Formen natürlich leiden mussten.
Sie zehrten, ohne wesentlich Neues zu schaffen, auch
darin von der Erbschaft der Antike.
Anders stand es im Westen. Jenseits der grossen
Kluft, welche die erwachende, so ganz anders geartete
Kultur des Mittelalters von der Gedanken- und Formen-
welt des Altertums trennte, hat es erneuerter und sehr
bemerkenswerter Arbeit bedurft, um für den neuen
Geist unter wesentlich geänderten Lebensbedingungen
entsprechenden Ausdruck zu finden. Wie Klima und
Bodenbeschaffenheit, Kultur und Sitten unter einem
anderen Himmel die Lebensweise der auf ganz anderer
Bildungsstufe stehenden Bewohner der Rhein- und
Donauländer zu einer neuen Kultur stempelten, so ist
auch auf dem Gebiete der Möbelformen fast alle
Überlieferung unterbrochen. Zwar ist der Thron
Dagoberts (heute im Louvre) im 7. Jahrhundert noch
einem römischen Klappstuhl nachgebildet worden, und
die Cathedra, der antike Lehnstuhl, der zugleich Trag-
stuhl war, diente auch den christlichen Bischöfen,
wonach bekanntlich die Hauptkirchen den Namen
Kathedralen erhielten.
Wie gross aber die Kluft geworden, wie schier
unanknüpfbar der Faden abgerissen war, geht doch
schon daraus hervor, dass die altbewährte, bereits den
Ägyptern wohlvertraute und auch in Pompeji nach-
gewiesene Konstruktion des Rahmenwerks im Mittel-
alter zurücktritt, ja scheinbar in Vergessenheit geraten
ist. An seine Stelle tritt wiederum das urtümliche
Zusammenspunden dicker Bretter zu ungegliederten,
dem Reissen und Springen ausgesetzten grossen Flächen.
Mit ihm in sinngemässem Zusammenhang die Be-
nutzung dieser Flächen als Tummelplatz gemalten und
geschnitzten Ornaments. Über die Art der Bemalung
hat schon Theophilus das Rezept festgestellt, demzu-
folge auf die Holzfläche zunächst Leder oder Leinwand