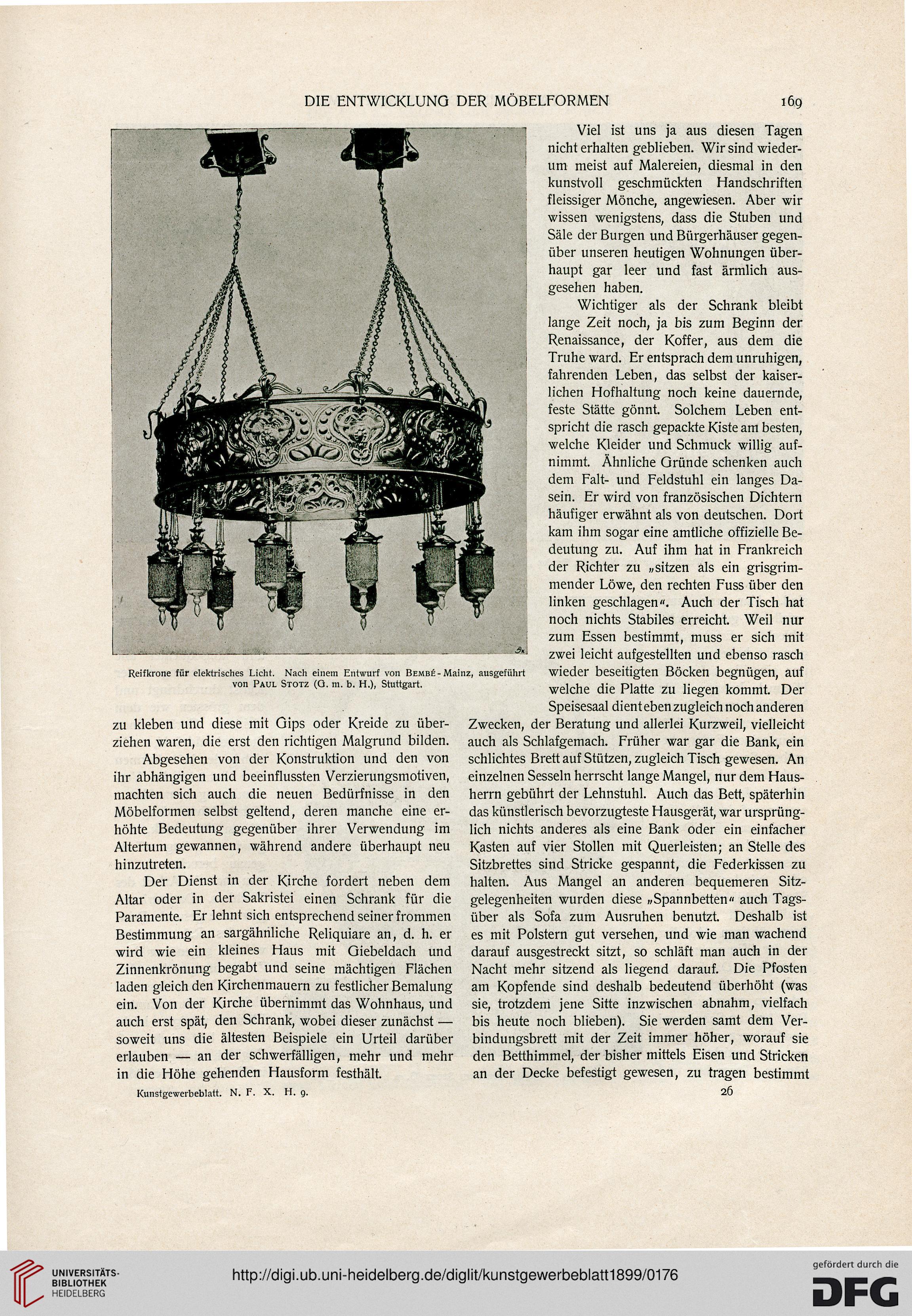DIE ENTWICKLUNG DER MÖBELFORMEN
169
Reifkrone für elektrisches Licht. Nach einem Entwurf von Bemb£- Mainz, ausgeführt
von Paul Stotz (Q. m. b. H.), Stuttgart.
zu kleben und diese mit Gips oder Kreide zu über-
ziehen waren, die erst den richtigen Malgrund bilden.
Abgesehen von der Konstruktion und den von
ihr abhängigen und beeinflussten Verzierungsmotiven,
machten sich auch die neuen Bedürfnisse in den
Möbelformen selbst geltend, deren manche eine er-
höhte Bedeutung gegenüber ihrer Verwendung im
Altertum gewannen, während andere überhaupt neu
hinzutreten.
Der Dienst in der Kirche fordert neben dem
Altar oder in der Sakristei einen Schrank für die
Paramente. Er lehnt sich entsprechend seiner frommen
Bestimmung an sargähnliche Reliquiare an, d. h. er
wird wie ein kleines Haus mit Giebeldach und
Zinnenkrönung begabt und seine mächtigen Flächen
laden gleich den Kirchenmauern zu festlicher Bemalung
ein. Von der Kirche übernimmt das Wohnhaus, und
auch erst spät, den Schrank, wobei dieser zunächst —
soweit uns die ältesten Beispiele ein Urteil darüber
erlauben — an der schwerfälligen, mehr und mehr
in die Höhe gehenden Hausform festhält.
Kunstgewerbeblatt. N. F. X. H. g.
Viel ist uns ja aus diesen Tagen
nicht erhalten geblieben. Wir sind wieder-
um meist auf Malereien, diesmal in den
kunstvoll geschmückten Handschriften
fleissiger Mönche, angewiesen. Aber wir
wissen wenigstens, dass die Stuben und
Säle der Burgen und Bürgerhäuser gegen-
über unseren heutigen Wohnungen über-
haupt gar leer und fast ärmlich aus-
gesehen haben.
Wichtiger als der Schrank bleibt
lange Zeit noch, ja bis zum Beginn der
Renaissance, der Koffer, aus dem die
Truhe ward. Er entsprach dem unruhigen,
fahrenden Leben, das selbst der kaiser-
lichen Hofhaltung noch keine dauernde,
feste Stätte gönnt. Solchem Leben ent-
spricht die rasch gepackte Kiste am besten,
welche Kleider und Schmuck willig auf-
nimmt. Ähnliche Gründe schenken auch
dem Falt- und Feldstuhl ein langes Da-
sein. Er wird von französischen Dichtern
häufiger erwähnt als von deutschen. Dort
kam ihm sogar eine amtliche offizielle Be-
deutung zu. Auf ihm hat in Frankreich
der Richter zu »sitzen als ein grisgrim-
mender Löwe, den rechten Fuss über den
linken geschlagen". Auch der Tisch hat
noch nichts Stabiles erreicht. Weil nur
zum Essen bestimmt, muss er sich mit
zwei leicht aufgestellten und ebenso rasch
wieder beseitigten Böcken begnügen, auf
welche die Platte zu liegen kommt. Der
Speisesaal dient eben zugleich noch anderen
Zwecken, der Beratung und allerlei Kurzweil, vielleicht
auch als Schlafgemach. Früher war gar die Bank, ein
schlichtes Brett auf Stützen, zugleich Tisch gewesen. An
einzelnen Sesseln herrscht lange Mangel, nur dem Haus-
herrn gebührt der Lehnstuhl. Auch das Bett, späterhin
das künstlerisch bevorzugteste Hausgerät, war ursprüng-
lich nichts anderes als eine Bank oder ein einfacher
Kasten auf vier Stollen mit Querleisten; an Stelle des
Sitzbrettes sind Stricke gespannt, die Federkissen zu
halten. Aus Mangel an anderen bequemeren Sitz-
gelegenheiten wurden diese «Spannbetten" auch Tags-
über als Sofa zum Ausruhen benutzt. Deshalb ist
es mit Polstern gut versehen, und wie man wachend
darauf ausgestreckt sitzt, so schläft man auch in der
Nacht mehr sitzend als liegend darauf. Die Pfosten
am Kopfende sind deshalb bedeutend überhöht (was
sie, trotzdem jene Sitte inzwischen abnahm, vielfach
bis heute noch blieben). Sie werden samt dem Ver-
bindungsbrett mit der Zeit immer höher, worauf sie
den Betthimmel, der bisher mittels Eisen und Stricken
an der Decke befestigt gewesen, zu tragen bestimmt
26
169
Reifkrone für elektrisches Licht. Nach einem Entwurf von Bemb£- Mainz, ausgeführt
von Paul Stotz (Q. m. b. H.), Stuttgart.
zu kleben und diese mit Gips oder Kreide zu über-
ziehen waren, die erst den richtigen Malgrund bilden.
Abgesehen von der Konstruktion und den von
ihr abhängigen und beeinflussten Verzierungsmotiven,
machten sich auch die neuen Bedürfnisse in den
Möbelformen selbst geltend, deren manche eine er-
höhte Bedeutung gegenüber ihrer Verwendung im
Altertum gewannen, während andere überhaupt neu
hinzutreten.
Der Dienst in der Kirche fordert neben dem
Altar oder in der Sakristei einen Schrank für die
Paramente. Er lehnt sich entsprechend seiner frommen
Bestimmung an sargähnliche Reliquiare an, d. h. er
wird wie ein kleines Haus mit Giebeldach und
Zinnenkrönung begabt und seine mächtigen Flächen
laden gleich den Kirchenmauern zu festlicher Bemalung
ein. Von der Kirche übernimmt das Wohnhaus, und
auch erst spät, den Schrank, wobei dieser zunächst —
soweit uns die ältesten Beispiele ein Urteil darüber
erlauben — an der schwerfälligen, mehr und mehr
in die Höhe gehenden Hausform festhält.
Kunstgewerbeblatt. N. F. X. H. g.
Viel ist uns ja aus diesen Tagen
nicht erhalten geblieben. Wir sind wieder-
um meist auf Malereien, diesmal in den
kunstvoll geschmückten Handschriften
fleissiger Mönche, angewiesen. Aber wir
wissen wenigstens, dass die Stuben und
Säle der Burgen und Bürgerhäuser gegen-
über unseren heutigen Wohnungen über-
haupt gar leer und fast ärmlich aus-
gesehen haben.
Wichtiger als der Schrank bleibt
lange Zeit noch, ja bis zum Beginn der
Renaissance, der Koffer, aus dem die
Truhe ward. Er entsprach dem unruhigen,
fahrenden Leben, das selbst der kaiser-
lichen Hofhaltung noch keine dauernde,
feste Stätte gönnt. Solchem Leben ent-
spricht die rasch gepackte Kiste am besten,
welche Kleider und Schmuck willig auf-
nimmt. Ähnliche Gründe schenken auch
dem Falt- und Feldstuhl ein langes Da-
sein. Er wird von französischen Dichtern
häufiger erwähnt als von deutschen. Dort
kam ihm sogar eine amtliche offizielle Be-
deutung zu. Auf ihm hat in Frankreich
der Richter zu »sitzen als ein grisgrim-
mender Löwe, den rechten Fuss über den
linken geschlagen". Auch der Tisch hat
noch nichts Stabiles erreicht. Weil nur
zum Essen bestimmt, muss er sich mit
zwei leicht aufgestellten und ebenso rasch
wieder beseitigten Böcken begnügen, auf
welche die Platte zu liegen kommt. Der
Speisesaal dient eben zugleich noch anderen
Zwecken, der Beratung und allerlei Kurzweil, vielleicht
auch als Schlafgemach. Früher war gar die Bank, ein
schlichtes Brett auf Stützen, zugleich Tisch gewesen. An
einzelnen Sesseln herrscht lange Mangel, nur dem Haus-
herrn gebührt der Lehnstuhl. Auch das Bett, späterhin
das künstlerisch bevorzugteste Hausgerät, war ursprüng-
lich nichts anderes als eine Bank oder ein einfacher
Kasten auf vier Stollen mit Querleisten; an Stelle des
Sitzbrettes sind Stricke gespannt, die Federkissen zu
halten. Aus Mangel an anderen bequemeren Sitz-
gelegenheiten wurden diese «Spannbetten" auch Tags-
über als Sofa zum Ausruhen benutzt. Deshalb ist
es mit Polstern gut versehen, und wie man wachend
darauf ausgestreckt sitzt, so schläft man auch in der
Nacht mehr sitzend als liegend darauf. Die Pfosten
am Kopfende sind deshalb bedeutend überhöht (was
sie, trotzdem jene Sitte inzwischen abnahm, vielfach
bis heute noch blieben). Sie werden samt dem Ver-
bindungsbrett mit der Zeit immer höher, worauf sie
den Betthimmel, der bisher mittels Eisen und Stricken
an der Decke befestigt gewesen, zu tragen bestimmt
26