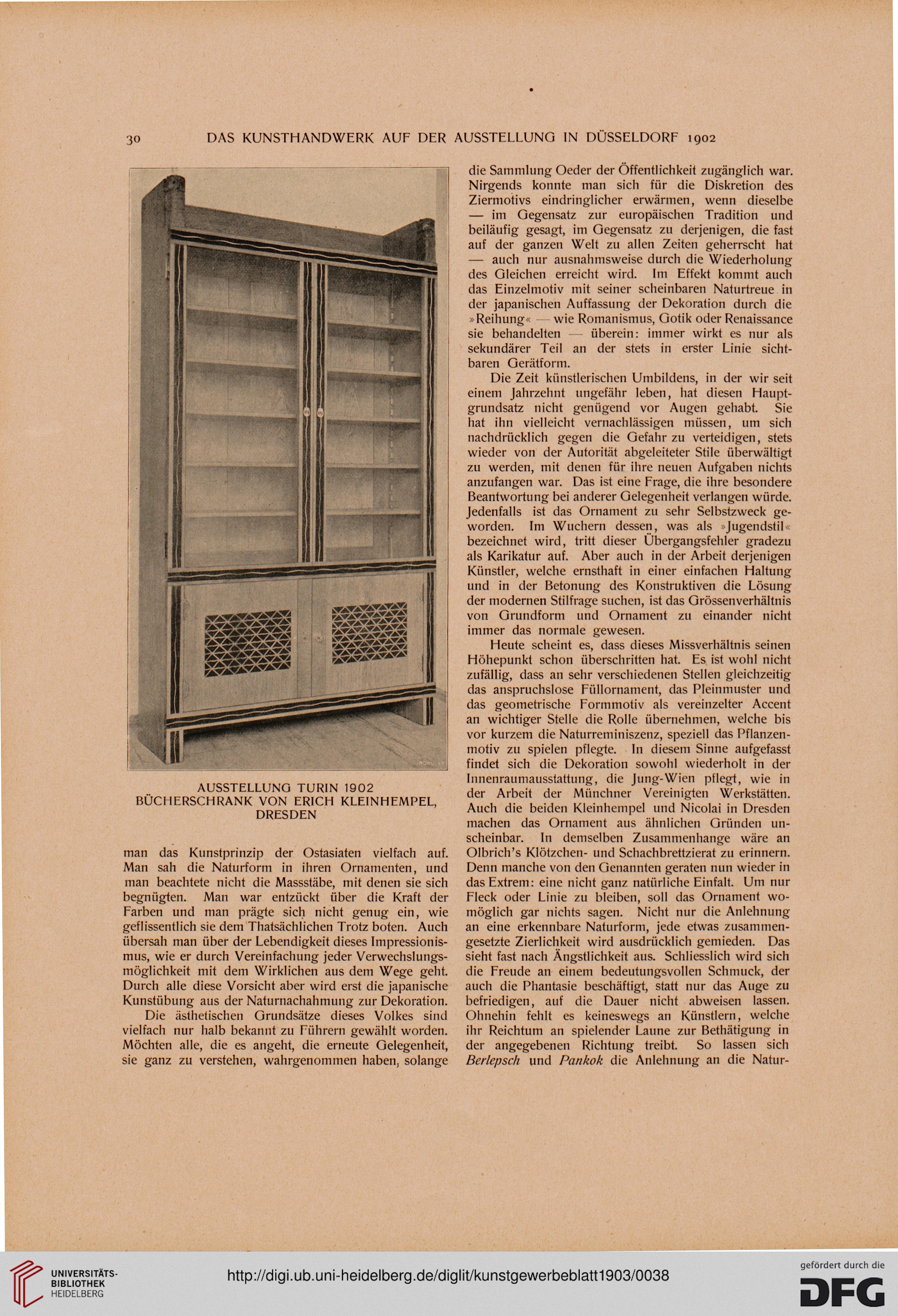30
DAS KUNSTHANDWERK AUF DER AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF 1902
mb
■■Boa
80
AUSSTELLUNG TURIN 1902
BÜCHERSCHRANK VON ERICH KLEINHEMPEL,
DRESDEN
man das Kunstprinzip der Ostasiaten vielfach auf.
Man sah die Naturform in ihren Ornamenten, und
man beachtete nicht die Massstäbe, mit denen sie sich
begnügten. Man war entzückt über die Kraft der
Farben und man prägte sich nicht genug ein, wie
geflissentlich sie dem Thatsächlichen Trotz boten. Auch
übersah man über der Lebendigkeit dieses Impressionis-
mus, wie er durch Vereinfachung jeder Verwechslungs-
möglichkeit mit dem Wirklichen aus dem Wege geht.
Durch alle diese Vorsicht aber wird erst die japanische
Kunstübung aus der Naturnachahmung zur Dekoration.
Die ästhetischen Grundsätze dieses Volkes sind
vielfach nur halb bekannt zu Führern gewählt worden.
Möchten alle, die es angeht, die erneute Gelegenheit,
sie ganz zu verstehen, wahrgenommen haben, solange
die Sammlung Oeder der Öffentlichkeit zugänglich war.
Nirgends konnte man sich für die Diskretion des
Ziermotivs eindringlicher erwärmen, wenn dieselbe
— im Gegensatz zur europäischen Tradition und
beiläufig gesagt, im Gegensatz zu derjenigen, die fast
auf der ganzen Welt zu allen Zeiten geherrscht hat
— auch nur ausnahmsweise durch die Wiederholung
des Gleichen erreicht wird. Im Effekt kommt auch
das Einzelmotiv mit seiner scheinbaren Naturtreue in
der japanischen Auffassung der Dekoration durch die
»Reihung« wie Romanismus, Gotik oder Renaissance
sie behandelten überein: immer wirkt es nur als
sekundärer Teil an der stets in erster Linie sicht-
baren Gerätform.
Die Zeit künstlerischen Umbildens, in der wir seit
einem Jahrzehnt ungefähr leben, hat diesen Haupt-
grundsatz nicht genügend vor Augen gehabt. Sie
hat ihn vielleicht vernachlässigen müssen, um sich
nachdrücklich gegen die Gefahr zu verteidigen, stets
wieder von der Autorität abgeleiteter Stile überwältigt
zu werden, mit denen für ihre neuen Aufgaben nichts
anzufangen war. Das ist eine Frage, die ihre besondere
Beantwortung bei anderer Gelegenheit verlangen würde.
Jedenfalls ist das Ornament zu sehr Selbstzweck ge-
worden. Im Wuchern dessen, was als »Jugendstil«
bezeichnet wird, tritt dieser Übergangsfehler gradezu
als Karikatur auf. Aber auch in der Arbeit derjenigen
Künstler, welche ernsthaft in einer einfachen Haltung
und in der Betonung des Konstruktiven die Lösung
der modernen Stilfrage suchen, ist das Grössenverhältnis
von Grundform und Ornament zu einander nicht
immer das normale gewesen.
Heute scheint es, dass dieses Missverhältnis seinen
Höhepunkt schon überschritten hat. Es ist wohl nicht
zufällig, dass an sehr verschiedenen Stellen gleichzeitig
das anspruchslose Füllornament, das Pleinmuster und
das geometrische Formmotiv als vereinzelter Accent
an wichtiger Stelle die Rolle übernehmen, welche bis
vor kurzem die Naturreminiszenz, speziell das Pflanzen-
motiv zu spielen pflegte. In diesem Sinne aufgefasst
findet sich die Dekoration sowohl wiederholt in der
Innenraumausstattung, die Jung-Wien pflegt, wie in
der Arbeit der Münchner Vereinigten Werkstätten.
Auch die beiden Kleinhempel und Nicolai in Dresden
machen das Ornament aus ähnlichen Gründen un-
scheinbar. In demselben Zusammenhange wäre an
Olbrich's Klötzchen- und Schachbrettzierat zu erinnern.
Denn manche von den Genannten geraten nun wieder in
das Extrem: eine nicht ganz natürliche Einfalt. Um nur
Fleck oder Linie zu bleiben, soll das Ornament wo-
möglich gar nichts sagen. Nicht nur die Anlehnung
an eine erkennbare Naturform, jede etwas zusammen-
gesetzte Zierlichkeit wird ausdrücklich gemieden. Das
sieht fast nach Ängstlichkeit aus. Schliesslich wird sich
die Freude an einem bedeutungsvollen Schmuck, der
auch die Phantasie beschäftigt, statt nur das Auge zu
befriedigen, auf die Dauer nicht abweisen lassen.
Ohnehin fehlt es keineswegs an Künstlern, welche
ihr Reichtum an spielender Laune zur Bethätigung in
der angegebenen Richtung treibt. So lassen sich
Berlepsch und Pankok die Anlehnung an die Natur-
DAS KUNSTHANDWERK AUF DER AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF 1902
mb
■■Boa
80
AUSSTELLUNG TURIN 1902
BÜCHERSCHRANK VON ERICH KLEINHEMPEL,
DRESDEN
man das Kunstprinzip der Ostasiaten vielfach auf.
Man sah die Naturform in ihren Ornamenten, und
man beachtete nicht die Massstäbe, mit denen sie sich
begnügten. Man war entzückt über die Kraft der
Farben und man prägte sich nicht genug ein, wie
geflissentlich sie dem Thatsächlichen Trotz boten. Auch
übersah man über der Lebendigkeit dieses Impressionis-
mus, wie er durch Vereinfachung jeder Verwechslungs-
möglichkeit mit dem Wirklichen aus dem Wege geht.
Durch alle diese Vorsicht aber wird erst die japanische
Kunstübung aus der Naturnachahmung zur Dekoration.
Die ästhetischen Grundsätze dieses Volkes sind
vielfach nur halb bekannt zu Führern gewählt worden.
Möchten alle, die es angeht, die erneute Gelegenheit,
sie ganz zu verstehen, wahrgenommen haben, solange
die Sammlung Oeder der Öffentlichkeit zugänglich war.
Nirgends konnte man sich für die Diskretion des
Ziermotivs eindringlicher erwärmen, wenn dieselbe
— im Gegensatz zur europäischen Tradition und
beiläufig gesagt, im Gegensatz zu derjenigen, die fast
auf der ganzen Welt zu allen Zeiten geherrscht hat
— auch nur ausnahmsweise durch die Wiederholung
des Gleichen erreicht wird. Im Effekt kommt auch
das Einzelmotiv mit seiner scheinbaren Naturtreue in
der japanischen Auffassung der Dekoration durch die
»Reihung« wie Romanismus, Gotik oder Renaissance
sie behandelten überein: immer wirkt es nur als
sekundärer Teil an der stets in erster Linie sicht-
baren Gerätform.
Die Zeit künstlerischen Umbildens, in der wir seit
einem Jahrzehnt ungefähr leben, hat diesen Haupt-
grundsatz nicht genügend vor Augen gehabt. Sie
hat ihn vielleicht vernachlässigen müssen, um sich
nachdrücklich gegen die Gefahr zu verteidigen, stets
wieder von der Autorität abgeleiteter Stile überwältigt
zu werden, mit denen für ihre neuen Aufgaben nichts
anzufangen war. Das ist eine Frage, die ihre besondere
Beantwortung bei anderer Gelegenheit verlangen würde.
Jedenfalls ist das Ornament zu sehr Selbstzweck ge-
worden. Im Wuchern dessen, was als »Jugendstil«
bezeichnet wird, tritt dieser Übergangsfehler gradezu
als Karikatur auf. Aber auch in der Arbeit derjenigen
Künstler, welche ernsthaft in einer einfachen Haltung
und in der Betonung des Konstruktiven die Lösung
der modernen Stilfrage suchen, ist das Grössenverhältnis
von Grundform und Ornament zu einander nicht
immer das normale gewesen.
Heute scheint es, dass dieses Missverhältnis seinen
Höhepunkt schon überschritten hat. Es ist wohl nicht
zufällig, dass an sehr verschiedenen Stellen gleichzeitig
das anspruchslose Füllornament, das Pleinmuster und
das geometrische Formmotiv als vereinzelter Accent
an wichtiger Stelle die Rolle übernehmen, welche bis
vor kurzem die Naturreminiszenz, speziell das Pflanzen-
motiv zu spielen pflegte. In diesem Sinne aufgefasst
findet sich die Dekoration sowohl wiederholt in der
Innenraumausstattung, die Jung-Wien pflegt, wie in
der Arbeit der Münchner Vereinigten Werkstätten.
Auch die beiden Kleinhempel und Nicolai in Dresden
machen das Ornament aus ähnlichen Gründen un-
scheinbar. In demselben Zusammenhange wäre an
Olbrich's Klötzchen- und Schachbrettzierat zu erinnern.
Denn manche von den Genannten geraten nun wieder in
das Extrem: eine nicht ganz natürliche Einfalt. Um nur
Fleck oder Linie zu bleiben, soll das Ornament wo-
möglich gar nichts sagen. Nicht nur die Anlehnung
an eine erkennbare Naturform, jede etwas zusammen-
gesetzte Zierlichkeit wird ausdrücklich gemieden. Das
sieht fast nach Ängstlichkeit aus. Schliesslich wird sich
die Freude an einem bedeutungsvollen Schmuck, der
auch die Phantasie beschäftigt, statt nur das Auge zu
befriedigen, auf die Dauer nicht abweisen lassen.
Ohnehin fehlt es keineswegs an Künstlern, welche
ihr Reichtum an spielender Laune zur Bethätigung in
der angegebenen Richtung treibt. So lassen sich
Berlepsch und Pankok die Anlehnung an die Natur-