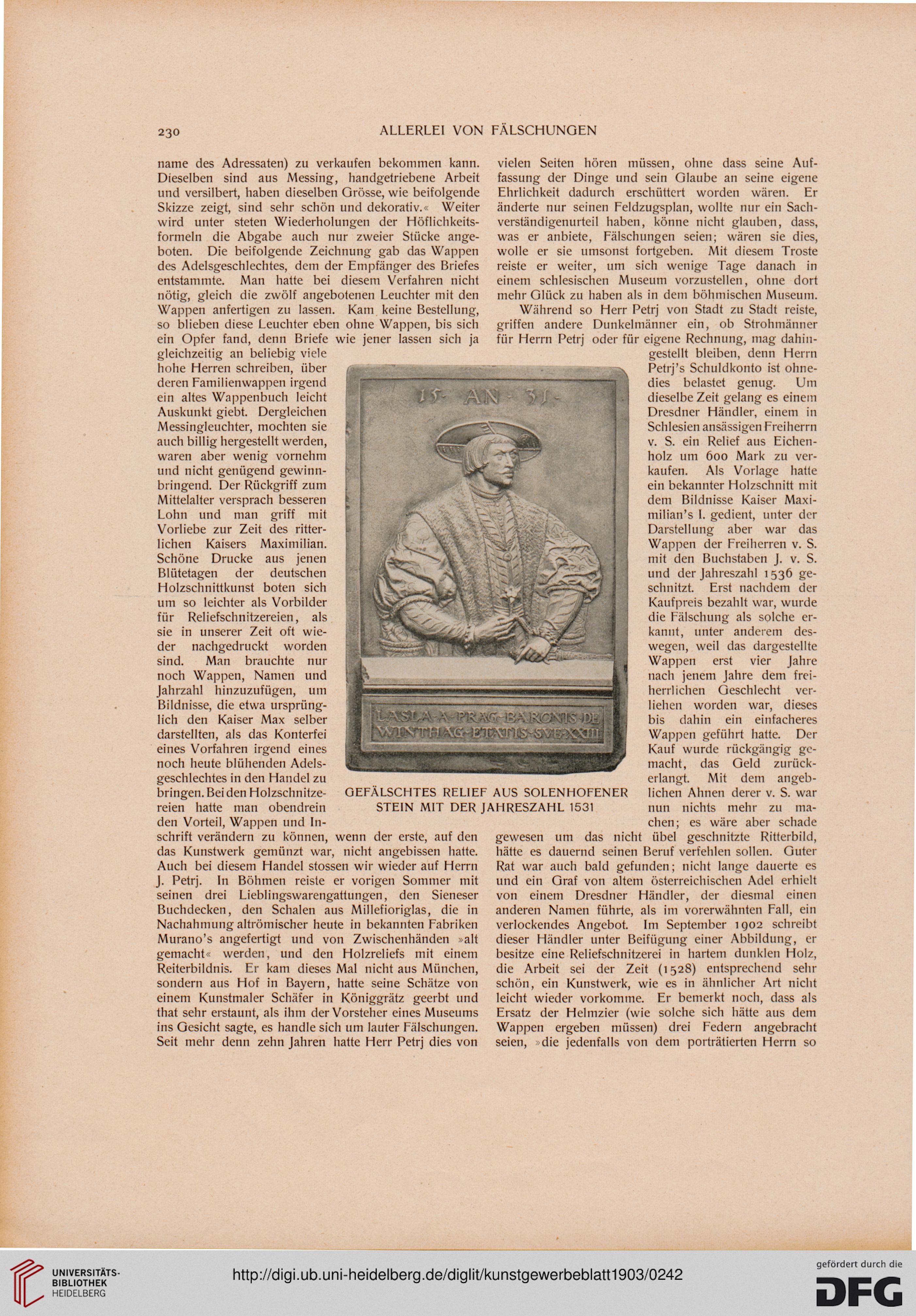230
ALLERLEI VON FÄLSCHUNGEN
name des Adressaten) zu verkaufen bekommen kann.
Dieselben sind aus Messing, handgetriebene Arbeit
und versilbert, haben dieselben Grösse, wie beifolgende
Skizze zeigt, sind sehr schön und dekorative Weiter
wird unter steten Wiederholungen der Höflichkeits-
formeln die Abgabe auch nur zweier Stücke ange-
boten. Die beifolgende Zeichnung gab das Wappen
des Adelsgeschlechtes, dem der Empfänger des Briefes
entstammte. Man hatte bei diesem Verfahren nicht
nötig, gleich die zwölf angebotenen Leuchter mit den
Wappen anfertigen zu lassen. Kam keine Bestellung,
so blieben diese Leuchter eben ohne Wappen, bis sich
ein Opfer fand, denn Briefe wie jener lassen sich ja
gleichzeitig an beliebig viele
hohe Herren schreiben, über
deren Familienwappen irgend
ein altes Wappenbuch leicht
Auskunkt giebt. Dergleichen
Messingleuchter, mochten sie
auch billig hergestellt werden,
waren aber wenig vornehm
und nicht genügend gewinn-
bringend. Der Rückgriff zum
Mittelalter versprach besseren
Lohn und man griff mit
Vorliebe zur Zeit des ritter-
lichen Kaisers Maximilian.
aus jenen
deutschen
boten sich
Schöne Drucke
Blütetagen der
Holzschnittkunst
um so leichter als Vorbilder
für Reliefschnitzereien, als
sie in unserer Zeit oft wie-
der nachgedruckt worden
sind. Man brauchte nur
noch Wappen, Namen und
Jahrzahl hinzuzufügen, um
Bildnisse, die etwa ursprüng-
lich den Kaiser Max selber
darstellten, als das Konterfei
eines Vorfahren irgend eines
noch heute blühenden Adels-
geschlechtes in den Handel zu
bringen. Bei den Holzschnitze-
reien hatte man obendrein
den Vorteil, Wappen und In-
schrift verändern zu können, wenn der erste, auf den
das Kunstwerk gemünzt war, nicht angebissen hatte.
Auch bei diesem Handel stossen wir wieder auf Herrn
J. Petrj. In Böhmen reiste er vorigen Sommer mit
seinen drei Lieblingswarengattungen, den Sieneser
Buchdecken, den Schalen aus Millefioriglas, die in
Nachahmung altrömischer heute in bekannten Fabriken
Murano's angefertigt und von Zwischenhänden »alt
gemacht« werden, und den Holzreliefs mit einem
Reiterbildnis. Er kam dieses Mal nicht aus München,
sondern aus Hof in Bayern, hatte seine Schätze von
einem Kunstmaler Schäfer in Königgrätz geerbt und
that sehr erstaunt, als ihm der Vorsteher eines Museums
ins Gesicht sagte, es handle sich um lauter Fälschungen.
Seit mehr denn zehn Jahren hatte Herr Petrj dies von
GEFÄLSCHTES RELIEF AUS SOLENHOFENER
STEIN MIT DER JAHRESZAHL 1531
vielen Seiten hören müssen, ohne dass seine Auf-
fassung der Dinge und sein Glaube an seine eigene
Ehrlichkeit dadurch erschüttert worden wären. Er
änderte nur seinen Feldzugsplan, wollte nur ein Sach-
verständigenurteil haben, könne nicht glauben, dass,
was er anbiete, Fälschungen seien; wären sie dies,
wolle er sie umsonst fortgeben. Mit diesem Tröste
reiste er weiter, um sich wenige Tage danach in
einem schlesischen Museum vorzustellen, ohne dort
mehr Glück zu haben als in dem böhmischen Museum.
Während so Herr Petrj von Stadt zu Stadt reiste,
griffen andere Dunkelmänner ein, ob Strohmänner
für Herrn Petrj oder für eigene Rechnung, mag dahin-
gestellt bleiben, denn Herrn
Petrj's Schuldkonto ist ohne-
dies belastet genug. Um
dieselbe Zeit gelang es einem
Dresdner Händler, einem in
Schlesien ansässigen Freiherrn
v. S. ein Relief aus Eichen-
holz um 600 Mark zu ver-
kaufen. Als Vorlage hatte
ein bekannter Holzschnitt mit
dem Bildnisse Kaiser Maxi-
milian's I. gedient, unter der
Darstellung aber war das
Wappen der Freiherren v. S.
mit den Buchstaben J. v. S.
und der Jahreszahl 1 536 ge-
schnitzt. Erst nachdem der
Kaufpreis bezahlt war, wurde
die Fälschung als solche er-
kannt, unter anderem des-
wegen, weil das dargestellte
Wappen erst vier Jahre
nach jenem Jahre dem frei-
herrlichen Geschlecht ver-
liehen worden war, dieses
bis dahin ein einfacheres
Wappen geführt hatte. Der
Kauf wurde rückgängig ge-
macht, das Geld zurück-
erlangt. Mit dem angeb-
lichen Ahnen derer v. S. war
nun nichts mehr zu ma-
chen; es wäre aber schade
gewesen um das nicht übel geschnitzte Ritterbild,
hätte es dauernd seinen Beruf verfehlen sollen. Guter
Rat war auch bald gefunden; nicht lange dauerte es
und ein Graf von altem österreichischen Adel erhielt
von einem Dresdner Händler, der diesmal einen
anderen Namen führte, als im vorerwähnten Fall, ein
verlockendes Angebot. Im September 1902 schreibt
dieser Händler unter Beifügung einer Abbildung, er
besitze eine Reliefschnitzerei in hartem dunklen Holz,
die Arbeit sei der Zeit (1528) entsprechend sehr
schön, ein Kunstwerk, wie es in ähnlicher Art nicht
leicht wieder vorkomme. Er bemerkt noch, dass als
Ersatz der Helmzier (wie solche sich hätte aus dem
Wappen ergeben müssen) drei Federn angebracht
seien, die jedenfalls von dem porträtierten Herrn so
ALLERLEI VON FÄLSCHUNGEN
name des Adressaten) zu verkaufen bekommen kann.
Dieselben sind aus Messing, handgetriebene Arbeit
und versilbert, haben dieselben Grösse, wie beifolgende
Skizze zeigt, sind sehr schön und dekorative Weiter
wird unter steten Wiederholungen der Höflichkeits-
formeln die Abgabe auch nur zweier Stücke ange-
boten. Die beifolgende Zeichnung gab das Wappen
des Adelsgeschlechtes, dem der Empfänger des Briefes
entstammte. Man hatte bei diesem Verfahren nicht
nötig, gleich die zwölf angebotenen Leuchter mit den
Wappen anfertigen zu lassen. Kam keine Bestellung,
so blieben diese Leuchter eben ohne Wappen, bis sich
ein Opfer fand, denn Briefe wie jener lassen sich ja
gleichzeitig an beliebig viele
hohe Herren schreiben, über
deren Familienwappen irgend
ein altes Wappenbuch leicht
Auskunkt giebt. Dergleichen
Messingleuchter, mochten sie
auch billig hergestellt werden,
waren aber wenig vornehm
und nicht genügend gewinn-
bringend. Der Rückgriff zum
Mittelalter versprach besseren
Lohn und man griff mit
Vorliebe zur Zeit des ritter-
lichen Kaisers Maximilian.
aus jenen
deutschen
boten sich
Schöne Drucke
Blütetagen der
Holzschnittkunst
um so leichter als Vorbilder
für Reliefschnitzereien, als
sie in unserer Zeit oft wie-
der nachgedruckt worden
sind. Man brauchte nur
noch Wappen, Namen und
Jahrzahl hinzuzufügen, um
Bildnisse, die etwa ursprüng-
lich den Kaiser Max selber
darstellten, als das Konterfei
eines Vorfahren irgend eines
noch heute blühenden Adels-
geschlechtes in den Handel zu
bringen. Bei den Holzschnitze-
reien hatte man obendrein
den Vorteil, Wappen und In-
schrift verändern zu können, wenn der erste, auf den
das Kunstwerk gemünzt war, nicht angebissen hatte.
Auch bei diesem Handel stossen wir wieder auf Herrn
J. Petrj. In Böhmen reiste er vorigen Sommer mit
seinen drei Lieblingswarengattungen, den Sieneser
Buchdecken, den Schalen aus Millefioriglas, die in
Nachahmung altrömischer heute in bekannten Fabriken
Murano's angefertigt und von Zwischenhänden »alt
gemacht« werden, und den Holzreliefs mit einem
Reiterbildnis. Er kam dieses Mal nicht aus München,
sondern aus Hof in Bayern, hatte seine Schätze von
einem Kunstmaler Schäfer in Königgrätz geerbt und
that sehr erstaunt, als ihm der Vorsteher eines Museums
ins Gesicht sagte, es handle sich um lauter Fälschungen.
Seit mehr denn zehn Jahren hatte Herr Petrj dies von
GEFÄLSCHTES RELIEF AUS SOLENHOFENER
STEIN MIT DER JAHRESZAHL 1531
vielen Seiten hören müssen, ohne dass seine Auf-
fassung der Dinge und sein Glaube an seine eigene
Ehrlichkeit dadurch erschüttert worden wären. Er
änderte nur seinen Feldzugsplan, wollte nur ein Sach-
verständigenurteil haben, könne nicht glauben, dass,
was er anbiete, Fälschungen seien; wären sie dies,
wolle er sie umsonst fortgeben. Mit diesem Tröste
reiste er weiter, um sich wenige Tage danach in
einem schlesischen Museum vorzustellen, ohne dort
mehr Glück zu haben als in dem böhmischen Museum.
Während so Herr Petrj von Stadt zu Stadt reiste,
griffen andere Dunkelmänner ein, ob Strohmänner
für Herrn Petrj oder für eigene Rechnung, mag dahin-
gestellt bleiben, denn Herrn
Petrj's Schuldkonto ist ohne-
dies belastet genug. Um
dieselbe Zeit gelang es einem
Dresdner Händler, einem in
Schlesien ansässigen Freiherrn
v. S. ein Relief aus Eichen-
holz um 600 Mark zu ver-
kaufen. Als Vorlage hatte
ein bekannter Holzschnitt mit
dem Bildnisse Kaiser Maxi-
milian's I. gedient, unter der
Darstellung aber war das
Wappen der Freiherren v. S.
mit den Buchstaben J. v. S.
und der Jahreszahl 1 536 ge-
schnitzt. Erst nachdem der
Kaufpreis bezahlt war, wurde
die Fälschung als solche er-
kannt, unter anderem des-
wegen, weil das dargestellte
Wappen erst vier Jahre
nach jenem Jahre dem frei-
herrlichen Geschlecht ver-
liehen worden war, dieses
bis dahin ein einfacheres
Wappen geführt hatte. Der
Kauf wurde rückgängig ge-
macht, das Geld zurück-
erlangt. Mit dem angeb-
lichen Ahnen derer v. S. war
nun nichts mehr zu ma-
chen; es wäre aber schade
gewesen um das nicht übel geschnitzte Ritterbild,
hätte es dauernd seinen Beruf verfehlen sollen. Guter
Rat war auch bald gefunden; nicht lange dauerte es
und ein Graf von altem österreichischen Adel erhielt
von einem Dresdner Händler, der diesmal einen
anderen Namen führte, als im vorerwähnten Fall, ein
verlockendes Angebot. Im September 1902 schreibt
dieser Händler unter Beifügung einer Abbildung, er
besitze eine Reliefschnitzerei in hartem dunklen Holz,
die Arbeit sei der Zeit (1528) entsprechend sehr
schön, ein Kunstwerk, wie es in ähnlicher Art nicht
leicht wieder vorkomme. Er bemerkt noch, dass als
Ersatz der Helmzier (wie solche sich hätte aus dem
Wappen ergeben müssen) drei Federn angebracht
seien, die jedenfalls von dem porträtierten Herrn so