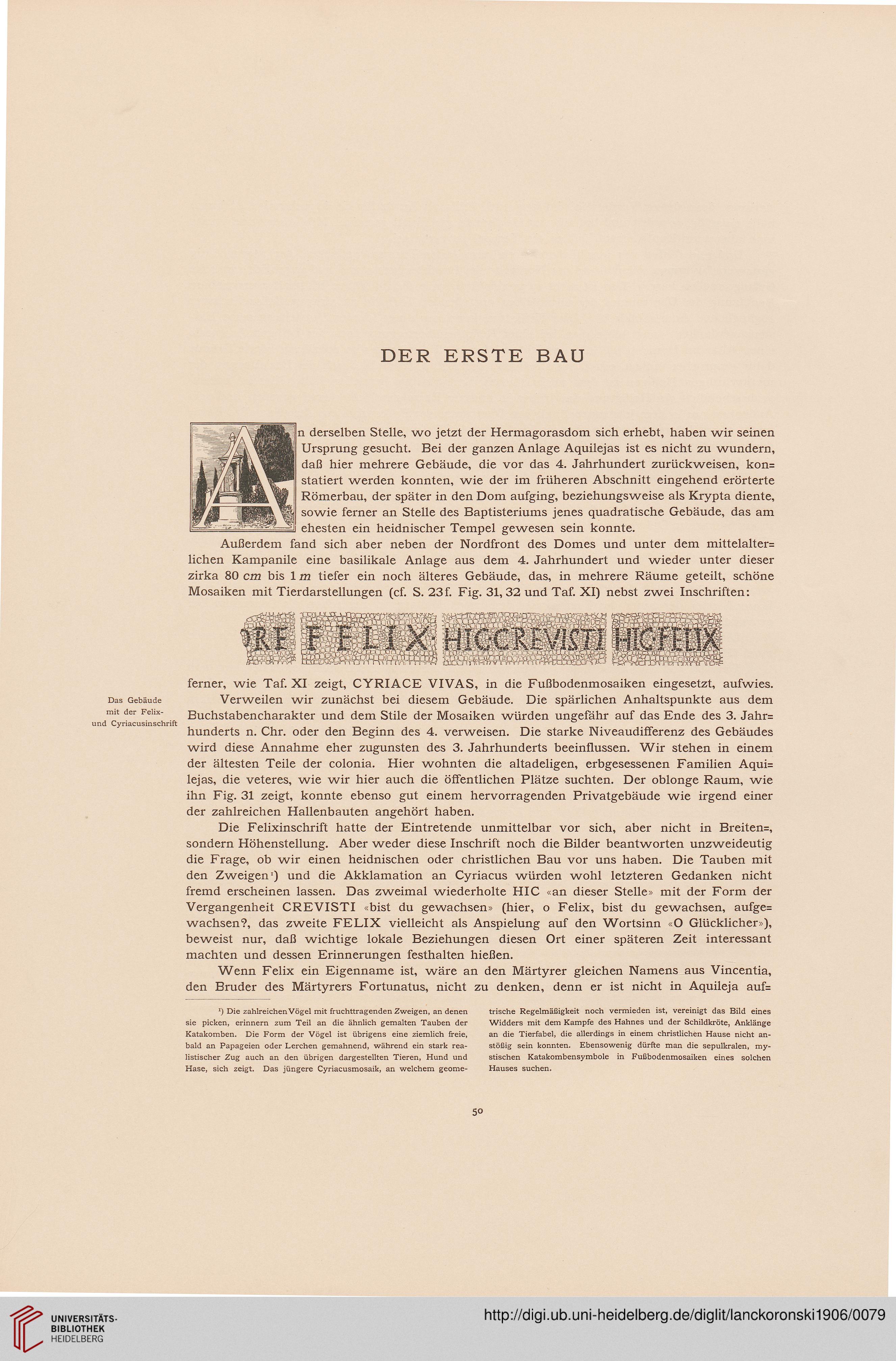DER ERSTE BAU
Das Gebäude
mit der Felix-
und Cyriacusinschrift
n derselben Stelle, wo jetzt der Hermagorasdom sich erhebt, haben wir seinen
Ursprung gesucht. Bei der ganzen Anlage Aquilejas ist es nicht zu wundern,
daß hier mehrere Gebäude, die vor das 4. Jahrhundert zurückweisen, kon-
statiert werden konnten, wie der im früheren Abschnitt eingehend erörterte
Römerbau, der später in den Dom aufging, beziehungsweise als Krypta diente,
sowie ferner an Stelle des Baptisteriums jenes quadratische Gebäude, das am
ehesten ein heidnischer Tempel gewesen sein konnte.
Außerdem fand sich aber neben der Nordfront des Domes und unter dem mittelalter-
liehen Kampanile eine basilikale Anlage aus dem 4. Jahrhundert und wieder unter dieser
zirka 80 cm bis 1 m tiefer ein noch älteres Gebäude, das, in mehrere Räume geteilt, schöne
Mosaiken mit Tierdarstellungen (cf. S. 23f. Fig. 31, 32 und Taf. XI) nebst zwei Inschriften:
ferner, wie Taf. XI zeigt, CYRIACE VIVAS, in die Fußbodenmosaiken eingesetzt, aufwies.
Verweilen wir zunächst bei diesem Gebäude. Die spärlichen Anhaltspunkte aus dem
Buchstabencharakter und dem Stile der Mosaiken würden ungefähr auf das Ende des 3. Jahr-
hunderts n. Chr. oder den Beginn des 4. verweisen. Die starke Niveaudifferenz des Gebäudes
wird diese Annahme eher zugunsten des 3. Jahrhunderts beeinflussen. Wir stehen in einem
der ältesten Teile der colonia. Hier wohnten die altadeligen, erbgesessenen Familien Aqui-
lejas, die veteres, wie wir hier auch die öffentlichen Plätze suchten. Der oblonge Raum, wie
ihn Fig. 31 zeigt, konnte ebenso gut einem hervorragenden Privatgebäude wie irgend einer
der zahlreichen Hallenbauten angehört haben.
Die Felixinschrift hatte der Eintretende unmittelbar vor sich, aber nicht in Breiten=,
sondern Höhenstellung. Aber weder diese Inschrift noch die Bilder beantworten unzweideutig
die Frage, ob wir einen heidnischen oder christlichen Bau vor uns haben. Die Tauben mit
den Zweigen1) und die Akklamation an Cyriacus würden wohl letzteren Gedanken nicht
fremd erscheinen lassen. Das zweimal wiederholte HIC «an dieser Stelle» mit der Form der
Vergangenheit CREVISTI «bist du gewachsen» (hier, o Felix, bist du gewachsen, aufge-
wachsen?, das zweite FELIX vielleicht als Anspielung auf den Wortsinn «O Glücklicher»),
beweist nur, daß wichtige lokale Beziehungen diesen Ort einer späteren Zeit interessant
machten und dessen Erinnerungen festhalten hießen.
Wenn Felix ein Eigenname ist, wäre an den Märtyrer gleichen Namens aus Vincentia,
den Bruder des Märtyrers Fortunatus, nicht zu denken, denn er ist nicht in Aquileja auf-
x) Die zahlreichen Vögel mit fruchttragenden Zweigen, an denen
sie picken, erinnern zum Teil an die ähnlich gemalten Tauben der
Katakomben. Die Form der Vögel ist übrigens eine ziemlich freie,
bald an Papageien oder Lerchen gemahnend, während ein stark rea-
listischer Zug auch an den übrigen dargestellten Tieren, Hund und
Hase, sich zeigt. Das jüngere Cyriacusmosaik, an welchem geome-
trische Regelmäßigkeit noch vermieden ist, vereinigt das Bild eines
Widders mit dem Kampfe des Hahnes und der Schildkröte, Anklänge
an die Tierfabel, die allerdings in einem christlichen Hause nicht an-
stößig sein konnten. Ebensowenig dürfte man die sepulkralen, my-
stischen Katakombensymbole in Fußbodenmosaiken eines solchen
Hauses suchen.
50
Das Gebäude
mit der Felix-
und Cyriacusinschrift
n derselben Stelle, wo jetzt der Hermagorasdom sich erhebt, haben wir seinen
Ursprung gesucht. Bei der ganzen Anlage Aquilejas ist es nicht zu wundern,
daß hier mehrere Gebäude, die vor das 4. Jahrhundert zurückweisen, kon-
statiert werden konnten, wie der im früheren Abschnitt eingehend erörterte
Römerbau, der später in den Dom aufging, beziehungsweise als Krypta diente,
sowie ferner an Stelle des Baptisteriums jenes quadratische Gebäude, das am
ehesten ein heidnischer Tempel gewesen sein konnte.
Außerdem fand sich aber neben der Nordfront des Domes und unter dem mittelalter-
liehen Kampanile eine basilikale Anlage aus dem 4. Jahrhundert und wieder unter dieser
zirka 80 cm bis 1 m tiefer ein noch älteres Gebäude, das, in mehrere Räume geteilt, schöne
Mosaiken mit Tierdarstellungen (cf. S. 23f. Fig. 31, 32 und Taf. XI) nebst zwei Inschriften:
ferner, wie Taf. XI zeigt, CYRIACE VIVAS, in die Fußbodenmosaiken eingesetzt, aufwies.
Verweilen wir zunächst bei diesem Gebäude. Die spärlichen Anhaltspunkte aus dem
Buchstabencharakter und dem Stile der Mosaiken würden ungefähr auf das Ende des 3. Jahr-
hunderts n. Chr. oder den Beginn des 4. verweisen. Die starke Niveaudifferenz des Gebäudes
wird diese Annahme eher zugunsten des 3. Jahrhunderts beeinflussen. Wir stehen in einem
der ältesten Teile der colonia. Hier wohnten die altadeligen, erbgesessenen Familien Aqui-
lejas, die veteres, wie wir hier auch die öffentlichen Plätze suchten. Der oblonge Raum, wie
ihn Fig. 31 zeigt, konnte ebenso gut einem hervorragenden Privatgebäude wie irgend einer
der zahlreichen Hallenbauten angehört haben.
Die Felixinschrift hatte der Eintretende unmittelbar vor sich, aber nicht in Breiten=,
sondern Höhenstellung. Aber weder diese Inschrift noch die Bilder beantworten unzweideutig
die Frage, ob wir einen heidnischen oder christlichen Bau vor uns haben. Die Tauben mit
den Zweigen1) und die Akklamation an Cyriacus würden wohl letzteren Gedanken nicht
fremd erscheinen lassen. Das zweimal wiederholte HIC «an dieser Stelle» mit der Form der
Vergangenheit CREVISTI «bist du gewachsen» (hier, o Felix, bist du gewachsen, aufge-
wachsen?, das zweite FELIX vielleicht als Anspielung auf den Wortsinn «O Glücklicher»),
beweist nur, daß wichtige lokale Beziehungen diesen Ort einer späteren Zeit interessant
machten und dessen Erinnerungen festhalten hießen.
Wenn Felix ein Eigenname ist, wäre an den Märtyrer gleichen Namens aus Vincentia,
den Bruder des Märtyrers Fortunatus, nicht zu denken, denn er ist nicht in Aquileja auf-
x) Die zahlreichen Vögel mit fruchttragenden Zweigen, an denen
sie picken, erinnern zum Teil an die ähnlich gemalten Tauben der
Katakomben. Die Form der Vögel ist übrigens eine ziemlich freie,
bald an Papageien oder Lerchen gemahnend, während ein stark rea-
listischer Zug auch an den übrigen dargestellten Tieren, Hund und
Hase, sich zeigt. Das jüngere Cyriacusmosaik, an welchem geome-
trische Regelmäßigkeit noch vermieden ist, vereinigt das Bild eines
Widders mit dem Kampfe des Hahnes und der Schildkröte, Anklänge
an die Tierfabel, die allerdings in einem christlichen Hause nicht an-
stößig sein konnten. Ebensowenig dürfte man die sepulkralen, my-
stischen Katakombensymbole in Fußbodenmosaiken eines solchen
Hauses suchen.
50