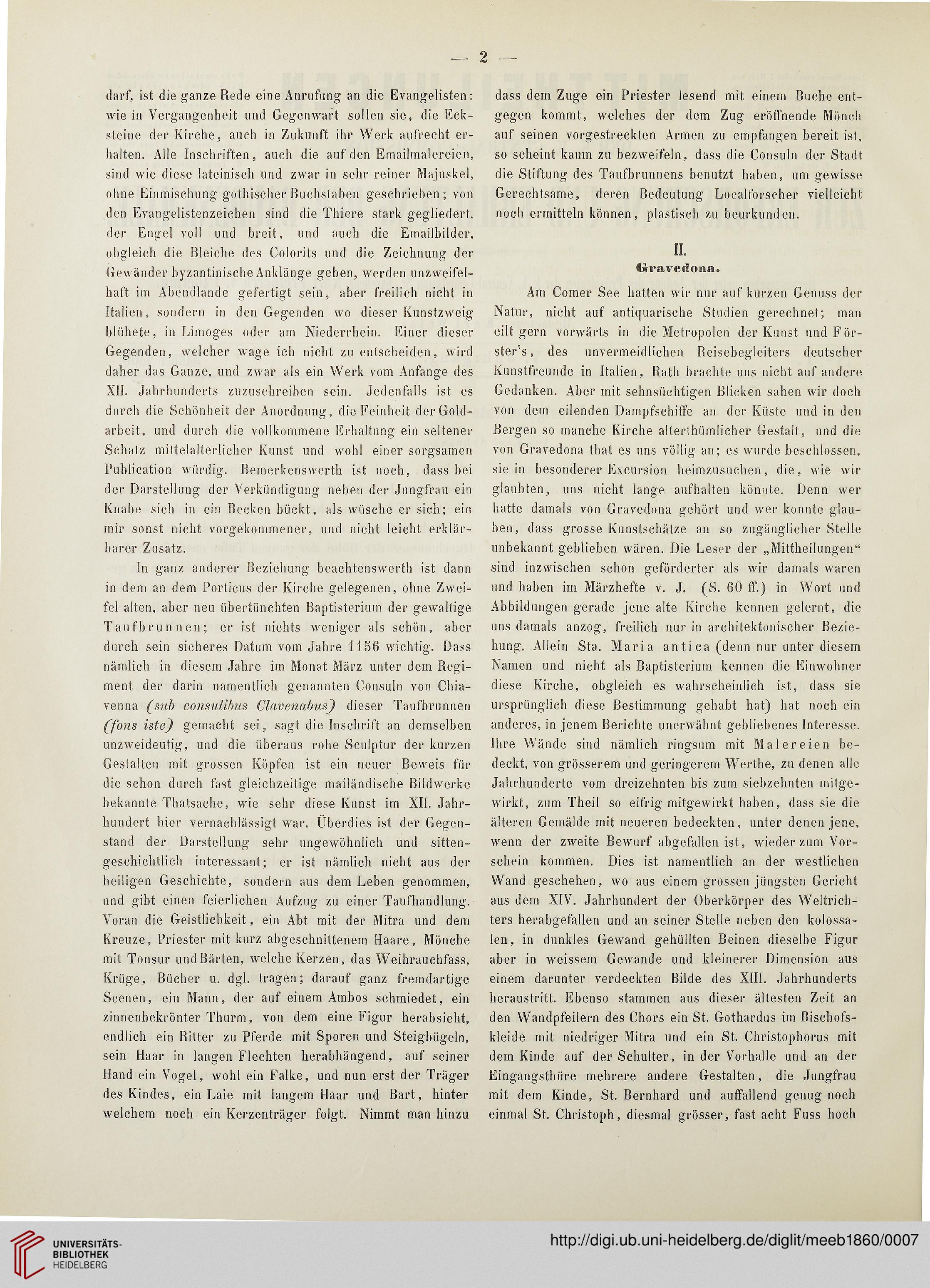2
darf, ist die ganze Rede eine Anrufung an die Evangelisten:
wie in Vergangenheit und Gegenwart sollen sie, die Eck-
steine der Kirche, auch in Zukunft ihr Werk aufrecht er-
halten. Alle Inschriften, auch die auf den Emailmalereien,
sind wie diese lateinisch und zwar in sehr reiner Majuskel,
ohne Einmischung gothischer Buchstaben geschrieben; von
den Evangelistenzeichen sind die Thiere stark gegliedert,
der Engel voll und breit, und auch die Emailbilder,
obgleich die Bleiche des Colorits und die Zeichnung der
Gewänder byzantinische Anklänge geben, werden unzweifel-
haft im Abendlande gefertigt sein, aber freilich nicht in
Italien, sondern in den Gegenden wo dieser Kunstzweig
blühete, in Limoges oder am Niederrhein. Einer dieser
Gegenden, welcher wage ich nicht zu entscheiden, wird
daher das Ganze, und zwar als ein Werk vom Anfänge des
XII. Jahrhunderts zuzusehreiben sein. Jedenfalls ist es
durch die Schönheit der Anordnung, die Feinheit der Gold-
arbeit, und durch die vollkommene Erhaltung ein seltener
Schatz mittelalterlicher Kunst und wohl einer sorgsamen
Publication würdig. Bemerkenswerth ist noch, dass bei
der Darstellung der Verkündigung neben der Jungfrau ein
Knabe sich in ein Becken bückt, als wüsche er sich; ein
mir sonst nicht vorgekommener, und nicht leicht erklär-
barer Zusatz.
In ganz anderer Beziehung beachtenswerth ist dann
in dem an dem Porticus der Kirche gelegenen, ohne Zwei-
fel alten, aber neu übertünchten Baptisterium der gewaltige
Taufbrunnen; er ist nichts weniger als schön, aber
durch sein sicheres Datum vom Jahre 1106 wichtig. Dass
nämlich in diesem Jahre im Monat März unter dem Regi-
ment der darin namentlich genannten Consuln von Chia-
venna (sub consulibus Clavenabus) dieser Taufbrunnen
(fons iste) gemacht sei, sagt die Inschrift an demselben
unzweideutig, und die überaus rohe Sculptur der kurzen
Gestalten mit grossen Köpfen ist ein neuer Beweis für
die schon durch fast gleichzeitige mailändische Bildwerke
bekannte Thatsache, wie sehr diese Kunst im XII. Jahr-
hundert hier vernachlässigt war. Überdies ist der Gegen-
stand der Darstellung sehr ungewöhnlich und sitten-
geschichtlich interessant; er ist nämlich nicht aus der
heiligen Geschichte, sondern aus dem Leben genommen,
und gibt einen feierlichen Aufzug zu einer Taufhandlung.
Voran die Geistlichkeit, ein Abt mit der Mitra und dem
Kreuze, Priester mit kurz abgeschnittenem Haare, Mönche
mit Tonsur und Bärten, welche Kerzen, das Weihrauchfass,
Krüge, Bücher u. dgl. tragen; darauf ganz fremdartige
Scenen, ein Mann, der auf einem Ambos schmiedet, ein
zinrienhekrönter Thurm, von dem eine Figur herabsieht,
endlich ein Ritter zu Pferde mit Sporen und Steigbügeln,
sein Haar in langen Flechten herabhängend, auf seiner
Hand ein Vogel, wohl ein Falke, und nun erst der Träger
des Kindes, ein Laie mit langem Haar und Bart, hinter
welchem noch ein Kerzenträger folgt. Nimmt man hinzu
dass dem Zuge ein Priester lesend mit einem Buche ent-
gegen kommt, welches der dem Zug eröffnende Mönch
auf seinen vorgestreckten Armen zu empfangen bereit ist,
so scheint kaum zu bezweifeln, dass die Consuln der Stadt
die Stiftung des Taufbrunnens benutzt haben, um gewisse
Gerechtsame, deren Bedeutung Localforscher vielleicht
noch ermitteln können, plastisch zu beurkunden.
II.
(■ ravcdona.
Am Corner See hatten wir nur auf kurzen Genuss der
Natur, nicht auf antiquarische Studien gerechnet; man
eilt gern vorwärts in die Metropolen der Kunst und För-
sters, des unvermeidlichen Reisebegleiters deutscher
Kunstfreunde in Italien, Rath brachte uns nicht auf andere
Gedanken. Aber mit sehnsüchtigen Blicken sahen wir doch
von dem eilenden Dampfschiffe an der Küste und in den
Bergen so manche Kirche alterlhümlicher Gestalt, und die
von Gravedona that es uns völlig an; es wurde beschlossen,
sie in besonderer Excursion heimzusuchen, die, wie wir
glaubten, uns nicht lange aufhalten könnte. Denn wer
hatte damals von Gravedona gehört und wer konnte glau-
ben, dass grosse Kunstschätze an so zugänglicher Stelle
unbekannt geblieben wären. Die Leser der „Mittheilungen“
sind inzwischen schon geförderter als wir damals waren
und haben im Märzhefte v. J. (S. 60 ff.) in Wort und
Abbildungen gerade jene alte Kirche kennen gelernt, die
uns damals anzog, freilich nur in architektonischer Bezie-
hung. Allein Sta. Maria antica (denn nur unter diesem
Namen und nicht als Baptisterium kennen die Einwohner
diese Kirche, obgleich es wahrscheinlich ist, dass sie
ursprünglich diese Bestimmung gehabt hat) hat noch ein
anderes, in jenem Berichte unerwähnt gebliebenes Interesse.
Ihre Wände sind nämlich ringsum mit Malereien be-
deckt, von grösserem und geringerem Werthe, zu denen alle
Jahrhunderte vom dreizehnten bis zum siebzehnten mitge-
wirkt, zum Theil so eifrig mitgewirkt haben, dass sie die
älteren Gemälde mit neueren bedeckten, unter denen jene,
wenn der zweite Bewurf abgefallen ist, wieder zum Vor-
schein kommen. Dies ist namentlich an der westlichen
Wand geschehen, wo aus einem grossen jüngsten Gericht
aus dem XIV. Jahrhundert der Oberkörper des Weltrich-
ters herabgefallen und an seiner Stelle neben den kolossa-
len, in dunkles Gewand gehüllten Beinen dieselbe Figur
aber in weissem Gewände und kleinerer Dimension aus
einem darunter verdeckten Bilde des XIII. Jahrhunderts
heraustritt. Ebenso stammen aus dieser ältesten Zeit an
den Wandpfeilern des Chors ein St. Gothardus im Bischofs-
kleide mit niedriger Mitra und ein St. Christophorus mit
dem Kinde auf der Schulter, in der Vorhalle und an der
Eingangsthiire mehrere andere Gestalten, die Jungfrau
mit dem Kinde, St. Bernhard und auffallend genug noch
einmal St. Christoph, diesmal grösser, fast acht Fuss hoch
darf, ist die ganze Rede eine Anrufung an die Evangelisten:
wie in Vergangenheit und Gegenwart sollen sie, die Eck-
steine der Kirche, auch in Zukunft ihr Werk aufrecht er-
halten. Alle Inschriften, auch die auf den Emailmalereien,
sind wie diese lateinisch und zwar in sehr reiner Majuskel,
ohne Einmischung gothischer Buchstaben geschrieben; von
den Evangelistenzeichen sind die Thiere stark gegliedert,
der Engel voll und breit, und auch die Emailbilder,
obgleich die Bleiche des Colorits und die Zeichnung der
Gewänder byzantinische Anklänge geben, werden unzweifel-
haft im Abendlande gefertigt sein, aber freilich nicht in
Italien, sondern in den Gegenden wo dieser Kunstzweig
blühete, in Limoges oder am Niederrhein. Einer dieser
Gegenden, welcher wage ich nicht zu entscheiden, wird
daher das Ganze, und zwar als ein Werk vom Anfänge des
XII. Jahrhunderts zuzusehreiben sein. Jedenfalls ist es
durch die Schönheit der Anordnung, die Feinheit der Gold-
arbeit, und durch die vollkommene Erhaltung ein seltener
Schatz mittelalterlicher Kunst und wohl einer sorgsamen
Publication würdig. Bemerkenswerth ist noch, dass bei
der Darstellung der Verkündigung neben der Jungfrau ein
Knabe sich in ein Becken bückt, als wüsche er sich; ein
mir sonst nicht vorgekommener, und nicht leicht erklär-
barer Zusatz.
In ganz anderer Beziehung beachtenswerth ist dann
in dem an dem Porticus der Kirche gelegenen, ohne Zwei-
fel alten, aber neu übertünchten Baptisterium der gewaltige
Taufbrunnen; er ist nichts weniger als schön, aber
durch sein sicheres Datum vom Jahre 1106 wichtig. Dass
nämlich in diesem Jahre im Monat März unter dem Regi-
ment der darin namentlich genannten Consuln von Chia-
venna (sub consulibus Clavenabus) dieser Taufbrunnen
(fons iste) gemacht sei, sagt die Inschrift an demselben
unzweideutig, und die überaus rohe Sculptur der kurzen
Gestalten mit grossen Köpfen ist ein neuer Beweis für
die schon durch fast gleichzeitige mailändische Bildwerke
bekannte Thatsache, wie sehr diese Kunst im XII. Jahr-
hundert hier vernachlässigt war. Überdies ist der Gegen-
stand der Darstellung sehr ungewöhnlich und sitten-
geschichtlich interessant; er ist nämlich nicht aus der
heiligen Geschichte, sondern aus dem Leben genommen,
und gibt einen feierlichen Aufzug zu einer Taufhandlung.
Voran die Geistlichkeit, ein Abt mit der Mitra und dem
Kreuze, Priester mit kurz abgeschnittenem Haare, Mönche
mit Tonsur und Bärten, welche Kerzen, das Weihrauchfass,
Krüge, Bücher u. dgl. tragen; darauf ganz fremdartige
Scenen, ein Mann, der auf einem Ambos schmiedet, ein
zinrienhekrönter Thurm, von dem eine Figur herabsieht,
endlich ein Ritter zu Pferde mit Sporen und Steigbügeln,
sein Haar in langen Flechten herabhängend, auf seiner
Hand ein Vogel, wohl ein Falke, und nun erst der Träger
des Kindes, ein Laie mit langem Haar und Bart, hinter
welchem noch ein Kerzenträger folgt. Nimmt man hinzu
dass dem Zuge ein Priester lesend mit einem Buche ent-
gegen kommt, welches der dem Zug eröffnende Mönch
auf seinen vorgestreckten Armen zu empfangen bereit ist,
so scheint kaum zu bezweifeln, dass die Consuln der Stadt
die Stiftung des Taufbrunnens benutzt haben, um gewisse
Gerechtsame, deren Bedeutung Localforscher vielleicht
noch ermitteln können, plastisch zu beurkunden.
II.
(■ ravcdona.
Am Corner See hatten wir nur auf kurzen Genuss der
Natur, nicht auf antiquarische Studien gerechnet; man
eilt gern vorwärts in die Metropolen der Kunst und För-
sters, des unvermeidlichen Reisebegleiters deutscher
Kunstfreunde in Italien, Rath brachte uns nicht auf andere
Gedanken. Aber mit sehnsüchtigen Blicken sahen wir doch
von dem eilenden Dampfschiffe an der Küste und in den
Bergen so manche Kirche alterlhümlicher Gestalt, und die
von Gravedona that es uns völlig an; es wurde beschlossen,
sie in besonderer Excursion heimzusuchen, die, wie wir
glaubten, uns nicht lange aufhalten könnte. Denn wer
hatte damals von Gravedona gehört und wer konnte glau-
ben, dass grosse Kunstschätze an so zugänglicher Stelle
unbekannt geblieben wären. Die Leser der „Mittheilungen“
sind inzwischen schon geförderter als wir damals waren
und haben im Märzhefte v. J. (S. 60 ff.) in Wort und
Abbildungen gerade jene alte Kirche kennen gelernt, die
uns damals anzog, freilich nur in architektonischer Bezie-
hung. Allein Sta. Maria antica (denn nur unter diesem
Namen und nicht als Baptisterium kennen die Einwohner
diese Kirche, obgleich es wahrscheinlich ist, dass sie
ursprünglich diese Bestimmung gehabt hat) hat noch ein
anderes, in jenem Berichte unerwähnt gebliebenes Interesse.
Ihre Wände sind nämlich ringsum mit Malereien be-
deckt, von grösserem und geringerem Werthe, zu denen alle
Jahrhunderte vom dreizehnten bis zum siebzehnten mitge-
wirkt, zum Theil so eifrig mitgewirkt haben, dass sie die
älteren Gemälde mit neueren bedeckten, unter denen jene,
wenn der zweite Bewurf abgefallen ist, wieder zum Vor-
schein kommen. Dies ist namentlich an der westlichen
Wand geschehen, wo aus einem grossen jüngsten Gericht
aus dem XIV. Jahrhundert der Oberkörper des Weltrich-
ters herabgefallen und an seiner Stelle neben den kolossa-
len, in dunkles Gewand gehüllten Beinen dieselbe Figur
aber in weissem Gewände und kleinerer Dimension aus
einem darunter verdeckten Bilde des XIII. Jahrhunderts
heraustritt. Ebenso stammen aus dieser ältesten Zeit an
den Wandpfeilern des Chors ein St. Gothardus im Bischofs-
kleide mit niedriger Mitra und ein St. Christophorus mit
dem Kinde auf der Schulter, in der Vorhalle und an der
Eingangsthiire mehrere andere Gestalten, die Jungfrau
mit dem Kinde, St. Bernhard und auffallend genug noch
einmal St. Christoph, diesmal grösser, fast acht Fuss hoch