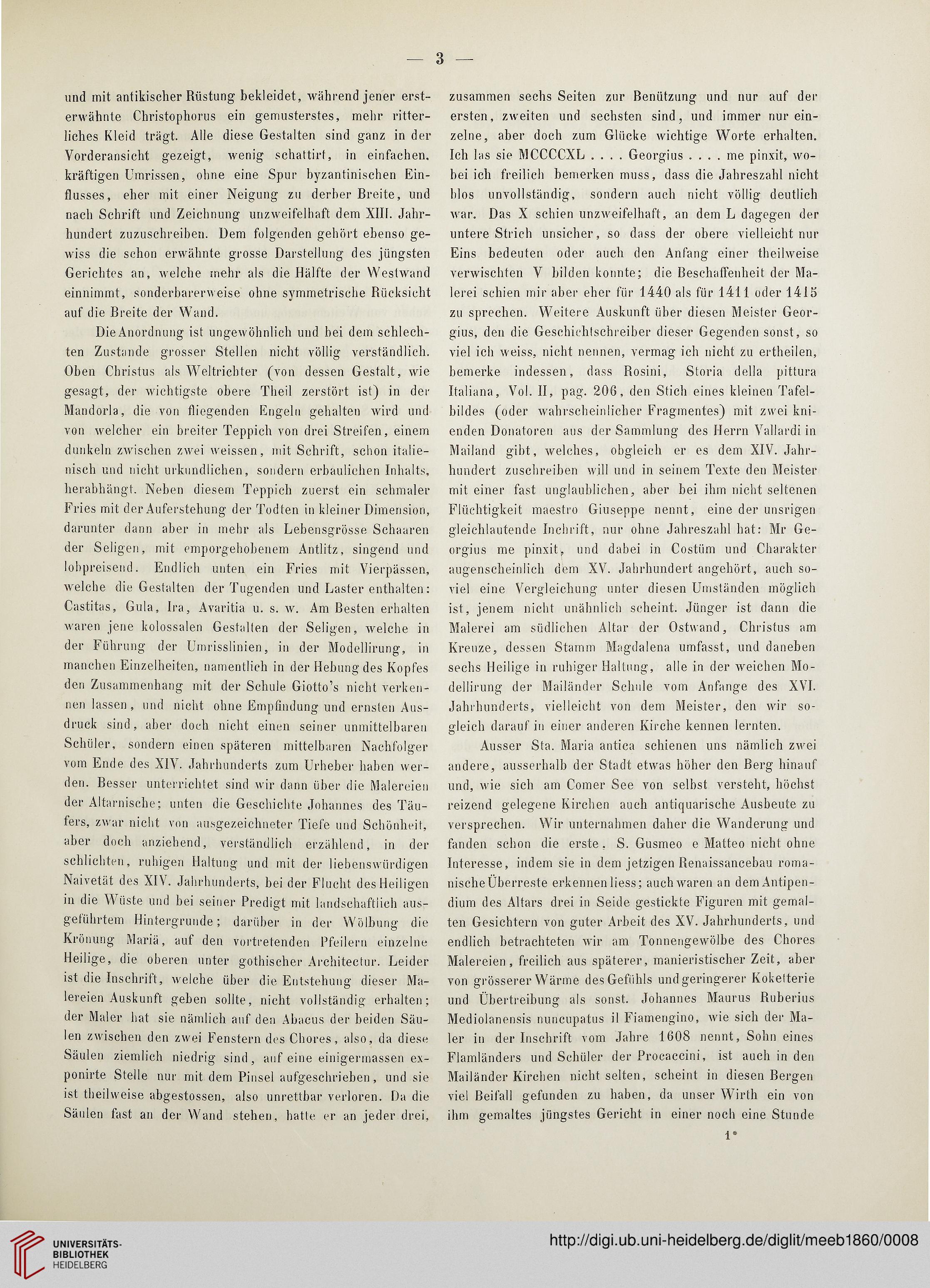3
und mit antikischer Rüstung bekleidet, während jener erst-
erwähnte Christophorus ein gemusterstes, mehr ritter-
liches Kleid trägt. Alle diese Gestalten sind ganz in der
Vorderansicht gezeigt, wenig schattirf, in einfachen,
kräftigen Umrissen, ohne eine Spur byzantinischen Ein-
flusses, eher mit einer Neigung zu derber Breite, und
nach Schrift und Zeichnung unzweifelhaft dem XIII. Jahr-
hundert zuzuschreiben. Bern folgenden gehört ebenso ge-
wiss die schon erwähnte grosse Darstellung des jüngsten
Gerichtes an, welche mehr als die Hälfte der Westwand
einnimmt, sonderbarerweise ohne symmetrische Rücksicht
auf die Breite der Wand.
Die Anordnung ist ungewöhnlich und bei dein schlech-
ten Zustande grosser Stellen nicht völlig verständlich.
Oben Christus als Weltrichter (von dessen Gestalt, wie
gesagt, der wichtigste obere Theil zerstört ist) in der
Mandorla, die von fliegenden Engeln gehalten wird und
von welcher ein breiter Teppich von drei Streifen, einem
dunkeln zwischen zwei weissen, mit Schrift, schon italie-
nisch und nicht urkundlichen, sondern erbaulichen Inhalts,
herabhängt. Neben diesem Teppich zuerst ein schmaler
Fries mit der Auferstehung der Todten in kleiner Dimension,
darunter dann aber in mehr als Lebensgrösse Schaaren
der Seligen, mit emporgehobenem Antlitz, singend und
lobpreisend. Endlich unten ein Fries mit Vierpässen,
welche die Gestalten der Tugenden und Laster enthalten:
Castitas, Gula, Ira, Avaritia u. s. w. Am Besten erhalten
waren jene kolossalen Gestalten der Seligen, welche in
der Führung der Umrisslinien, in der Modellirung, in
manchen Einzelheiten, namentlich in der Hebung des Kopfes
den Zusammenhang mit der Schule Giotto’s nicht verken-
nen lassen , und nicht ohne Empfindung und ernsten Aus-
druck sind, aber doch nicht einen seiner unmittelbaren
Schüler, sondern einen späteren mittelbaren Nachfolger
vom Ende des XIV. Jahrhunderts zum Urheber haben wer-
den. Besser unterrichtet sind wir dann über die Malereien
der Altarnische; unten die Geschichte Johannes des Täu-
fers, zwar nicht von ausgezeichneter Tiefe und Schönheit,
aber doch anziehend, verständlich erzählend, in der
schlichten, ruhigen Haltung und mit der liebenswürdigen
Naivetät des XI\. Jahrhunderts, bei der Flucht des Heiligen
in die Wüste und bei seiner Predigt mit landschaftlich aus-
geführtem Hintergründe; darüber in der Wölbung die
Krönung Mariä, auf den vortretenden Pfeilern einzelne
Heilige, die oberen unter gothischer Architectur. Leider
ist die Inschrift, welche über die Entstehung dieser Ma-
lereien Auskunft geben sollte, nicht vollständig erhalten;
der Maler hat sie nämlich auf den Abacus der beiden Säu-
len zwischen den zwei Fenstern des Chores, also, da diese
Säulen ziemlich niedrig sind, auf eine einigermassen ex-
ponirte Stelle nur mit dem Pinsel aufgeschrieben, und sie
ist theilweise abgestossen, also unrettbar verloren. Da die
Säulen fast an der Wand stehen, hatte er an jeder drei.
zusammen sechs Seiten zur Benützung und nur auf der
ersten, zweiten und sechsten sind, und immer nur ein-
zelne, aber doch zum Glücke wichtige Worte erhalten.
Ich las sie MCCCCXL .... Georgius .... me pinxit, wo-
bei ich freilich bemerken muss, dass die Jahreszahl nicht
blos unvollständig, sondern auch nicht völlig deutlich
war. Das X schien unzweifelhaft, an dem L dagegen der
untere Strich unsicher, so dass der obere vielleicht nur
Eins bedeuten oder auch den Anfang einer theilweise
verwischten V bilden konnte; die Beschaffenheit der Ma-
lerei schien mir aber eher für 1440 als für 1411 oder 1415
zu sprechen. Weitere Auskunft über diesen Meister Geor-
gius, den die Geschichtschreiber dieser Gegenden sonst, so
viel ich weiss, nicht nennen, vermag ich nicht zu ertheilen,
bemerke indessen, dass Rosini, Storia della pittura
Italiana, Voi. II, pag. 206, den Stich eines kleinen Tafel-
bildes (oder wahrscheinlicher Fragmentes) mit zwei kni-
enden Donatoren aus der Sammlung des Herrn Vallardi in
Mailand gibt, welches, obgleich er es dem XIV. Jahr-
hundert zuschreiben will und in seinem Texte den Meister
mit einer fast unglaublichen, aber bei ihm nicht seltenen
Flüchtigkeit maestro Giuseppe nennt, eine der unsrigen
gleichlautende Inchrift, nur ohne Jahreszahl hat: Mr Ge-
orgius me pinxitw und dabei in Costiim und Charakter
augenscheinlich dem XV. Jahrhundert angehört, auch so-
viel eine Vergleichung unter diesen Umständen möglich
ist, jenem nicht unähnlich scheint. Jünger ist dann die
Malerei am südlichen Altar der Ostwand, Christus am
Kreuze, dessen Stamm Magdalena umfasst, und daneben
sechs Heilige in ruhiger Haltung, alle in der weichen Mo-
dellirung der Mailänder Schule vom Anfänge des XVI.
Jahrhunderts, vielleicht von dem Meister, den wir so-
gleich darauf in einer anderen Kirche kennen lernten.
Ausser Sta. Maria antica schienen uns nämlich zwei
andere, ausserhalb der Stadt etwas höher den Berg hinauf
und, wie sich am Corner See von selbst versteht, höchst
reizend gelegene Kirchen auch antiquarische Ausbeute zu
versprechen. Wir unternahmen daher die Wanderung und
fanden schon die erste. S. Gusmeo e Matteo nicht ohne
Interesse, indem sie in dem jetzigen Renaissancebau roma-
nische Überreste erkennen liess; auch waren an demAntipen-
dium des Altars drei in Seide gestickte Figuren mit gemal-
ten Gesichtern von guter Arbeit des XV. Jahrhunderts, und
endlich betrachteten wir am Tonnengewölbe des Chores
Malereien, freilich aus späterer, manieristischer Zeit, aber
von grösserer Wärme des Gefühls und geringerer Koketterie
und Übertreibung als sonst. Johannes Maurus Ruberius
Mediolanensis nuncupatus il Fiamengino, wie sich der Ma-
ler in der Inschrift vom Jahre 1608 nennt, Sohn eines
Flamländers und Schüler der Procaccini, ist auch in den
Mailänder Kirchen nicht selten, scheint in diesen Bergen
viel Beifall gefunden zu haben, da unser Wirth ein von
ihm gemaltes jüngstes Gericht in einer noch eine Stunde
1*
und mit antikischer Rüstung bekleidet, während jener erst-
erwähnte Christophorus ein gemusterstes, mehr ritter-
liches Kleid trägt. Alle diese Gestalten sind ganz in der
Vorderansicht gezeigt, wenig schattirf, in einfachen,
kräftigen Umrissen, ohne eine Spur byzantinischen Ein-
flusses, eher mit einer Neigung zu derber Breite, und
nach Schrift und Zeichnung unzweifelhaft dem XIII. Jahr-
hundert zuzuschreiben. Bern folgenden gehört ebenso ge-
wiss die schon erwähnte grosse Darstellung des jüngsten
Gerichtes an, welche mehr als die Hälfte der Westwand
einnimmt, sonderbarerweise ohne symmetrische Rücksicht
auf die Breite der Wand.
Die Anordnung ist ungewöhnlich und bei dein schlech-
ten Zustande grosser Stellen nicht völlig verständlich.
Oben Christus als Weltrichter (von dessen Gestalt, wie
gesagt, der wichtigste obere Theil zerstört ist) in der
Mandorla, die von fliegenden Engeln gehalten wird und
von welcher ein breiter Teppich von drei Streifen, einem
dunkeln zwischen zwei weissen, mit Schrift, schon italie-
nisch und nicht urkundlichen, sondern erbaulichen Inhalts,
herabhängt. Neben diesem Teppich zuerst ein schmaler
Fries mit der Auferstehung der Todten in kleiner Dimension,
darunter dann aber in mehr als Lebensgrösse Schaaren
der Seligen, mit emporgehobenem Antlitz, singend und
lobpreisend. Endlich unten ein Fries mit Vierpässen,
welche die Gestalten der Tugenden und Laster enthalten:
Castitas, Gula, Ira, Avaritia u. s. w. Am Besten erhalten
waren jene kolossalen Gestalten der Seligen, welche in
der Führung der Umrisslinien, in der Modellirung, in
manchen Einzelheiten, namentlich in der Hebung des Kopfes
den Zusammenhang mit der Schule Giotto’s nicht verken-
nen lassen , und nicht ohne Empfindung und ernsten Aus-
druck sind, aber doch nicht einen seiner unmittelbaren
Schüler, sondern einen späteren mittelbaren Nachfolger
vom Ende des XIV. Jahrhunderts zum Urheber haben wer-
den. Besser unterrichtet sind wir dann über die Malereien
der Altarnische; unten die Geschichte Johannes des Täu-
fers, zwar nicht von ausgezeichneter Tiefe und Schönheit,
aber doch anziehend, verständlich erzählend, in der
schlichten, ruhigen Haltung und mit der liebenswürdigen
Naivetät des XI\. Jahrhunderts, bei der Flucht des Heiligen
in die Wüste und bei seiner Predigt mit landschaftlich aus-
geführtem Hintergründe; darüber in der Wölbung die
Krönung Mariä, auf den vortretenden Pfeilern einzelne
Heilige, die oberen unter gothischer Architectur. Leider
ist die Inschrift, welche über die Entstehung dieser Ma-
lereien Auskunft geben sollte, nicht vollständig erhalten;
der Maler hat sie nämlich auf den Abacus der beiden Säu-
len zwischen den zwei Fenstern des Chores, also, da diese
Säulen ziemlich niedrig sind, auf eine einigermassen ex-
ponirte Stelle nur mit dem Pinsel aufgeschrieben, und sie
ist theilweise abgestossen, also unrettbar verloren. Da die
Säulen fast an der Wand stehen, hatte er an jeder drei.
zusammen sechs Seiten zur Benützung und nur auf der
ersten, zweiten und sechsten sind, und immer nur ein-
zelne, aber doch zum Glücke wichtige Worte erhalten.
Ich las sie MCCCCXL .... Georgius .... me pinxit, wo-
bei ich freilich bemerken muss, dass die Jahreszahl nicht
blos unvollständig, sondern auch nicht völlig deutlich
war. Das X schien unzweifelhaft, an dem L dagegen der
untere Strich unsicher, so dass der obere vielleicht nur
Eins bedeuten oder auch den Anfang einer theilweise
verwischten V bilden konnte; die Beschaffenheit der Ma-
lerei schien mir aber eher für 1440 als für 1411 oder 1415
zu sprechen. Weitere Auskunft über diesen Meister Geor-
gius, den die Geschichtschreiber dieser Gegenden sonst, so
viel ich weiss, nicht nennen, vermag ich nicht zu ertheilen,
bemerke indessen, dass Rosini, Storia della pittura
Italiana, Voi. II, pag. 206, den Stich eines kleinen Tafel-
bildes (oder wahrscheinlicher Fragmentes) mit zwei kni-
enden Donatoren aus der Sammlung des Herrn Vallardi in
Mailand gibt, welches, obgleich er es dem XIV. Jahr-
hundert zuschreiben will und in seinem Texte den Meister
mit einer fast unglaublichen, aber bei ihm nicht seltenen
Flüchtigkeit maestro Giuseppe nennt, eine der unsrigen
gleichlautende Inchrift, nur ohne Jahreszahl hat: Mr Ge-
orgius me pinxitw und dabei in Costiim und Charakter
augenscheinlich dem XV. Jahrhundert angehört, auch so-
viel eine Vergleichung unter diesen Umständen möglich
ist, jenem nicht unähnlich scheint. Jünger ist dann die
Malerei am südlichen Altar der Ostwand, Christus am
Kreuze, dessen Stamm Magdalena umfasst, und daneben
sechs Heilige in ruhiger Haltung, alle in der weichen Mo-
dellirung der Mailänder Schule vom Anfänge des XVI.
Jahrhunderts, vielleicht von dem Meister, den wir so-
gleich darauf in einer anderen Kirche kennen lernten.
Ausser Sta. Maria antica schienen uns nämlich zwei
andere, ausserhalb der Stadt etwas höher den Berg hinauf
und, wie sich am Corner See von selbst versteht, höchst
reizend gelegene Kirchen auch antiquarische Ausbeute zu
versprechen. Wir unternahmen daher die Wanderung und
fanden schon die erste. S. Gusmeo e Matteo nicht ohne
Interesse, indem sie in dem jetzigen Renaissancebau roma-
nische Überreste erkennen liess; auch waren an demAntipen-
dium des Altars drei in Seide gestickte Figuren mit gemal-
ten Gesichtern von guter Arbeit des XV. Jahrhunderts, und
endlich betrachteten wir am Tonnengewölbe des Chores
Malereien, freilich aus späterer, manieristischer Zeit, aber
von grösserer Wärme des Gefühls und geringerer Koketterie
und Übertreibung als sonst. Johannes Maurus Ruberius
Mediolanensis nuncupatus il Fiamengino, wie sich der Ma-
ler in der Inschrift vom Jahre 1608 nennt, Sohn eines
Flamländers und Schüler der Procaccini, ist auch in den
Mailänder Kirchen nicht selten, scheint in diesen Bergen
viel Beifall gefunden zu haben, da unser Wirth ein von
ihm gemaltes jüngstes Gericht in einer noch eine Stunde
1*