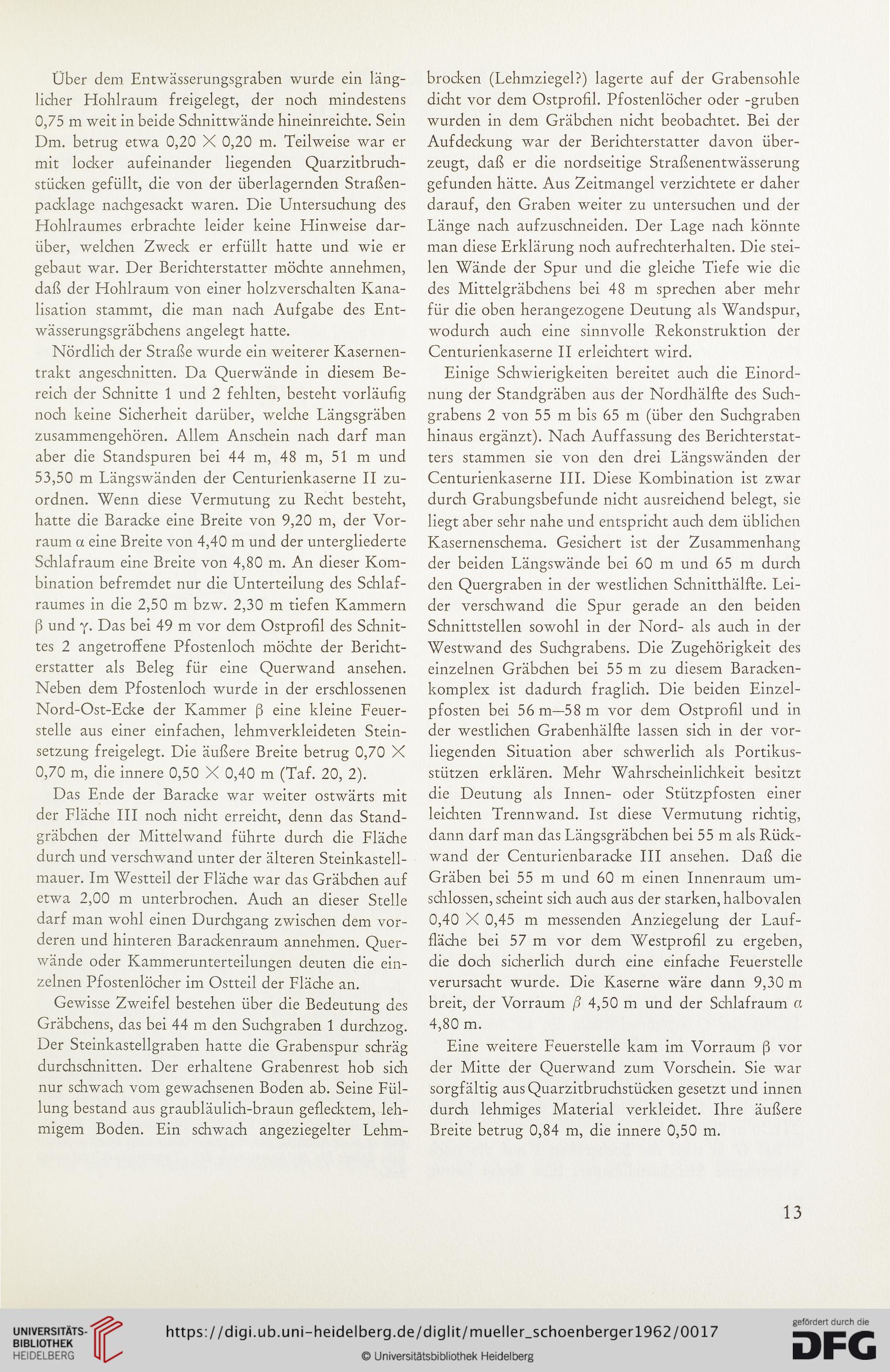Über dem Entwässerungsgraben wurde ein läng-
licher Hohlraum freigelegt, der noch mindestens
0,75 m weit in beide Schnittwände hineinreichte. Sein
Dm. betrug etwa 0,20 X 0,20 m. Teilweise war er
mit locker aufeinander liegenden Quarzitbruch-
stücken gefüllt, die von der überlagernden Straßen-
packlage nachgesackt waren. Die Untersuchung des
Hohlraumes erbrachte leider keine Hinweise dar-
über, welchen Zweck er erfüllt hatte und wie er
gebaut war. Der Berichterstatter möchte annehmen,
daß der Hohlraum von einer holzverschalten Kana-
lisation stammt, die man nach Aufgabe des Ent-
wässerungsgräbchens angelegt hatte.
Nördlich der Straße wurde ein weiterer Kasernen-
trakt angeschnitten. Da Querwände in diesem Be-
reich der Schnitte 1 und 2 fehlten, besteht vorläufig
noch keine Sicherheit darüber, welche Längsgräben
zusammengehören. Allem Anschein nach darf man
aber die Standspuren bei 44 m, 48 m, 51 m und
53,50 m Längswänden der Centurienkaserne II zu-
ordnen. Wenn diese Vermutung zu Recht besteht,
hatte die Baracke eine Breite von 9,20 m, der Vor-
raum a eine Breite von 4,40 m und der untergliederte
Schlafraum eine Breite von 4,80 m. An dieser Kom-
bination befremdet nur die Unterteilung des Schlaf-
raumes in die 2,50 m bzw. 2,30 m tiefen Kammern
ß und y. Das bei 49 m vor dem Ostprofil des Schnit-
tes 2 angetroffene Pfostenloch möchte der Bericht-
erstatter als Beleg für eine Querwand ansehen.
Neben dem Pfostenloch wurde in der erschlossenen
Nord-Ost-Ecke der Kammer ß eine kleine Feuer-
stelle aus einer einfachen, lehmverkleideten Stein-
setzung freigelegt. Die äußere Breite betrug 0,70 X
0,70 m, die innere 0,50 X 0,40 m (Taf. 20, 2).
Das Ende der Baracke war weiter ostwärts mit
der Fläche III noch nicht erreicht, denn das Stand-
gräbchen der Mittelwand führte durch die Fläche
durch und verschwand unter der älteren Steinkastell-
mauer. Im Westteil der Fläche war das Gräbchen auf
etwa 2,00 m unterbrochen. Auch an dieser Stelle
darf man wohl einen Durchgang zwischen dem vor-
deren und hinteren Barackenraum annehmen. Quer-
wände oder Kammerunterteilungen deuten die ein-
zelnen Pfostenlöcher im Ostteil der Fläche an.
Gewisse Zweifel bestehen über die Bedeutung des
Gräbchens, das bei 44 m den Suchgraben 1 durchzog.
Der Steinkastellgraben hatte die Grabenspur schräg
durchschnitten. Der erhaltene Grabenrest hob sich
nur schwach vom gewachsenen Boden ab. Seine Fül-
lung bestand aus graubläulich-braun geflecktem, leh-
migem Boden. Ein schwach angeziegelter Lehm-
brocken (Lehmziegel?) lagerte auf der Grabensohle
dicht vor dem Ostprofil. Pfostenlöcher oder -gruben
wurden in dem Gräbchen nicht beobachtet. Bei der
Aufdeckung war der Berichterstatter davon über-
zeugt, daß er die nordseitige Straßenentwässerung
gefunden hätte. Aus Zeitmangel verzichtete er daher
darauf, den Graben weiter zu untersuchen und der
Länge nach aufzuschneiden. Der Lage nach könnte
man diese Erklärung noch aufrechterhalten. Die stei-
len Wände der Spur und die gleiche Tiefe wie die
des Mittelgräbchens bei 48 m sprechen aber mehr
für die oben herangezogene Deutung als Wandspur,
wodurch auch eine sinnvolle Rekonstruktion der
Centurienkaserne II erleichtert wird.
Einige Schwierigkeiten bereitet auch die Einord-
nung der Standgräben aus der Nordhälfte des Such-
grabens 2 von 55 m bis 65 m (über den Suchgraben
hinaus ergänzt). Nach Auffassung des Berichterstat-
ters stammen sie von den drei Längswänden der
Centurienkaserne III. Diese Kombination ist zwar
durch Grabungsbefunde nicht ausreichend belegt, sie
liegt aber sehr nahe und entspricht auch dem üblichen
Kasernenschema. Gesichert ist der Zusammenhang
der beiden Längswände bei 60 m und 65 m durch
den Quergraben in der westlichen Schnitthälfte. Lei-
der verschwand die Spur gerade an den beiden
Schnittstellen sowohl in der Nord- als auch in der
Westwand des Suchgrabens. Die Zugehörigkeit des
einzelnen Gräbchen bei 55 m zu diesem Baracken-
komplex ist dadurch fraglich. Die beiden Einzel-
pfosten bei 56 m—58 m vor dem Ostprofil und in
der westlichen Grabenhälfte lassen sich in der vor-
liegenden Situation aber schwerlich als Portikus-
stiitzen erklären. Mehr Wahrscheinlichkeit besitzt
die Deutung als Innen- oder Stützpfosten einer
leichten Trennwand. Ist diese Vermutung richtig,
dann darf man das Längsgräbchen bei 55 m als Rück-
wand der Centurienbaracke III ansehen. Daß die
Gräben bei 55 m und 60 m einen Innenraum um-
schlossen, scheint sich auch aus der starken, halbovalen
0,40 X 0,45 m messenden Anziegelung der Lauf-
fläche bei 57 m vor dem Westprofil zu ergeben,
die doch sicherlich durch eine einfache Feuerstelle
verursacht wurde. Die Kaserne wäre dann 9,30 m
breit, der Vorraum ß 4,50 m und der Schlafraum a
4,80 m.
Eine weitere Feuerstelle kam im Vorraum ß vor
der Mitte der Querwand zum Vorschein. Sie war
sorgfältig aus Quarzitbruchstücken gesetzt und innen
durch lehmiges Material verkleidet. Ihre äußere
Breite betrug 0,84 m, die innere 0,50 m.
13
licher Hohlraum freigelegt, der noch mindestens
0,75 m weit in beide Schnittwände hineinreichte. Sein
Dm. betrug etwa 0,20 X 0,20 m. Teilweise war er
mit locker aufeinander liegenden Quarzitbruch-
stücken gefüllt, die von der überlagernden Straßen-
packlage nachgesackt waren. Die Untersuchung des
Hohlraumes erbrachte leider keine Hinweise dar-
über, welchen Zweck er erfüllt hatte und wie er
gebaut war. Der Berichterstatter möchte annehmen,
daß der Hohlraum von einer holzverschalten Kana-
lisation stammt, die man nach Aufgabe des Ent-
wässerungsgräbchens angelegt hatte.
Nördlich der Straße wurde ein weiterer Kasernen-
trakt angeschnitten. Da Querwände in diesem Be-
reich der Schnitte 1 und 2 fehlten, besteht vorläufig
noch keine Sicherheit darüber, welche Längsgräben
zusammengehören. Allem Anschein nach darf man
aber die Standspuren bei 44 m, 48 m, 51 m und
53,50 m Längswänden der Centurienkaserne II zu-
ordnen. Wenn diese Vermutung zu Recht besteht,
hatte die Baracke eine Breite von 9,20 m, der Vor-
raum a eine Breite von 4,40 m und der untergliederte
Schlafraum eine Breite von 4,80 m. An dieser Kom-
bination befremdet nur die Unterteilung des Schlaf-
raumes in die 2,50 m bzw. 2,30 m tiefen Kammern
ß und y. Das bei 49 m vor dem Ostprofil des Schnit-
tes 2 angetroffene Pfostenloch möchte der Bericht-
erstatter als Beleg für eine Querwand ansehen.
Neben dem Pfostenloch wurde in der erschlossenen
Nord-Ost-Ecke der Kammer ß eine kleine Feuer-
stelle aus einer einfachen, lehmverkleideten Stein-
setzung freigelegt. Die äußere Breite betrug 0,70 X
0,70 m, die innere 0,50 X 0,40 m (Taf. 20, 2).
Das Ende der Baracke war weiter ostwärts mit
der Fläche III noch nicht erreicht, denn das Stand-
gräbchen der Mittelwand führte durch die Fläche
durch und verschwand unter der älteren Steinkastell-
mauer. Im Westteil der Fläche war das Gräbchen auf
etwa 2,00 m unterbrochen. Auch an dieser Stelle
darf man wohl einen Durchgang zwischen dem vor-
deren und hinteren Barackenraum annehmen. Quer-
wände oder Kammerunterteilungen deuten die ein-
zelnen Pfostenlöcher im Ostteil der Fläche an.
Gewisse Zweifel bestehen über die Bedeutung des
Gräbchens, das bei 44 m den Suchgraben 1 durchzog.
Der Steinkastellgraben hatte die Grabenspur schräg
durchschnitten. Der erhaltene Grabenrest hob sich
nur schwach vom gewachsenen Boden ab. Seine Fül-
lung bestand aus graubläulich-braun geflecktem, leh-
migem Boden. Ein schwach angeziegelter Lehm-
brocken (Lehmziegel?) lagerte auf der Grabensohle
dicht vor dem Ostprofil. Pfostenlöcher oder -gruben
wurden in dem Gräbchen nicht beobachtet. Bei der
Aufdeckung war der Berichterstatter davon über-
zeugt, daß er die nordseitige Straßenentwässerung
gefunden hätte. Aus Zeitmangel verzichtete er daher
darauf, den Graben weiter zu untersuchen und der
Länge nach aufzuschneiden. Der Lage nach könnte
man diese Erklärung noch aufrechterhalten. Die stei-
len Wände der Spur und die gleiche Tiefe wie die
des Mittelgräbchens bei 48 m sprechen aber mehr
für die oben herangezogene Deutung als Wandspur,
wodurch auch eine sinnvolle Rekonstruktion der
Centurienkaserne II erleichtert wird.
Einige Schwierigkeiten bereitet auch die Einord-
nung der Standgräben aus der Nordhälfte des Such-
grabens 2 von 55 m bis 65 m (über den Suchgraben
hinaus ergänzt). Nach Auffassung des Berichterstat-
ters stammen sie von den drei Längswänden der
Centurienkaserne III. Diese Kombination ist zwar
durch Grabungsbefunde nicht ausreichend belegt, sie
liegt aber sehr nahe und entspricht auch dem üblichen
Kasernenschema. Gesichert ist der Zusammenhang
der beiden Längswände bei 60 m und 65 m durch
den Quergraben in der westlichen Schnitthälfte. Lei-
der verschwand die Spur gerade an den beiden
Schnittstellen sowohl in der Nord- als auch in der
Westwand des Suchgrabens. Die Zugehörigkeit des
einzelnen Gräbchen bei 55 m zu diesem Baracken-
komplex ist dadurch fraglich. Die beiden Einzel-
pfosten bei 56 m—58 m vor dem Ostprofil und in
der westlichen Grabenhälfte lassen sich in der vor-
liegenden Situation aber schwerlich als Portikus-
stiitzen erklären. Mehr Wahrscheinlichkeit besitzt
die Deutung als Innen- oder Stützpfosten einer
leichten Trennwand. Ist diese Vermutung richtig,
dann darf man das Längsgräbchen bei 55 m als Rück-
wand der Centurienbaracke III ansehen. Daß die
Gräben bei 55 m und 60 m einen Innenraum um-
schlossen, scheint sich auch aus der starken, halbovalen
0,40 X 0,45 m messenden Anziegelung der Lauf-
fläche bei 57 m vor dem Westprofil zu ergeben,
die doch sicherlich durch eine einfache Feuerstelle
verursacht wurde. Die Kaserne wäre dann 9,30 m
breit, der Vorraum ß 4,50 m und der Schlafraum a
4,80 m.
Eine weitere Feuerstelle kam im Vorraum ß vor
der Mitte der Querwand zum Vorschein. Sie war
sorgfältig aus Quarzitbruchstücken gesetzt und innen
durch lehmiges Material verkleidet. Ihre äußere
Breite betrug 0,84 m, die innere 0,50 m.
13