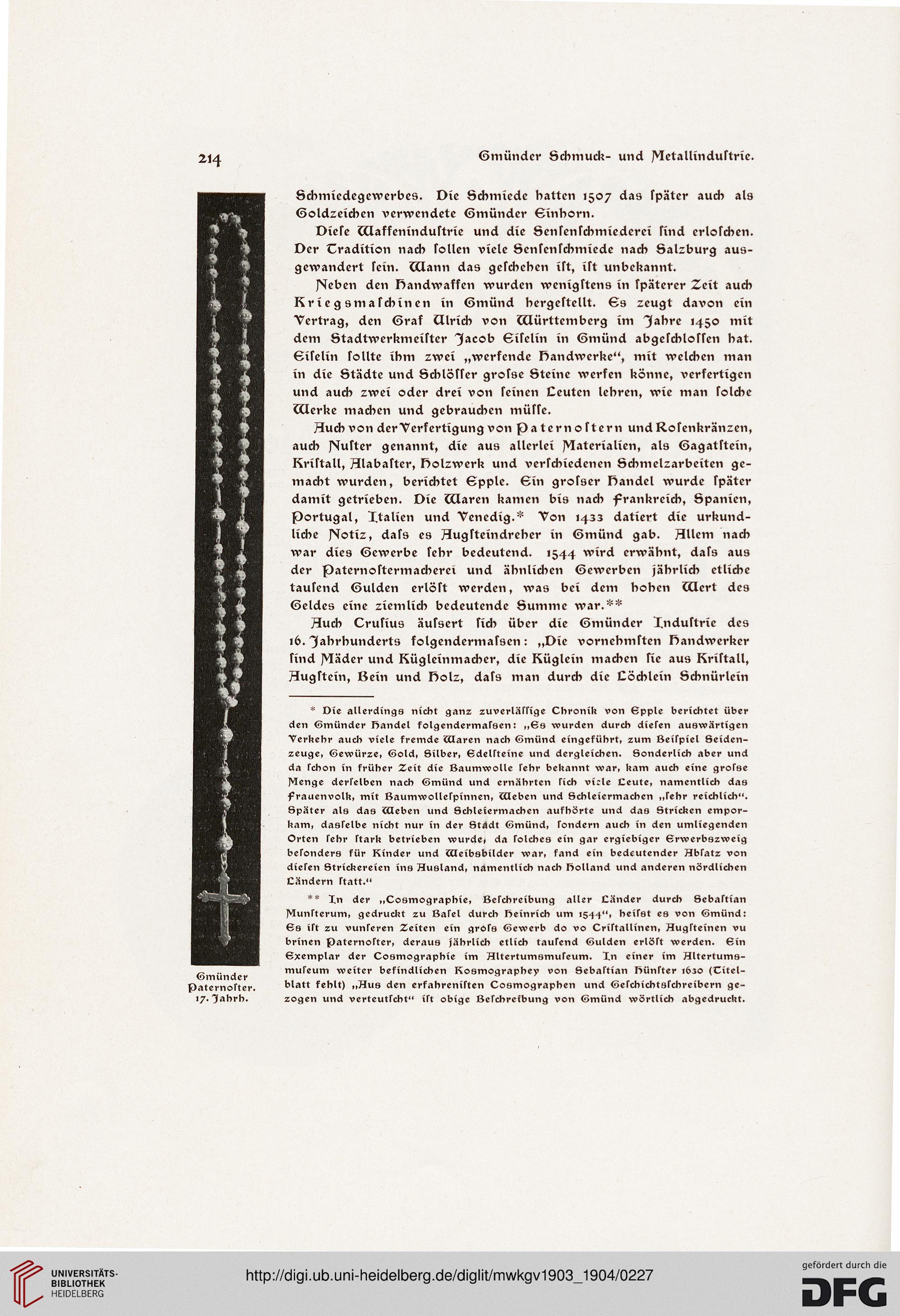214
Gmündcr Schmuck- und JVfetallinduftrie.
Scbmiedegewerbes. Die Schmiede hatten 1507 das fpäter auch als
Goldzeicben verwendete Gmünder ßinborn.
Diefe JUaffeninduftrie und die Senfenfchmiederei find erlofchen.
Der Cradition nach follen viele Senfenfchmiede nach Salzburg aus-
gewandert fein. CClann das gefchehen ift, ift unbekannt.
ISeben den Bandwaffen wurden wenigftens in fpäterer Zeit auch
Krie g smafchinen in Gmünd hergeftellt. 6s zeugt davon ein
"Vertrag, den Graf Cllricb von KXürttemberg im 'Jahre 1450 mit
dem Stadtwerkmeifter 'Jacob Gifelin in Gmünd abgefcbloffen hat.
Sifelin follte ihm zwei „werfende Bandwerke", mit welchen man
in die Städte und Scblöffer grofse Steine werfen könne, verfertigen
und auch zwei oder drei von feinen Ceuten lehren, wie man folche
Klerke machen und gebrauchen müffe.
3ucb von der "Verfertigung von paternoftern und Ro renkränzen,
auch fSufter genannt, die aus allerlei jviaterialien, als Gagatftein,
Kriftall, Hlabafter, Bolzwerk und verfebiedenen Scbmelzarbeiten ge-
macht wurden, berichtet Gpple. Gin grofser Bändel wurde fpäter
damit getrieben. Die CQaren kamen bis nach Frankreich, Spanien,
Portugal, Italien und "Venedig.* "Von 1433 datiert die urkund-
liche [Notiz, dafs es Hugfteindreber in Gmünd gab. HUem nach
war dies Gewerbe febr bedeutend. 1544 wird erwähnt, dafs aus
der paternoftermacberei und ähnlichen Gewerben jährlich etliche
taufend Gulden erlöft werden, was bei dem hoben JOert des
Geldes eine ziemlich bedeutende Summe war.**
Huch Crufius äufsert Heb über die Gmünder Induftrie des
16. "Jahrhunderts folgendermafsen : „Die vornehmften Bandwerker
find JHäder und Kügleinmacher, die Küglein machen fie aus Kriftall,
Hugftein, Bein und Bolz, dafs man durch die Cöchlein Schnürlein
* Die allerdings nicht ganz zuverlärrige Chronik von epple berichtet über
den ©münder ßandel f olgendermafsen: „69 wurden durch diefen auswärtigen
Verkehr auch viele fremde OTaren nach <5münd eingeführt, zum ßeifpiel Seiden-
zeuge, ©ewürze, <3old, Silber, edeUteine und dergleichen. Sonderlich aber und
da febon in früher Zeit die ßaumwolle Tehr bekannt war, kam auch eine groTsc
Menge dcrrelben nach Gmünd und ernährten fieb viele Ceute, namentlich das
f'rauenvolh, mit ßaumwolleTpinnen, beleben und Schlciermacben „rebr reichlich".
Später als das <U~eben und Schleiermacben aufhörte und das Stricken empor-
kam, dasTclbe nicht nur in der Stadt Gmünd, Tondem auch in den umliegenden
Orten febr ftark betrieben wurde, da Tolcbes ein gar ergiebiger 6rwerbszwcig
beTonders für Kinder und ftleibsbilder war, fand ein bedeutender HbTatz von
dieren Strickereien ins Husland, namentlich nach f>olland und anderen nördlichen
Cändern ftatt."
** Xn der „Cosmograpbie, ßefebreibung aller Cändcr durch Sebaftian
Munfterum, gedruckt zu Bafel durch P)einricb um 1544", betTst es von Gmünd:
6s iTt zu vunferen Zeiten ein grofs Gewerb do vo Crirtallincn, HugTteinen vu
brinen paternofter, deraus jährlich etlich taufend Gulden erlöft werden. Gin
exemplar der Cosmograpbie im HltertumsmuTeum. Xn einer im Hltertums-
mureum weiter befindlichen Kosmograpbcy von Sebaftian fȟnTter 1630 (Citcl-
blatt fehlt) „Hus den erfabreniften Cosmograpben und Gefcbicbtsrcbreibern ge-
zogen und verteutfebt" ift obige ßefebreibung von Gmünd wörtlich abgedruckt.
Gmündcr Schmuck- und JVfetallinduftrie.
Scbmiedegewerbes. Die Schmiede hatten 1507 das fpäter auch als
Goldzeicben verwendete Gmünder ßinborn.
Diefe JUaffeninduftrie und die Senfenfchmiederei find erlofchen.
Der Cradition nach follen viele Senfenfchmiede nach Salzburg aus-
gewandert fein. CClann das gefchehen ift, ift unbekannt.
ISeben den Bandwaffen wurden wenigftens in fpäterer Zeit auch
Krie g smafchinen in Gmünd hergeftellt. 6s zeugt davon ein
"Vertrag, den Graf Cllricb von KXürttemberg im 'Jahre 1450 mit
dem Stadtwerkmeifter 'Jacob Gifelin in Gmünd abgefcbloffen hat.
Sifelin follte ihm zwei „werfende Bandwerke", mit welchen man
in die Städte und Scblöffer grofse Steine werfen könne, verfertigen
und auch zwei oder drei von feinen Ceuten lehren, wie man folche
Klerke machen und gebrauchen müffe.
3ucb von der "Verfertigung von paternoftern und Ro renkränzen,
auch fSufter genannt, die aus allerlei jviaterialien, als Gagatftein,
Kriftall, Hlabafter, Bolzwerk und verfebiedenen Scbmelzarbeiten ge-
macht wurden, berichtet Gpple. Gin grofser Bändel wurde fpäter
damit getrieben. Die CQaren kamen bis nach Frankreich, Spanien,
Portugal, Italien und "Venedig.* "Von 1433 datiert die urkund-
liche [Notiz, dafs es Hugfteindreber in Gmünd gab. HUem nach
war dies Gewerbe febr bedeutend. 1544 wird erwähnt, dafs aus
der paternoftermacberei und ähnlichen Gewerben jährlich etliche
taufend Gulden erlöft werden, was bei dem hoben JOert des
Geldes eine ziemlich bedeutende Summe war.**
Huch Crufius äufsert Heb über die Gmünder Induftrie des
16. "Jahrhunderts folgendermafsen : „Die vornehmften Bandwerker
find JHäder und Kügleinmacher, die Küglein machen fie aus Kriftall,
Hugftein, Bein und Bolz, dafs man durch die Cöchlein Schnürlein
* Die allerdings nicht ganz zuverlärrige Chronik von epple berichtet über
den ©münder ßandel f olgendermafsen: „69 wurden durch diefen auswärtigen
Verkehr auch viele fremde OTaren nach <5münd eingeführt, zum ßeifpiel Seiden-
zeuge, ©ewürze, <3old, Silber, edeUteine und dergleichen. Sonderlich aber und
da febon in früher Zeit die ßaumwolle Tehr bekannt war, kam auch eine groTsc
Menge dcrrelben nach Gmünd und ernährten fieb viele Ceute, namentlich das
f'rauenvolh, mit ßaumwolleTpinnen, beleben und Schlciermacben „rebr reichlich".
Später als das <U~eben und Schleiermacben aufhörte und das Stricken empor-
kam, dasTclbe nicht nur in der Stadt Gmünd, Tondem auch in den umliegenden
Orten febr ftark betrieben wurde, da Tolcbes ein gar ergiebiger 6rwerbszwcig
beTonders für Kinder und ftleibsbilder war, fand ein bedeutender HbTatz von
dieren Strickereien ins Husland, namentlich nach f>olland und anderen nördlichen
Cändern ftatt."
** Xn der „Cosmograpbie, ßefebreibung aller Cändcr durch Sebaftian
Munfterum, gedruckt zu Bafel durch P)einricb um 1544", betTst es von Gmünd:
6s iTt zu vunferen Zeiten ein grofs Gewerb do vo Crirtallincn, HugTteinen vu
brinen paternofter, deraus jährlich etlich taufend Gulden erlöft werden. Gin
exemplar der Cosmograpbie im HltertumsmuTeum. Xn einer im Hltertums-
mureum weiter befindlichen Kosmograpbcy von Sebaftian fȟnTter 1630 (Citcl-
blatt fehlt) „Hus den erfabreniften Cosmograpben und Gefcbicbtsrcbreibern ge-
zogen und verteutfebt" ift obige ßefebreibung von Gmünd wörtlich abgedruckt.