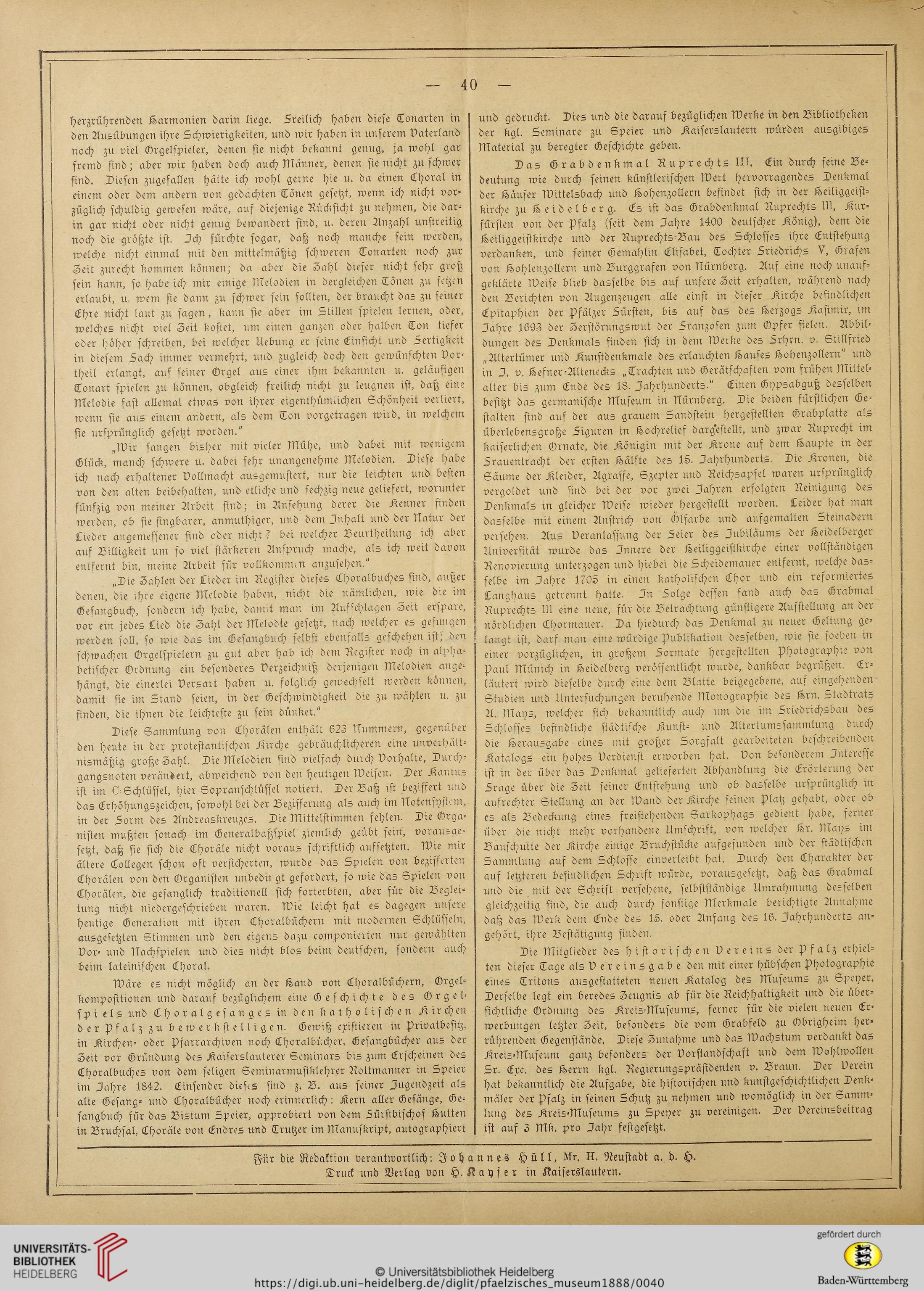— 40 -
herzrührenden Marmornen darin liege, freilich haben diese Tonarten in
den Ausübungen ihre Schwierigkeiten, und wir haben in unserem Vaterland
noch zu viel Orgelspieler, denen sie nicht bekannt genug, ja wohl gar
fremd sind; aber wir haben doch auch Männer, denen sie nicht zu schwer
sind. Diesen zugefallen hätte ich wohl gerne hie u. da einen Lhoral in
einem oder dem andern von gedachten Tönen gesetzt, wenn ich nicht vor-
züglich schuldig gewesen wäre, auf diejenige Rücksicht zu nehmen, die dar-
in gar nicht oder nicht genug bewandert sind, u. deren Anzahl unstreitig
noch die größte ist. Ich fürchte sogar, daß noch manche sein werden,
welche nicht einmal mit den mittelmäßig schweren Tonarten noch zur
Zeit zurecht kommen können; da aber die Zahl dieser nicht sehr groß
sein kann, so habe ich mir einige Melodien in dergleichen Tönen zu setzen
erlaubt, u. wem sie dann zu schwer sein sollten, der braucht das zu seiner
Ehre nicht laut zu sagen, kann sie aber im Stillen spielen lernen, oder,
welches nicht viel Zeit kostet, um einen ganzen oder halben Ton tiefer
oder höher schreiben, bei welcher Hebung er seine Einsicht und Lertigkeit
in diesem Sach immer vermehrt, und zugleich doch den gewünschten Vor-
theil erlangt, auf seiner Grgel aus einer ihm bekannten u. geläufigen
Tonart spielen zu können, obgleich freilich nicht zu leugnen ist, daß eine
Melodie fast allemal etwas von ihrer eigenthünuichen Schönheit verliert,
wenn sie aus einem andern, als dem Ton vorgetragen wird, in welchem
sie ursprünglich gesetzt worden."
„Mir sangen bisher mit vieler Mühe, und dabei mit wenigen!
Glück, manch schwere u. dabei sehr unangenehme Melodien. Diese habe
ich nach erhaltener Vollmacht ausgemustert, nur die leichten und besten
von den alten beibehalten, und etliche und sechzig neue geliefert, worunter
fünfzig von meiner Arbeit sind; in Ansehung derer die Kenner finden
werden, ob sie singbarer, anmuthiger, und dem Inhalt und der Natur der
Lieder angemessener sind oder nicht? bei welcher Beurtheilung ich aber
auf Billigkeit um so viel stärkeren Anspruch mache, als ich weit davon
entfernt bin, meine Arbeit für vollkommen anzusehen."
„Die Zahlen der Lieder im Register dieses Lhoralbuches sind, außer
denen, die ihre eigene Melodie haben, nicht die nämlichen, wie die im
Gesangbuch, sondern ich habe, damit man im Aufschlagen Zeit erspare,
vor ein jedes Lied die Zahl der Melodie gesetzt, nach welcher es gesungen
werden soll, so wie das im Gesangbuch selbst ebenfalls geschehen ist; den
schwachen Orgelspielern zu gut aber hab ich dem Register noch in alpha-
betischer Ordnung ein besonderes Verzeichnis derjenigen Melodien ange-
hängt, die einerlei Versart haben u. folglich gewechselt werden können,
damit sie im Stand seien, in der Geschwindigkeit die zu wählen u. zu
finden, die ihnen die leichteste zu sein dünket."
Diese Sammlung von Ehorälen enthält 622 Nummern, gegenüber
den heute in der protestantischen Lirche gebräuchlicheren eine unverhält-
nismäßig große Zahl. Die Melodien sind vielfach durch Vorhalte, Durch-
gangsnoten verändert, abweichend von den heutigen Meisen. Der Lantus
ist im 0-Schlüssel, hier Sopranschlüssel notiert. Der Baß ist beziffert und
das Erhöhungszeichen, sowohl bei der Bezifferung als auch im Notensystcm,
in der Sorm des Andreaskreuzes. Die Mittelstimmen fehlen. Die Orga-
nisten mußten sonach im Generalbaßspiel ziemlich geübt sein, vorausge-
setzt, daß sie sich die Ehoräle nicht voraus schriftlich aufsetzten. Ivie mir
ältere Eollegen schon oft versicherten, wurde das Spielen von bezifferten
Ehorälen von den Organisten unbedingt gefordert, so wie das Spielen von
Ehorälen, die gesanglich traditionell sich forterbten, aber für die Beglei-
tung nicht niedcrgeschriebcn waren. Mie leicht hat es dagegen unsere
heutige Generation mit ihren Ehoralbüchern mit modernen Schlüsseln,
ausgesetzten Stimmen und den eigens dazu componiertcn nur gewählten
vor- und Nachspielen und dies nicht blos beim deutschen, sondern auch
beim lateinischen Lhoral.
Märe es nicht möglich an der Maud von Ehoralbüchern, Orgel-
kompositionen und darauf bezüglichem eine Geschichte des Grgel-
spi els und L h o r a l g e s a n g e s in den k a l h o l i s eh e n Lirchen
der Pfalz zu bemerk st eiligen. Gewiß existieren in Privatbesitz,
in Lirchen- oder Pfarrarchiven noch Lhoralbücher, Gesangbücher aus der
Zeit vor Gründung des Laiserslauterer Seminars bis zum Erscheinen des
Lhoralbuches von dem seligen Seminarmusiklehrer Rottmanner in Speier
im Jahre 1842. Linsender dicsis sind z. B. aus seiner Jugendzeit als
alte Gesang- und Lhoralbücher noch erinnerlich: Lern aller Gesänge, Ge-
sangbuch für das Bistum Speier, approbiert von dem Sürstbischof Mutten
in Bruchsal, Lhoräle von Endres und Trutzer im Manuskript, autographiert
und gedruckt. Dies und die darauf bezüglichen Merke in den Bibliotheken
der Kgl. Seminare zu Speier und Laiserslautern würden ausgibiges
Material zu beregter Geschichte geben.
Das Grabdenkmal Ruprechts Hl. Lin durch seine Be-
deutung wie durch seinen künstlerischen Mert hervorragendes Denkmal
der Mauser Wittelsbach und Mohenzollern befindet sich in der Meiliggeist-
kirche zu M e i d e l b e r g. Ls ist das Grabdenkmal Ruprechts M, Lur-
fürsten von der Pfalz (seit denr Jahre 1400 deutscher Lönig), dem die
Meiliggeistkirche und der Ruprechts-Bau des Schlosses ihre Entstehung
verdanken, und seiner Gemahlin Llisabet, Tochter Sriedrichs V, Grafen
von Mohlcnzollern und Burggrafen von Nürnberg. Auf eine noch unauf-
geklärte werfe blieb dasselbe bis auf unsere Zeit erhalten, während nach
deir Berichten von Augenzeugen alle einst in dieser Lirche befindlichen
Epitaphien der Pfälzer Sürsten, bis auf das des Merzogs Lasimir, rm
Jahre 1692 der Zerstörungswut der Sranzosen zum Opfer fielen. Abbil-
dungen des Denkmals finden sich in denr Merke des Srhrn. v. Stillfried
„Altertümer und Lunstdenkmale des erlauchten Mauses Mohenzollern" und
in I. v. Mefner-Altenccks „Trachten und Gerätschaften vom frühen Mittel-
alter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts." Lrnen Gypsabguß desselben
besitzt das germanische Museum in Nürnberg. Die beiden fürstlichen Ge-
stalten siird auf der aus grauem Sandstein hergestellten Grabplatte als
überlebensgroße Siguren in Mochrelief darg'estellt, und zwar Ruprecht im
kaiserlichere Ornate, die Lönigrn mit der Lrone auf dem Maupte in der
Srauentracht der ersten Mälfte des 1Z. Jahrhunderts. Die Lronen, die
Säume der Lleider, Agraffe, Szepter und Reichsapfel waren ursprünglich
vergoldet und sind bei der vor zwei Jahren erfolgten Reinigung des
Denkmals in gleicher Meise wieder hergestellt worden. Leider hat man
dasselbe mit einem Anstrich von Ölfarbe und aufgernalten Steinadern
versehen. Aus Veranlassung der Seier des Jubiläums der Meidelberger
Universität wurde das Innere der Meiliggeistkirche einer vollständigen
Renovierung unterzogen und hiebei die Scheidemauer entfernt, welche das-
selbe im Jahre 17OÖ in einen katholischen Lhor und ein reformiertes
Langhaus getrennt hatte. In Solge dessen fand auch das Grabmal
Ruprechts M eine neue, für die Betrachtung günstigere Aufstellung an der
! nördlichen Lhormauer. Da hiedurch das Denkmal zu neuer Geltung ge-
langt ist, darf man eine würdige Publikation desselben, wie sie soeben in
einer vorzüglichen, in großen! Sormate hergestcllten Photographie von
Paul Münich in Meidelberg veröffentlicht wurde, dankbar begrüßen. Er-
läutert wird dieselbe durch eine dein Blatte beigegebene, auf eingehenden
Studien und Untersuchungen beruhende Monographie des Mrn. Stadtrats
A. Mays, welcher sich bekanntlich auch um die im Sriedrichsbau des
Schlosses befindliche städtische Lunst- und Altertumssammlung durch
die Merausgabe eines mit großer Sorgfalt gearbeiteten beschreibenden
Latalogs ein hohes Verdienst erworben hat. von besonderen! Interesse
ist in der über das Denkmal gelieferten Abhandlung die Erörterung der
Srage über die Zeit seiner Entstehung und ob dasselbe ursprünglich in
aufrechter Stellung an der wand der Lirche seinen Platz gehabt, oder ob
es als Bedeckung eines freistehenden Sarkophags gedient habe, ferner
über die nicht mehr vorhandene Umschrift, von welcher Mr. Mays im
Bauschutte der Lirche einige Bruchstücke aufgefunden und der städtischen
Sammlung auf dem Schlosse einverleibt hat. Durch den Charakter der
auf letzteren befindlichen Schrift würde, vorausgesetzt, daß das Grabmal
und die mit der Schrift versehene, selbstständige Umrahmung desselben
gleichzeitig sind, die auch durch sonstige Merkmale berichtigte Annahme
daß das Merk dein Ende des 1Z. oder Anfang des 16. Jahrhunderts an-
gehört, ihre Bestätigung finden.
Die Mitglieder des historischen Vereins der Pfalz erhiel-
ten dieser Tage als v e r e i n s g a b e den mit einer hübschen Photographie
eines Tritons ausgestattetcn neuen Latalog des Museums zu Speyer.
Derselbe legt ein beredes Zeugnis ab für die Reichhaltigkeit und die über-
sichtliche Ordnung des Lreis>Museums, ferner für die vielen neuen Er-
werbungen letzter Zeit, besonders die vom Grabfeld zu Obrigheim her-
rührenden Gegenstände. Diese Zunahme und das Wachstum verdankt das
Lreis-Museum ganz besonders der Vorstandschaft und dem Wohlwollen
Sr. Exc. des Merrn Kgl. Regierungspräsidenten v. Braun. Der Verein
hat bekanntlich die Aufgabe, die historischen und kunstgeschichtlichen Denk-
mäler der Pfalz in seinen Schutz zu nehmen und womöglich in der Samm-
lung des Lreis-Museums zu Speyer zu vereinigen. Der vereinsbeitrag
ist auf Z Mk. pro Jahr festgesetzt.
Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Hüll, LIr. H. Neustadt a. d. H.
Druck und Verlag von H. K a h s e r in Kaiserslautern.
herzrührenden Marmornen darin liege, freilich haben diese Tonarten in
den Ausübungen ihre Schwierigkeiten, und wir haben in unserem Vaterland
noch zu viel Orgelspieler, denen sie nicht bekannt genug, ja wohl gar
fremd sind; aber wir haben doch auch Männer, denen sie nicht zu schwer
sind. Diesen zugefallen hätte ich wohl gerne hie u. da einen Lhoral in
einem oder dem andern von gedachten Tönen gesetzt, wenn ich nicht vor-
züglich schuldig gewesen wäre, auf diejenige Rücksicht zu nehmen, die dar-
in gar nicht oder nicht genug bewandert sind, u. deren Anzahl unstreitig
noch die größte ist. Ich fürchte sogar, daß noch manche sein werden,
welche nicht einmal mit den mittelmäßig schweren Tonarten noch zur
Zeit zurecht kommen können; da aber die Zahl dieser nicht sehr groß
sein kann, so habe ich mir einige Melodien in dergleichen Tönen zu setzen
erlaubt, u. wem sie dann zu schwer sein sollten, der braucht das zu seiner
Ehre nicht laut zu sagen, kann sie aber im Stillen spielen lernen, oder,
welches nicht viel Zeit kostet, um einen ganzen oder halben Ton tiefer
oder höher schreiben, bei welcher Hebung er seine Einsicht und Lertigkeit
in diesem Sach immer vermehrt, und zugleich doch den gewünschten Vor-
theil erlangt, auf seiner Grgel aus einer ihm bekannten u. geläufigen
Tonart spielen zu können, obgleich freilich nicht zu leugnen ist, daß eine
Melodie fast allemal etwas von ihrer eigenthünuichen Schönheit verliert,
wenn sie aus einem andern, als dem Ton vorgetragen wird, in welchem
sie ursprünglich gesetzt worden."
„Mir sangen bisher mit vieler Mühe, und dabei mit wenigen!
Glück, manch schwere u. dabei sehr unangenehme Melodien. Diese habe
ich nach erhaltener Vollmacht ausgemustert, nur die leichten und besten
von den alten beibehalten, und etliche und sechzig neue geliefert, worunter
fünfzig von meiner Arbeit sind; in Ansehung derer die Kenner finden
werden, ob sie singbarer, anmuthiger, und dem Inhalt und der Natur der
Lieder angemessener sind oder nicht? bei welcher Beurtheilung ich aber
auf Billigkeit um so viel stärkeren Anspruch mache, als ich weit davon
entfernt bin, meine Arbeit für vollkommen anzusehen."
„Die Zahlen der Lieder im Register dieses Lhoralbuches sind, außer
denen, die ihre eigene Melodie haben, nicht die nämlichen, wie die im
Gesangbuch, sondern ich habe, damit man im Aufschlagen Zeit erspare,
vor ein jedes Lied die Zahl der Melodie gesetzt, nach welcher es gesungen
werden soll, so wie das im Gesangbuch selbst ebenfalls geschehen ist; den
schwachen Orgelspielern zu gut aber hab ich dem Register noch in alpha-
betischer Ordnung ein besonderes Verzeichnis derjenigen Melodien ange-
hängt, die einerlei Versart haben u. folglich gewechselt werden können,
damit sie im Stand seien, in der Geschwindigkeit die zu wählen u. zu
finden, die ihnen die leichteste zu sein dünket."
Diese Sammlung von Ehorälen enthält 622 Nummern, gegenüber
den heute in der protestantischen Lirche gebräuchlicheren eine unverhält-
nismäßig große Zahl. Die Melodien sind vielfach durch Vorhalte, Durch-
gangsnoten verändert, abweichend von den heutigen Meisen. Der Lantus
ist im 0-Schlüssel, hier Sopranschlüssel notiert. Der Baß ist beziffert und
das Erhöhungszeichen, sowohl bei der Bezifferung als auch im Notensystcm,
in der Sorm des Andreaskreuzes. Die Mittelstimmen fehlen. Die Orga-
nisten mußten sonach im Generalbaßspiel ziemlich geübt sein, vorausge-
setzt, daß sie sich die Ehoräle nicht voraus schriftlich aufsetzten. Ivie mir
ältere Eollegen schon oft versicherten, wurde das Spielen von bezifferten
Ehorälen von den Organisten unbedingt gefordert, so wie das Spielen von
Ehorälen, die gesanglich traditionell sich forterbten, aber für die Beglei-
tung nicht niedcrgeschriebcn waren. Mie leicht hat es dagegen unsere
heutige Generation mit ihren Ehoralbüchern mit modernen Schlüsseln,
ausgesetzten Stimmen und den eigens dazu componiertcn nur gewählten
vor- und Nachspielen und dies nicht blos beim deutschen, sondern auch
beim lateinischen Lhoral.
Märe es nicht möglich an der Maud von Ehoralbüchern, Orgel-
kompositionen und darauf bezüglichem eine Geschichte des Grgel-
spi els und L h o r a l g e s a n g e s in den k a l h o l i s eh e n Lirchen
der Pfalz zu bemerk st eiligen. Gewiß existieren in Privatbesitz,
in Lirchen- oder Pfarrarchiven noch Lhoralbücher, Gesangbücher aus der
Zeit vor Gründung des Laiserslauterer Seminars bis zum Erscheinen des
Lhoralbuches von dem seligen Seminarmusiklehrer Rottmanner in Speier
im Jahre 1842. Linsender dicsis sind z. B. aus seiner Jugendzeit als
alte Gesang- und Lhoralbücher noch erinnerlich: Lern aller Gesänge, Ge-
sangbuch für das Bistum Speier, approbiert von dem Sürstbischof Mutten
in Bruchsal, Lhoräle von Endres und Trutzer im Manuskript, autographiert
und gedruckt. Dies und die darauf bezüglichen Merke in den Bibliotheken
der Kgl. Seminare zu Speier und Laiserslautern würden ausgibiges
Material zu beregter Geschichte geben.
Das Grabdenkmal Ruprechts Hl. Lin durch seine Be-
deutung wie durch seinen künstlerischen Mert hervorragendes Denkmal
der Mauser Wittelsbach und Mohenzollern befindet sich in der Meiliggeist-
kirche zu M e i d e l b e r g. Ls ist das Grabdenkmal Ruprechts M, Lur-
fürsten von der Pfalz (seit denr Jahre 1400 deutscher Lönig), dem die
Meiliggeistkirche und der Ruprechts-Bau des Schlosses ihre Entstehung
verdanken, und seiner Gemahlin Llisabet, Tochter Sriedrichs V, Grafen
von Mohlcnzollern und Burggrafen von Nürnberg. Auf eine noch unauf-
geklärte werfe blieb dasselbe bis auf unsere Zeit erhalten, während nach
deir Berichten von Augenzeugen alle einst in dieser Lirche befindlichen
Epitaphien der Pfälzer Sürsten, bis auf das des Merzogs Lasimir, rm
Jahre 1692 der Zerstörungswut der Sranzosen zum Opfer fielen. Abbil-
dungen des Denkmals finden sich in denr Merke des Srhrn. v. Stillfried
„Altertümer und Lunstdenkmale des erlauchten Mauses Mohenzollern" und
in I. v. Mefner-Altenccks „Trachten und Gerätschaften vom frühen Mittel-
alter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts." Lrnen Gypsabguß desselben
besitzt das germanische Museum in Nürnberg. Die beiden fürstlichen Ge-
stalten siird auf der aus grauem Sandstein hergestellten Grabplatte als
überlebensgroße Siguren in Mochrelief darg'estellt, und zwar Ruprecht im
kaiserlichere Ornate, die Lönigrn mit der Lrone auf dem Maupte in der
Srauentracht der ersten Mälfte des 1Z. Jahrhunderts. Die Lronen, die
Säume der Lleider, Agraffe, Szepter und Reichsapfel waren ursprünglich
vergoldet und sind bei der vor zwei Jahren erfolgten Reinigung des
Denkmals in gleicher Meise wieder hergestellt worden. Leider hat man
dasselbe mit einem Anstrich von Ölfarbe und aufgernalten Steinadern
versehen. Aus Veranlassung der Seier des Jubiläums der Meidelberger
Universität wurde das Innere der Meiliggeistkirche einer vollständigen
Renovierung unterzogen und hiebei die Scheidemauer entfernt, welche das-
selbe im Jahre 17OÖ in einen katholischen Lhor und ein reformiertes
Langhaus getrennt hatte. In Solge dessen fand auch das Grabmal
Ruprechts M eine neue, für die Betrachtung günstigere Aufstellung an der
! nördlichen Lhormauer. Da hiedurch das Denkmal zu neuer Geltung ge-
langt ist, darf man eine würdige Publikation desselben, wie sie soeben in
einer vorzüglichen, in großen! Sormate hergestcllten Photographie von
Paul Münich in Meidelberg veröffentlicht wurde, dankbar begrüßen. Er-
läutert wird dieselbe durch eine dein Blatte beigegebene, auf eingehenden
Studien und Untersuchungen beruhende Monographie des Mrn. Stadtrats
A. Mays, welcher sich bekanntlich auch um die im Sriedrichsbau des
Schlosses befindliche städtische Lunst- und Altertumssammlung durch
die Merausgabe eines mit großer Sorgfalt gearbeiteten beschreibenden
Latalogs ein hohes Verdienst erworben hat. von besonderen! Interesse
ist in der über das Denkmal gelieferten Abhandlung die Erörterung der
Srage über die Zeit seiner Entstehung und ob dasselbe ursprünglich in
aufrechter Stellung an der wand der Lirche seinen Platz gehabt, oder ob
es als Bedeckung eines freistehenden Sarkophags gedient habe, ferner
über die nicht mehr vorhandene Umschrift, von welcher Mr. Mays im
Bauschutte der Lirche einige Bruchstücke aufgefunden und der städtischen
Sammlung auf dem Schlosse einverleibt hat. Durch den Charakter der
auf letzteren befindlichen Schrift würde, vorausgesetzt, daß das Grabmal
und die mit der Schrift versehene, selbstständige Umrahmung desselben
gleichzeitig sind, die auch durch sonstige Merkmale berichtigte Annahme
daß das Merk dein Ende des 1Z. oder Anfang des 16. Jahrhunderts an-
gehört, ihre Bestätigung finden.
Die Mitglieder des historischen Vereins der Pfalz erhiel-
ten dieser Tage als v e r e i n s g a b e den mit einer hübschen Photographie
eines Tritons ausgestattetcn neuen Latalog des Museums zu Speyer.
Derselbe legt ein beredes Zeugnis ab für die Reichhaltigkeit und die über-
sichtliche Ordnung des Lreis>Museums, ferner für die vielen neuen Er-
werbungen letzter Zeit, besonders die vom Grabfeld zu Obrigheim her-
rührenden Gegenstände. Diese Zunahme und das Wachstum verdankt das
Lreis-Museum ganz besonders der Vorstandschaft und dem Wohlwollen
Sr. Exc. des Merrn Kgl. Regierungspräsidenten v. Braun. Der Verein
hat bekanntlich die Aufgabe, die historischen und kunstgeschichtlichen Denk-
mäler der Pfalz in seinen Schutz zu nehmen und womöglich in der Samm-
lung des Lreis-Museums zu Speyer zu vereinigen. Der vereinsbeitrag
ist auf Z Mk. pro Jahr festgesetzt.
Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Hüll, LIr. H. Neustadt a. d. H.
Druck und Verlag von H. K a h s e r in Kaiserslautern.