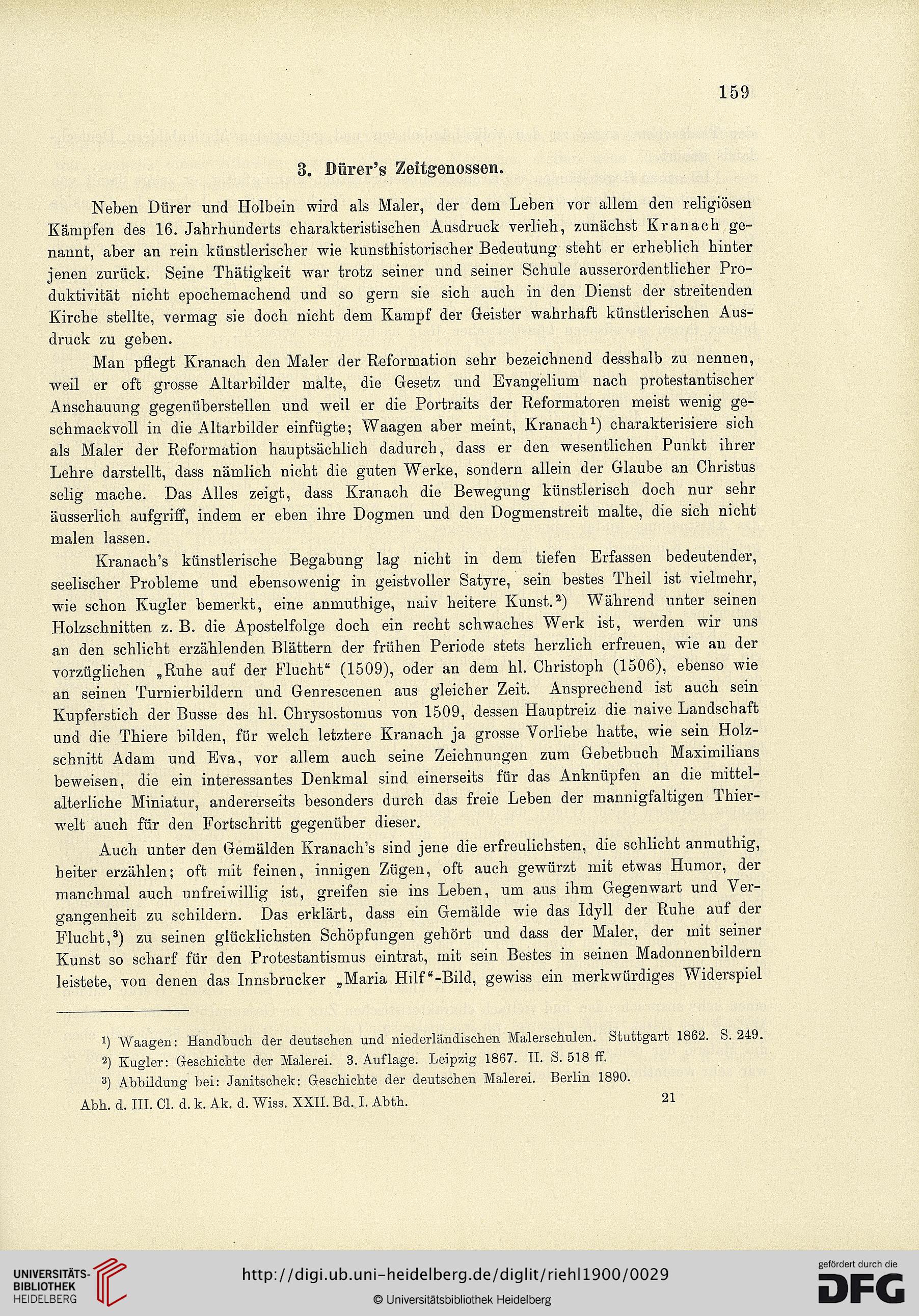159
3. Dürer's Zeitgenossen.
Neben Dürer und Holbein wird als Maler, der dem Leben vor allem den religiösen
Kämpfen des 16. Jahrhunderts charakteristischen Ausdruck verlieh, zunächst Kranach ge-
nannt, aber an rein künstlerischer wie kunsthistorischer Bedeutung steht er erheblich hinter
jenen zurück. Seine Thätigkeit war trotz seiner und seiner Schule ausserordentlicher Pro-
duktivität nicht epochemachend und so gern sie sich auch in den Dienst der streitenden
Kirche stellte, vermag sie doch nicht dem Kampf der Geister wahrhaft künstlerischen Aus-
druck zu geben.
Man pflegt Kranach den Maler der Reformation sehr bezeichnend desshalb zu nennen,
weil er oft grosse Altarbilder malte, die Gesetz und Evangelium nach protestantischer
Anschauung gegenüberstellen und weil er die Portraits der Reformatoren meist wenig ge-
schmackvoll in die Altarbilder einfügte; Waagen aber meint, Kranach^) charakterisiere sich
als Maler der Reformation hauptsächlich dadurch, dass er den wesentlichen Punkt ihrer
Lehre darstellt, dass nämlich nicht die guten Werke, sondern allein der Glaube an Christus
selig mache. Das Alles zeigt, dass Kranach die Bewegung künstlerisch doch nur sehr
äusserlich aufgriff, indem er eben ihre Dogmen und den Dogmenstreit malte, die sich nicht
malen lassen.
Kranach's künstlerische Begabung lag nicht in dem tiefen Erfassen bedeutender,
seelischer Probleme und ebensowenig in geistvoller Satyre, sein bestes Theil ist vielmehr,
wie schon Kugler bemerkt, eine anmuthige, naiv heitere Kunst A) Während unter seinen
Holzschnitten z. B. die Apostelfolge doch ein recht schwaches Werk ist, werden wir uns
an den schlicht erzählenden Blättern der frühen Periode stets herzlich erfreuen, wie an der
vorzüglichen „Ruhe auf der Flucht" (1509), oder an dem hl. Christoph (1506), ebenso wie
an seinen Turnierbildern und Genrescenen aus gleicher Zeit. Ansprechend ist auch sein
Kupferstich der Busse des hl. Chrysostomus von 1509, dessen Hauptreiz die naive Landschaft
und die Thiere bilden, für welch letztere Kranach ja grosse Vorliebe hatte, wie sein Holz-
schnitt Adam und Eva, vor allem auch seine Zeichnungen zum Gebetbuch Maximilians
beweisen, die ein interessantes Denkmal sind einerseits für das Anknüpfen an die mittel-
alterliche Miniatur, andererseits besonders durch das freie Leben der mannigfaltigen Thier-
welt auch für den Fortschritt gegenüber dieser.
Auch unter den Gemälden Kranach's sind jene die erfreulichsten, die schlicht anmuthig,
heiter erzählen; oft mit feinen, innigen Zügen, oft auch gewürzt mit etwas Humor, der
manchmal auch unfreiwillig ist, greifen sie ins Leben, um aus ihm Gegenwart und Ver-
gangenheit zu schildern. Das erklärt, dass ein Gemälde wie das Idyll der Ruhe auf der
Flucht,3) zu seinen glücklichsten Schöpfungen gehört und dass der Maler, der mit seiner
Kunst so scharf für den Protestantismus eintrat, mit sein Bestes in seinen Madonnenbildern
leistete, von denen das Innsbrucker „Maria Hilf "-Bild, gewiss ein merkwürdiges Widerspiel
9 Waagen: Handbuch der deutschen und niederländischen Malersehulen. Stuttgart 1862. S. 249.
2) Kugler: Geschichte der Malerei. 3. Auflage. Leipzig 1867. II. S. 518 tf.
3) Abbildung bei: Janitschek: Geschichte der deutschen Malerei. Berlin 1890.
Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XXII. Bd. I. Abth.
21
3. Dürer's Zeitgenossen.
Neben Dürer und Holbein wird als Maler, der dem Leben vor allem den religiösen
Kämpfen des 16. Jahrhunderts charakteristischen Ausdruck verlieh, zunächst Kranach ge-
nannt, aber an rein künstlerischer wie kunsthistorischer Bedeutung steht er erheblich hinter
jenen zurück. Seine Thätigkeit war trotz seiner und seiner Schule ausserordentlicher Pro-
duktivität nicht epochemachend und so gern sie sich auch in den Dienst der streitenden
Kirche stellte, vermag sie doch nicht dem Kampf der Geister wahrhaft künstlerischen Aus-
druck zu geben.
Man pflegt Kranach den Maler der Reformation sehr bezeichnend desshalb zu nennen,
weil er oft grosse Altarbilder malte, die Gesetz und Evangelium nach protestantischer
Anschauung gegenüberstellen und weil er die Portraits der Reformatoren meist wenig ge-
schmackvoll in die Altarbilder einfügte; Waagen aber meint, Kranach^) charakterisiere sich
als Maler der Reformation hauptsächlich dadurch, dass er den wesentlichen Punkt ihrer
Lehre darstellt, dass nämlich nicht die guten Werke, sondern allein der Glaube an Christus
selig mache. Das Alles zeigt, dass Kranach die Bewegung künstlerisch doch nur sehr
äusserlich aufgriff, indem er eben ihre Dogmen und den Dogmenstreit malte, die sich nicht
malen lassen.
Kranach's künstlerische Begabung lag nicht in dem tiefen Erfassen bedeutender,
seelischer Probleme und ebensowenig in geistvoller Satyre, sein bestes Theil ist vielmehr,
wie schon Kugler bemerkt, eine anmuthige, naiv heitere Kunst A) Während unter seinen
Holzschnitten z. B. die Apostelfolge doch ein recht schwaches Werk ist, werden wir uns
an den schlicht erzählenden Blättern der frühen Periode stets herzlich erfreuen, wie an der
vorzüglichen „Ruhe auf der Flucht" (1509), oder an dem hl. Christoph (1506), ebenso wie
an seinen Turnierbildern und Genrescenen aus gleicher Zeit. Ansprechend ist auch sein
Kupferstich der Busse des hl. Chrysostomus von 1509, dessen Hauptreiz die naive Landschaft
und die Thiere bilden, für welch letztere Kranach ja grosse Vorliebe hatte, wie sein Holz-
schnitt Adam und Eva, vor allem auch seine Zeichnungen zum Gebetbuch Maximilians
beweisen, die ein interessantes Denkmal sind einerseits für das Anknüpfen an die mittel-
alterliche Miniatur, andererseits besonders durch das freie Leben der mannigfaltigen Thier-
welt auch für den Fortschritt gegenüber dieser.
Auch unter den Gemälden Kranach's sind jene die erfreulichsten, die schlicht anmuthig,
heiter erzählen; oft mit feinen, innigen Zügen, oft auch gewürzt mit etwas Humor, der
manchmal auch unfreiwillig ist, greifen sie ins Leben, um aus ihm Gegenwart und Ver-
gangenheit zu schildern. Das erklärt, dass ein Gemälde wie das Idyll der Ruhe auf der
Flucht,3) zu seinen glücklichsten Schöpfungen gehört und dass der Maler, der mit seiner
Kunst so scharf für den Protestantismus eintrat, mit sein Bestes in seinen Madonnenbildern
leistete, von denen das Innsbrucker „Maria Hilf "-Bild, gewiss ein merkwürdiges Widerspiel
9 Waagen: Handbuch der deutschen und niederländischen Malersehulen. Stuttgart 1862. S. 249.
2) Kugler: Geschichte der Malerei. 3. Auflage. Leipzig 1867. II. S. 518 tf.
3) Abbildung bei: Janitschek: Geschichte der deutschen Malerei. Berlin 1890.
Abh. d. III. CI. d. k. Ak. d. Wiss. XXII. Bd. I. Abth.
21