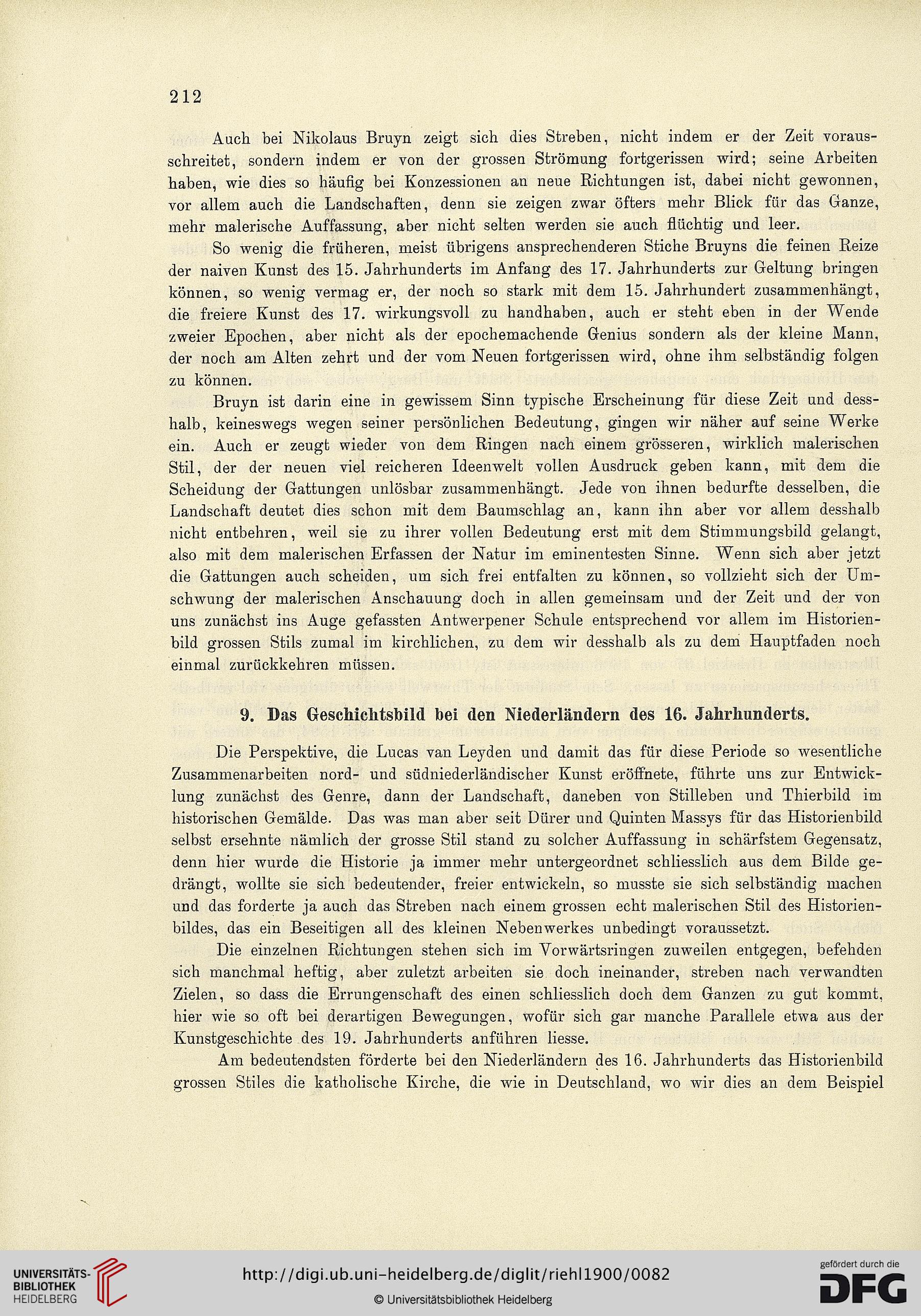212
Auch bei Nikolaus Bruyn zeigt sich dies Streben, nicht indem er der Zeit voraus-
schreitet, sondern indem er von der grossen Strömung fortgerissen wird; seine Arbeiten
haben, wie dies so häufig bei Konzessionen an neue Richtungen ist, dabei nicht gewonnen,
vor allem auch die Landschaften, denn sie zeigen zwar öfters mehr Blick für das Ganze,
mehr malerische Auffassung, aber nicht selten werden sie auch flüchtig und leer.
So wenig die früheren, meist übrigens ansprechenderen Stiche Bruyns die feinen Reize
der naiven Kunst des 15. Jahrhunderts im Anfang des 17. Jahrhunderts zur Geltung bringen
können, so wenig vermag er, der noch so stark mit dem 15. Jahrhundert zusammenhängt,
die freiere Kunst des 17. wirkungsvoll zu handhaben, auch er steht eben in der Wende
zweier Epochen, aber nicht als der epochemachende Genius sondern als der kleine Mann,
der noch am Alten zehrt und der vom Neuen fortgerissen wird, ohne ihm selbständig folgen
zu können.
Bruyn ist darin eine in gewissem Sinn typische Erscheinung für diese Zeit und dess-
halb, keineswegs wegen seiner persönlichen Bedeutung, gingen wir näher auf seine Werke
ein. Auch er zeugt wieder von dem Ringen nach einem grösseren, wirklich malerischen
Stil, der der neuen viel reicheren Ideenwelt vollen Ausdruck geben kann, mit dem die
Scheidung der Gattungen unlösbar zusammenhängt. Jede von ihnen bedurfte desselben, die
Landschaft deutet dies schon mit dem Baumschlag an, kann ihn aber vor allem desshalb
nicht entbehren, weil sie zu ihrer vollen Bedeutung erst mit dem Stimmungsbild gelangt,
also mit dem malerischen Erfassen der Natur im eminentesten Sinne. Wenn sich aber jetzt
die Gattungen auch scheiden, um sich frei entfalten zu können, so vollzieht sich der Um-
schwung der malerischen Anschauung doch in allen gemeinsam und der Zeit und der von
uns zunächst ins Auge gefassten Antwerpener Schule entsprechend vor allem im Historien-
bild grossen Stils zumal im kirchlichen, zu dem wir desshalb als zu dem Hauptfaden noch
einmal zurückkehren müssen.
9. Das Geschichtsbild bei den Niederländern des 16. Jahrhunderts.
Die Perspektive, die Lucas van Leyden und damit das für diese Periode so wesentliche
Zusammenarbeiten nord- und südniederländischer Kunst eröffnete, führte uns zur Entwick-
lung zunächst des Genre, dann der Landschaft, daneben von Stilleben und Thierbild im
historischen Gemälde. Das was man aber seit Dürer und Quinten Massys für das Historienbild
selbst ersehnte nämlich der grosse Stil stand zu solcher Auffassung in schärfstem Gegensatz,
denn hier wurde die Historie ja immer mehr untergeordnet schliesslich aus dem Bilde ge-
drängt, wollte sie sich bedeutender, freier entwickeln, so musste sie sich selbständig machen
und das forderte ja auch das Streben nach einem grossen echt malerischen Stil des Historien-
bildes, das ein Beseitigen all des kleinen Nebenwerkes unbedingt voraussetzt.
Die einzelnen Richtungen stehen sich im Vorwärtsringen zuweilen entgegen, befehden
sich manchmal heftig, aber zuletzt arbeiten sie doch ineinander, streben nach verwandten
Zielen, so dass die Errungenschaft des einen schliesslich doch dem Ganzen zu gut kommt,
hier wie so oft bei derartigen Bewegungen, wofür sich gar manche Parallele etwa aus der
Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts anführen Hesse.
Am bedeutendsten förderte bei den Niederländern des 16. Jahrhunderts das Historienbild
grossen Stiles die katholische Kirche, die wie in Deutschland, wo wir dies an dem Beispiel
Auch bei Nikolaus Bruyn zeigt sich dies Streben, nicht indem er der Zeit voraus-
schreitet, sondern indem er von der grossen Strömung fortgerissen wird; seine Arbeiten
haben, wie dies so häufig bei Konzessionen an neue Richtungen ist, dabei nicht gewonnen,
vor allem auch die Landschaften, denn sie zeigen zwar öfters mehr Blick für das Ganze,
mehr malerische Auffassung, aber nicht selten werden sie auch flüchtig und leer.
So wenig die früheren, meist übrigens ansprechenderen Stiche Bruyns die feinen Reize
der naiven Kunst des 15. Jahrhunderts im Anfang des 17. Jahrhunderts zur Geltung bringen
können, so wenig vermag er, der noch so stark mit dem 15. Jahrhundert zusammenhängt,
die freiere Kunst des 17. wirkungsvoll zu handhaben, auch er steht eben in der Wende
zweier Epochen, aber nicht als der epochemachende Genius sondern als der kleine Mann,
der noch am Alten zehrt und der vom Neuen fortgerissen wird, ohne ihm selbständig folgen
zu können.
Bruyn ist darin eine in gewissem Sinn typische Erscheinung für diese Zeit und dess-
halb, keineswegs wegen seiner persönlichen Bedeutung, gingen wir näher auf seine Werke
ein. Auch er zeugt wieder von dem Ringen nach einem grösseren, wirklich malerischen
Stil, der der neuen viel reicheren Ideenwelt vollen Ausdruck geben kann, mit dem die
Scheidung der Gattungen unlösbar zusammenhängt. Jede von ihnen bedurfte desselben, die
Landschaft deutet dies schon mit dem Baumschlag an, kann ihn aber vor allem desshalb
nicht entbehren, weil sie zu ihrer vollen Bedeutung erst mit dem Stimmungsbild gelangt,
also mit dem malerischen Erfassen der Natur im eminentesten Sinne. Wenn sich aber jetzt
die Gattungen auch scheiden, um sich frei entfalten zu können, so vollzieht sich der Um-
schwung der malerischen Anschauung doch in allen gemeinsam und der Zeit und der von
uns zunächst ins Auge gefassten Antwerpener Schule entsprechend vor allem im Historien-
bild grossen Stils zumal im kirchlichen, zu dem wir desshalb als zu dem Hauptfaden noch
einmal zurückkehren müssen.
9. Das Geschichtsbild bei den Niederländern des 16. Jahrhunderts.
Die Perspektive, die Lucas van Leyden und damit das für diese Periode so wesentliche
Zusammenarbeiten nord- und südniederländischer Kunst eröffnete, führte uns zur Entwick-
lung zunächst des Genre, dann der Landschaft, daneben von Stilleben und Thierbild im
historischen Gemälde. Das was man aber seit Dürer und Quinten Massys für das Historienbild
selbst ersehnte nämlich der grosse Stil stand zu solcher Auffassung in schärfstem Gegensatz,
denn hier wurde die Historie ja immer mehr untergeordnet schliesslich aus dem Bilde ge-
drängt, wollte sie sich bedeutender, freier entwickeln, so musste sie sich selbständig machen
und das forderte ja auch das Streben nach einem grossen echt malerischen Stil des Historien-
bildes, das ein Beseitigen all des kleinen Nebenwerkes unbedingt voraussetzt.
Die einzelnen Richtungen stehen sich im Vorwärtsringen zuweilen entgegen, befehden
sich manchmal heftig, aber zuletzt arbeiten sie doch ineinander, streben nach verwandten
Zielen, so dass die Errungenschaft des einen schliesslich doch dem Ganzen zu gut kommt,
hier wie so oft bei derartigen Bewegungen, wofür sich gar manche Parallele etwa aus der
Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts anführen Hesse.
Am bedeutendsten förderte bei den Niederländern des 16. Jahrhunderts das Historienbild
grossen Stiles die katholische Kirche, die wie in Deutschland, wo wir dies an dem Beispiel