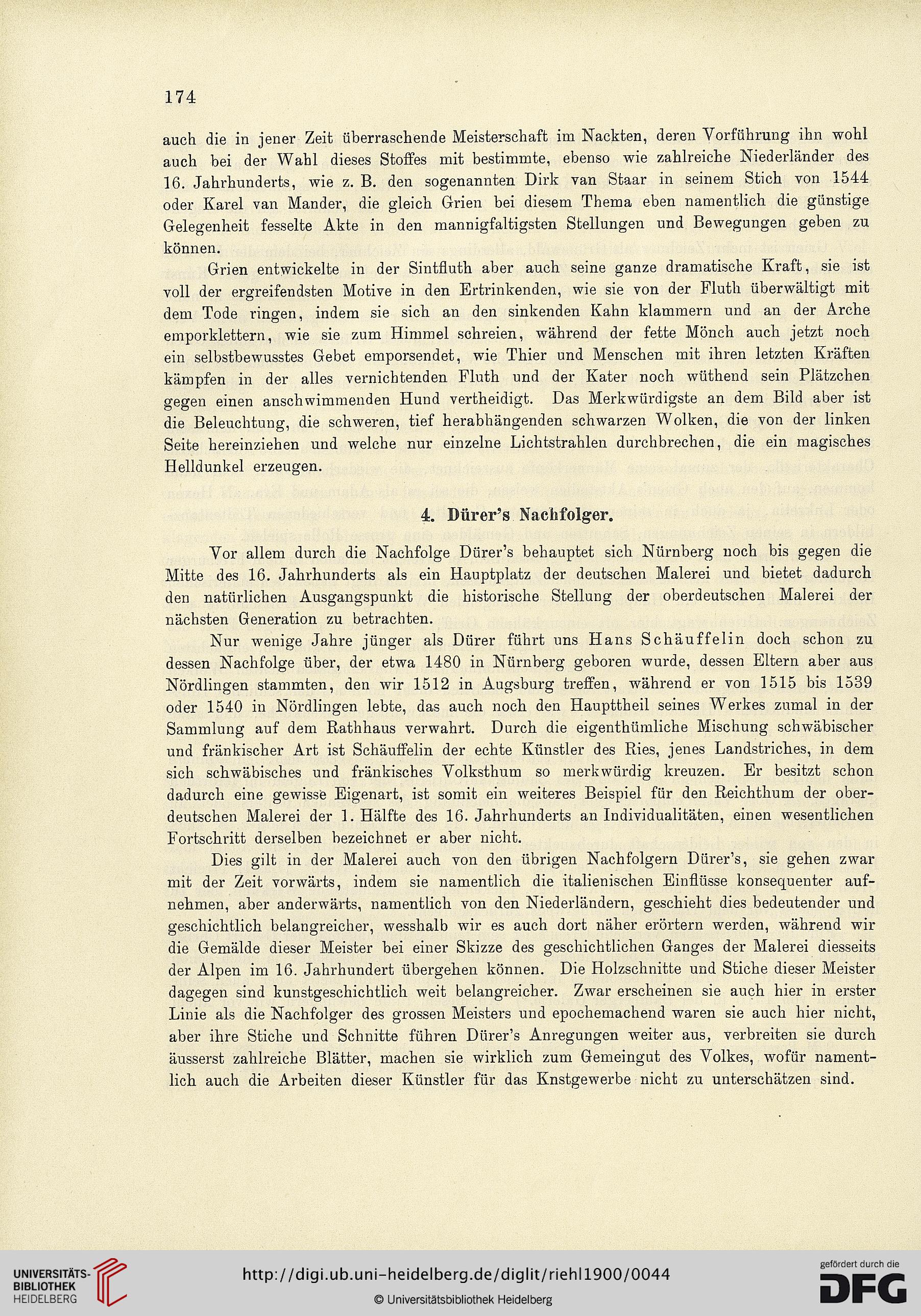174
auch die in jener Zeit überraschende Meisterschaft im Nackten, deren Vorführung ihn wohl
auch bei der Wahl dieses Stoffes mit bestimmte, ebenso wie zahlreiche Niederländer des
16. Jahrhunderts, wie z. B. den sogenannten Dirk van Staar in seinem Stich von 1544
oder Karel van Mander, die gleich Grien bei diesem Thema eben namentlich die günstige
Gelegenheit fesselte Akte in den mannigfaltigsten Stellungen und Bewegungen geben zu
können.
Grien entwickelte in der Sinthuth aber auch seine ganze dramatische Kraft, sie ist
voll der ergreifendsten Motive in den Ertrinkenden, wie sie von der Fluth überwältigt mit
dem Tode ringen, indem sie sich an den sinkenden Kahn klammern und an der Arche
emporklettern, wie sie zum Himmel schreien, während der fette Mönch auch jetzt noch
ein selbstbewusstes Gebet emporsendet, wie Thier und Menschen mit ihren letzten Kräften
kämpfen in der alles vernichtenden Fluth und der Kater noch wüthend sein Plätzchen
gegen einen anschwimmenden Hund vertheidigt. Das Merkwürdigste an dem Bild aber ist
die Beleuchtung, die schweren, tief herabhängenden schwarzen Wolken, die von der linken
Seite hereinziehen und welche nur einzelne Lichtstrahlen durchbrechen, die ein magisches
Helldunkel erzeugen.
4. Dürer's Nachfolger.
Vor allem durch die Nachfolge Dürer's behauptet sich Nürnberg noch bis gegen die
Mitte des 16. Jahrhunderts als ein Hauptplatz der deutschen Malerei und bietet dadurch
den natürlichen Ausgangspunkt die historische Stellung der oberdeutschen Malerei der
nächsten Generation zu betrachten.
Nur wenige Jahre jünger als Dürer führt uns Hans Schäuffelin doch schon zu
dessen Nachfolge über, der etwa 1480 in Nürnberg geboren wurde, dessen Eltern aber aus
Nördlingen stammten, den wir 1512 in Augsburg treffen, während er von 1515 bis 1539
oder 1540 in Nördlingen lebte, das auch noch den Haupttheil seines Werkes zumal in der
Sammlung auf dem Rathhaus verwahrt. Durch die eigentümliche Mischung schwäbischer
und fränkischer Art ist Schäuffelin der echte Künstler des Ries, jenes Landstriches, in dem
sich schwäbisches und fränkisches Volksthum so merkwürdig kreuzen. Er besitzt schon
dadurch eine gewisse Eigenart, ist somit ein weiteres Beispiel für den Reichthum der ober-
deutschen Malerei der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts an Individualitäten, einen wesentlichen
Fortschritt derselben bezeichnet er aber nicht.
Dies gilt in der Malerei auch von den übrigen Nachfolgern Dürer's, sie gehen zwar
mit der Zeit vorwärts, indem sie namentlich die italienischen Einflüsse konsequenter auf-
nehmen, aber anderwärts, namentlich von den Niederländern, geschieht dies bedeutender und
geschichtlich belangreicher, wesshalb wir es auch dort näher erörtern werden, während wir
die Gemälde dieser Meister bei einer Skizze des geschichtlichen Ganges der Malerei diesseits
der Alpen im 16. Jahrhundert übergehen können. Die Holzschnitte und Stiche dieser Meister
dagegen sind kunstgeschichtlich weit belangreicher. Zwar erscheinen sie auch hier in erster
Linie als die Nachfolger des grossen Meisters und epochemachend waren sie auch hier nicht,
aber ihre Stiche und Schnitte führen Dürer's Anregungen weiter aus, verbreiten sie durch
äusserst zahlreiche Blätter, machen sie wirklich zum Gemeingut des Volkes, wofür nament-
lich auch die Arbeiten dieser Künstler für das Knstgewerbe nicht zu unterschätzen sind.
auch die in jener Zeit überraschende Meisterschaft im Nackten, deren Vorführung ihn wohl
auch bei der Wahl dieses Stoffes mit bestimmte, ebenso wie zahlreiche Niederländer des
16. Jahrhunderts, wie z. B. den sogenannten Dirk van Staar in seinem Stich von 1544
oder Karel van Mander, die gleich Grien bei diesem Thema eben namentlich die günstige
Gelegenheit fesselte Akte in den mannigfaltigsten Stellungen und Bewegungen geben zu
können.
Grien entwickelte in der Sinthuth aber auch seine ganze dramatische Kraft, sie ist
voll der ergreifendsten Motive in den Ertrinkenden, wie sie von der Fluth überwältigt mit
dem Tode ringen, indem sie sich an den sinkenden Kahn klammern und an der Arche
emporklettern, wie sie zum Himmel schreien, während der fette Mönch auch jetzt noch
ein selbstbewusstes Gebet emporsendet, wie Thier und Menschen mit ihren letzten Kräften
kämpfen in der alles vernichtenden Fluth und der Kater noch wüthend sein Plätzchen
gegen einen anschwimmenden Hund vertheidigt. Das Merkwürdigste an dem Bild aber ist
die Beleuchtung, die schweren, tief herabhängenden schwarzen Wolken, die von der linken
Seite hereinziehen und welche nur einzelne Lichtstrahlen durchbrechen, die ein magisches
Helldunkel erzeugen.
4. Dürer's Nachfolger.
Vor allem durch die Nachfolge Dürer's behauptet sich Nürnberg noch bis gegen die
Mitte des 16. Jahrhunderts als ein Hauptplatz der deutschen Malerei und bietet dadurch
den natürlichen Ausgangspunkt die historische Stellung der oberdeutschen Malerei der
nächsten Generation zu betrachten.
Nur wenige Jahre jünger als Dürer führt uns Hans Schäuffelin doch schon zu
dessen Nachfolge über, der etwa 1480 in Nürnberg geboren wurde, dessen Eltern aber aus
Nördlingen stammten, den wir 1512 in Augsburg treffen, während er von 1515 bis 1539
oder 1540 in Nördlingen lebte, das auch noch den Haupttheil seines Werkes zumal in der
Sammlung auf dem Rathhaus verwahrt. Durch die eigentümliche Mischung schwäbischer
und fränkischer Art ist Schäuffelin der echte Künstler des Ries, jenes Landstriches, in dem
sich schwäbisches und fränkisches Volksthum so merkwürdig kreuzen. Er besitzt schon
dadurch eine gewisse Eigenart, ist somit ein weiteres Beispiel für den Reichthum der ober-
deutschen Malerei der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts an Individualitäten, einen wesentlichen
Fortschritt derselben bezeichnet er aber nicht.
Dies gilt in der Malerei auch von den übrigen Nachfolgern Dürer's, sie gehen zwar
mit der Zeit vorwärts, indem sie namentlich die italienischen Einflüsse konsequenter auf-
nehmen, aber anderwärts, namentlich von den Niederländern, geschieht dies bedeutender und
geschichtlich belangreicher, wesshalb wir es auch dort näher erörtern werden, während wir
die Gemälde dieser Meister bei einer Skizze des geschichtlichen Ganges der Malerei diesseits
der Alpen im 16. Jahrhundert übergehen können. Die Holzschnitte und Stiche dieser Meister
dagegen sind kunstgeschichtlich weit belangreicher. Zwar erscheinen sie auch hier in erster
Linie als die Nachfolger des grossen Meisters und epochemachend waren sie auch hier nicht,
aber ihre Stiche und Schnitte führen Dürer's Anregungen weiter aus, verbreiten sie durch
äusserst zahlreiche Blätter, machen sie wirklich zum Gemeingut des Volkes, wofür nament-
lich auch die Arbeiten dieser Künstler für das Knstgewerbe nicht zu unterschätzen sind.