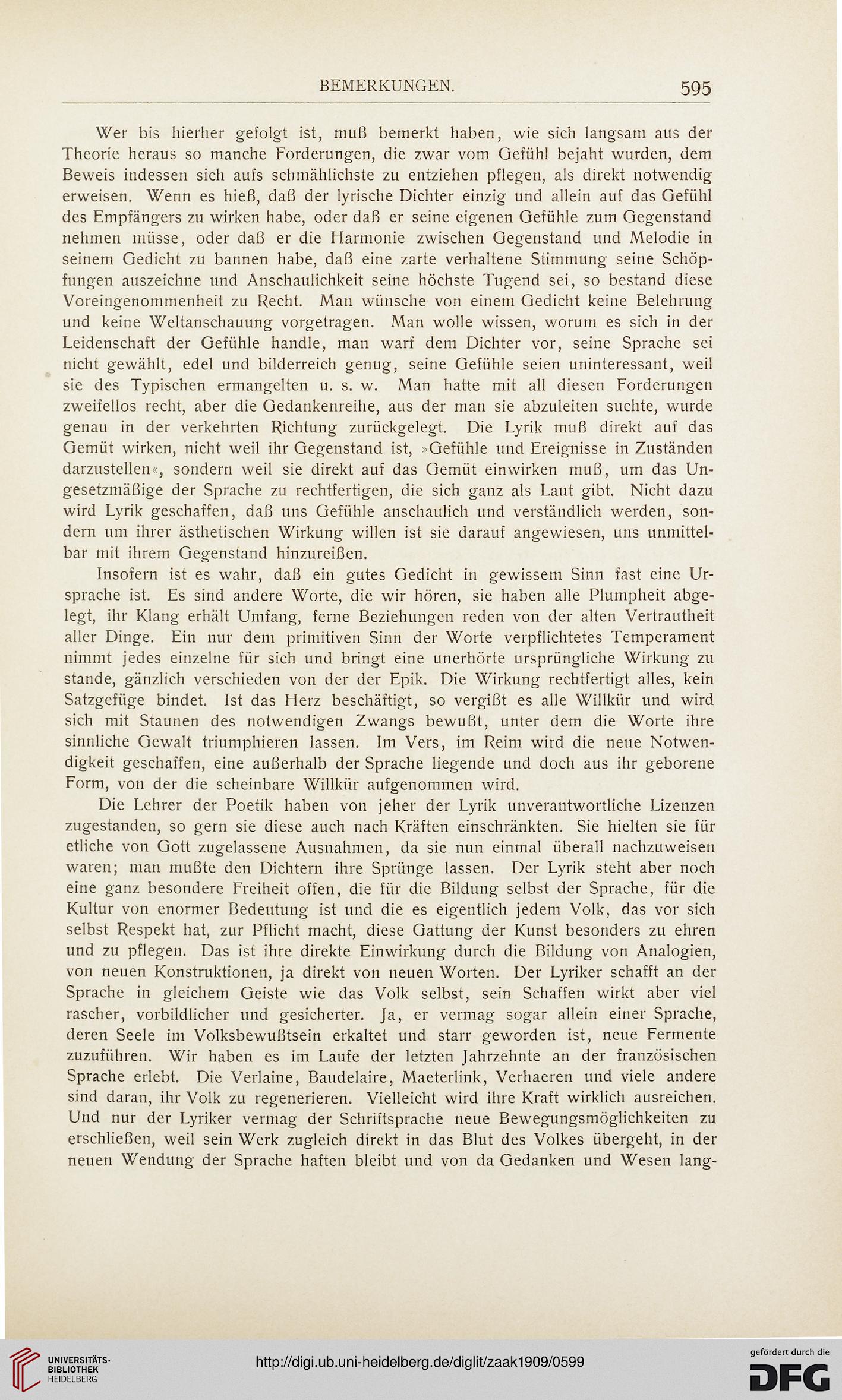BEMERKUNGEN.
595
Wer bis hierher gefolgt ist, muß bemerkt haben, wie sich langsam aus der
Theorie heraus so manche Forderungen, die zwar vom Gefühl bejaht wurden, dem
Beweis indessen sich aufs schmählichste zu entziehen pflegen, als direkt notwendig
erweisen. Wenn es hieß, daß der lyrische Dichter einzig und allein auf das Gefühl
des Empfängers zu wirken habe, oder daß er seine eigenen Gefühle zum Gegenstand
nehmen müsse, oder daß er die Harmonie zwischen Gegenstand und Melodie in
seinem Gedicht zu bannen habe, daß eine zarte verhaltene Stimmung seine Schöp-
fungen auszeichne und Anschaulichkeit seine höchste Tugend sei, so bestand diese
Voreingenommenheit zu Recht. Man wünsche von einem Gedicht keine Belehrung
und keine Weltanschauung vorgetragen. Man wolle wissen, worum es sich in der
Leidenschaft der Gefühle handle, man warf dem Dichter vor, seine Sprache sei
nicht gewählt, edel und bilderreich genug, seine Gefühle seien uninteressant, weil
sie des Typischen ermangelten u. s. w. Man hatte mit all diesen Forderungen
zweifellos recht, aber die Gedankenreihe, aus der man sie abzuleiten suchte, wurde
genau in der verkehrten Richtung zurückgelegt. Die Lyrik muß direkt auf das
Gemüt wirken, nicht weil ihr Gegenstand ist, »Gefühle und Ereignisse in Zuständen
darzustellen«, sondern weil sie direkt auf das Gemüt einwirken muß, um das Un-
gesetzmäßige der Sprache zu rechtfertigen, die sich ganz als Laut gibt. Nicht dazu
wird Lyrik geschaffen, daß uns Gefühle anschaulich und verständlich werden, son-
dern um ihrer ästhetischen Wirkung willen ist sie darauf angewiesen, uns unmittel-
bar mit ihrem Gegenstand hinzureißen.
Insofern ist es wahr, daß ein gutes Gedicht in gewissem Sinn fast eine Ur-
sprache ist. Es sind andere Worte, die wir hören, sie haben alle Plumpheit abge-
legt, ihr Klang erhält Umfang, ferne Beziehungen reden von der alten Vertrautheit
aller Dinge. Ein nur dem primitiven Sinn der Worte verpflichtetes Temperament
nimmt jedes einzelne für sich und bringt eine unerhörte ursprüngliche Wirkung zu
stände, gänzlich verschieden von der der Epik. Die Wirkung rechtfertigt alles, kein
Satzgefüge bindet. Ist das Herz beschäftigt, so vergißt es alle Willkür und wird
sich mit Staunen des notwendigen Zwangs bewußt, unter dem die Worte ihre
sinnliche Gewalt triumphieren lassen. Im Vers, im Reim wird die neue Notwen-
digkeit geschaffen, eine außerhalb der Sprache liegende und doch aus ihr geborene
Form, von der die scheinbare Willkür aufgenommen wird.
Die Lehrer der Poetik haben von jeher der Lyrik unverantwortliche Lizenzen
zugestanden, so gern sie diese auch nach Kräften einschränkten. Sie hielten sie für
etliche von Gott zugelassene Ausnahmen, da sie nun einmal überall nachzuweisen
waren; man mußte den Dichtern ihre Sprünge lassen. Der Lyrik steht aber noch
eine ganz besondere Freiheit offen, die für die Bildung selbst der Sprache, für die
Kultur von enormer Bedeutung ist und die es eigentlich jedem Volk, das vor sich
selbst Respekt hat, zur Pflicht macht, diese Gattung der Kunst besonders zu ehren
und zu pflegen. Das ist ihre direkte Einwirkung durch die Bildung von Analogien,
von neuen Konstruktionen, ja direkt von neuen Worten. Der Lyriker schafft an der
Sprache in gleichem Geiste wie das Volk selbst, sein Schaffen wirkt aber viel
rascher, vorbildlicher und gesicherter. Ja, er vermag sogar allein einer Sprache,
deren Seele im Volksbewußtsein erkaltet und starr geworden ist, neue Fermente
zuzuführen. Wir haben es itn Laufe der letzten Jahrzehnte an der französischen
Sprache erlebt. Die Verlaine, Baudelaire, Maeterlink, Verhaeren und viele andere
sind daran, ihr Volk zu regenerieren. Vielleicht wird ihre Kraft wirklich ausreichen.
Und nur der Lyriker vermag der Schriftsprache neue Bewegungsmöglichkeiten zu
erschließen, weil sein Werk zugleich direkt in das Blut des Volkes übergeht, in der
neuen Wendung der Sprache haften bleibt und von da Gedanken und Wesen lang-
595
Wer bis hierher gefolgt ist, muß bemerkt haben, wie sich langsam aus der
Theorie heraus so manche Forderungen, die zwar vom Gefühl bejaht wurden, dem
Beweis indessen sich aufs schmählichste zu entziehen pflegen, als direkt notwendig
erweisen. Wenn es hieß, daß der lyrische Dichter einzig und allein auf das Gefühl
des Empfängers zu wirken habe, oder daß er seine eigenen Gefühle zum Gegenstand
nehmen müsse, oder daß er die Harmonie zwischen Gegenstand und Melodie in
seinem Gedicht zu bannen habe, daß eine zarte verhaltene Stimmung seine Schöp-
fungen auszeichne und Anschaulichkeit seine höchste Tugend sei, so bestand diese
Voreingenommenheit zu Recht. Man wünsche von einem Gedicht keine Belehrung
und keine Weltanschauung vorgetragen. Man wolle wissen, worum es sich in der
Leidenschaft der Gefühle handle, man warf dem Dichter vor, seine Sprache sei
nicht gewählt, edel und bilderreich genug, seine Gefühle seien uninteressant, weil
sie des Typischen ermangelten u. s. w. Man hatte mit all diesen Forderungen
zweifellos recht, aber die Gedankenreihe, aus der man sie abzuleiten suchte, wurde
genau in der verkehrten Richtung zurückgelegt. Die Lyrik muß direkt auf das
Gemüt wirken, nicht weil ihr Gegenstand ist, »Gefühle und Ereignisse in Zuständen
darzustellen«, sondern weil sie direkt auf das Gemüt einwirken muß, um das Un-
gesetzmäßige der Sprache zu rechtfertigen, die sich ganz als Laut gibt. Nicht dazu
wird Lyrik geschaffen, daß uns Gefühle anschaulich und verständlich werden, son-
dern um ihrer ästhetischen Wirkung willen ist sie darauf angewiesen, uns unmittel-
bar mit ihrem Gegenstand hinzureißen.
Insofern ist es wahr, daß ein gutes Gedicht in gewissem Sinn fast eine Ur-
sprache ist. Es sind andere Worte, die wir hören, sie haben alle Plumpheit abge-
legt, ihr Klang erhält Umfang, ferne Beziehungen reden von der alten Vertrautheit
aller Dinge. Ein nur dem primitiven Sinn der Worte verpflichtetes Temperament
nimmt jedes einzelne für sich und bringt eine unerhörte ursprüngliche Wirkung zu
stände, gänzlich verschieden von der der Epik. Die Wirkung rechtfertigt alles, kein
Satzgefüge bindet. Ist das Herz beschäftigt, so vergißt es alle Willkür und wird
sich mit Staunen des notwendigen Zwangs bewußt, unter dem die Worte ihre
sinnliche Gewalt triumphieren lassen. Im Vers, im Reim wird die neue Notwen-
digkeit geschaffen, eine außerhalb der Sprache liegende und doch aus ihr geborene
Form, von der die scheinbare Willkür aufgenommen wird.
Die Lehrer der Poetik haben von jeher der Lyrik unverantwortliche Lizenzen
zugestanden, so gern sie diese auch nach Kräften einschränkten. Sie hielten sie für
etliche von Gott zugelassene Ausnahmen, da sie nun einmal überall nachzuweisen
waren; man mußte den Dichtern ihre Sprünge lassen. Der Lyrik steht aber noch
eine ganz besondere Freiheit offen, die für die Bildung selbst der Sprache, für die
Kultur von enormer Bedeutung ist und die es eigentlich jedem Volk, das vor sich
selbst Respekt hat, zur Pflicht macht, diese Gattung der Kunst besonders zu ehren
und zu pflegen. Das ist ihre direkte Einwirkung durch die Bildung von Analogien,
von neuen Konstruktionen, ja direkt von neuen Worten. Der Lyriker schafft an der
Sprache in gleichem Geiste wie das Volk selbst, sein Schaffen wirkt aber viel
rascher, vorbildlicher und gesicherter. Ja, er vermag sogar allein einer Sprache,
deren Seele im Volksbewußtsein erkaltet und starr geworden ist, neue Fermente
zuzuführen. Wir haben es itn Laufe der letzten Jahrzehnte an der französischen
Sprache erlebt. Die Verlaine, Baudelaire, Maeterlink, Verhaeren und viele andere
sind daran, ihr Volk zu regenerieren. Vielleicht wird ihre Kraft wirklich ausreichen.
Und nur der Lyriker vermag der Schriftsprache neue Bewegungsmöglichkeiten zu
erschließen, weil sein Werk zugleich direkt in das Blut des Volkes übergeht, in der
neuen Wendung der Sprache haften bleibt und von da Gedanken und Wesen lang-