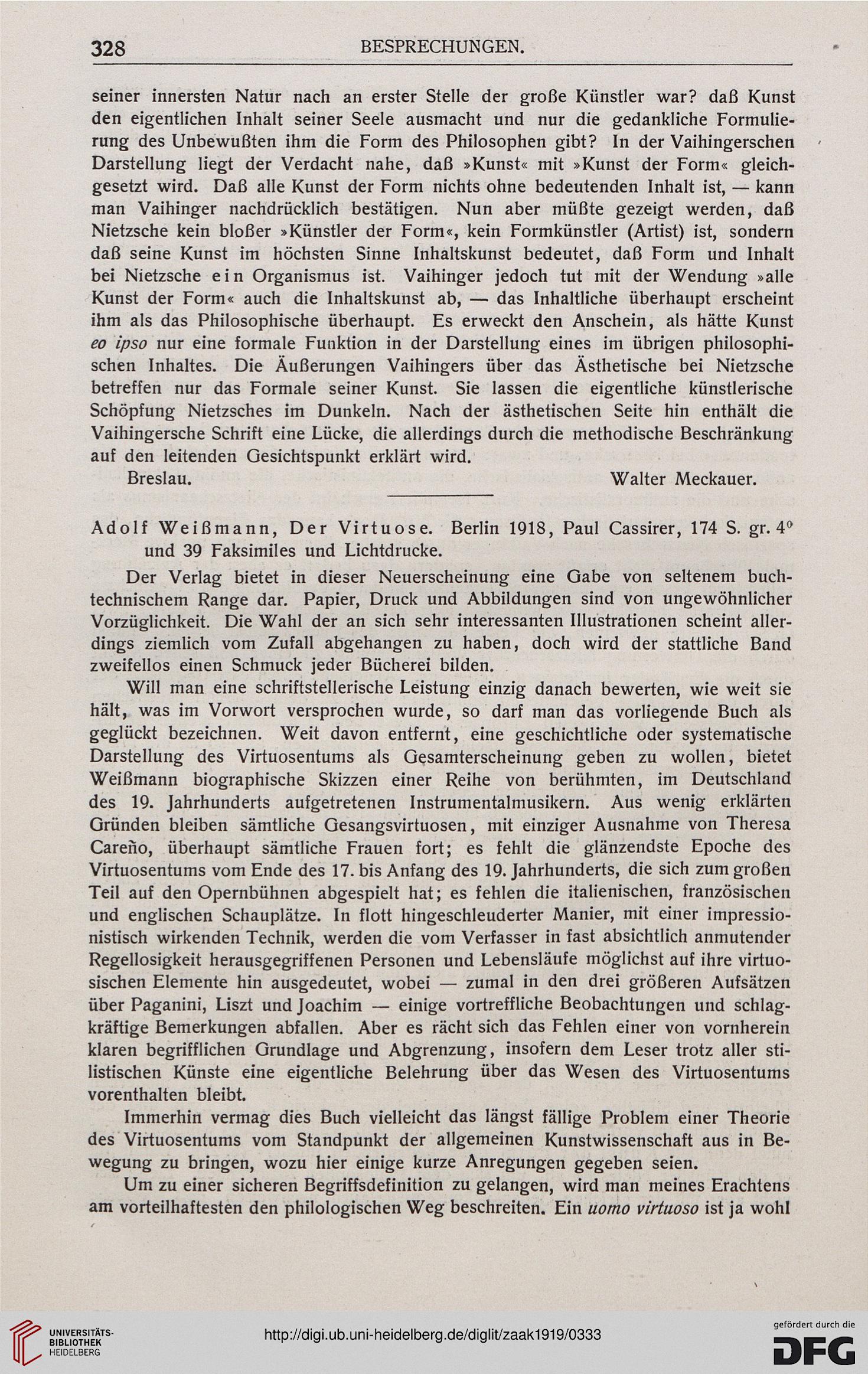328 BESPRECHUNGEN.
seiner innersten Natur nach an erster Stelle der große Künstler war? daß Kunst
den eigentlichen Inhalt seiner Seele ausmacht und nur die gedankliche Formulie-
rung des Unbewußten ihm die Form des Philosophen gibt? In der Vaihingerschen
Darstellung liegt der Verdacht nahe, daß »Kunst« mit »Kunst der Form« gleich-
gesetzt wird. Daß alle Kunst der Form nichts ohne bedeutenden Inhalt ist, — kann
man Vaihinger nachdrücklich bestätigen. Nun aber müßte gezeigt werden, daß
Nietzsche kein bloßer »Künstler der Form«, kein Formkünstler (Artist) ist, sondern
daß seine Kunst im höchsten Sinne Inhaltskunst bedeutet, daß Form und Inhalt
bei Nietzsche ein Organismus ist. Vaihinger jedoch tut mit der Wendung »alle
Kunst der Form« auch die Inhaltskunst ab, — das Inhaltliche überhaupt erscheint
ihm als das Philosophische überhaupt. Es erweckt den Anschein, als hätte Kunst
eo ipso nur eine formale Funktion in der Darstellung eines im übrigen philosophi-
schen Inhaltes. Die Äußerungen Vaihingers über das Ästhetische bei Nietzsche
betreffen nur das Formale seiner Kunst. Sie lassen die eigentliche künstlerische
Schöpfung Nietzsches im Dunkeln. Nach der ästhetischen Seite hin enthält die
Vaihingersche Schrift eine Lücke, die allerdings durch die methodische Beschränkung
auf den leitenden Gesichtspunkt erklärt wird.
Breslau. Walter Meckauer.
Adolf Weißmann, Der Virtuose. Berlin 1918, Paul Cassirer, 174 S. gr. 4°
und 39 Faksimiles und Lichtdrucke.
Der Verlag bietet in dieser Neuerscheinung eine Gabe von seltenem buch-
technischem Range dar. Papier, Druck und Abbildungen sind von ungewöhnlicher
Vorzüglichkeit. Die Wahl der an sich sehr interessanten Illustrationen scheint aller-
dings ziemlich vom Zufall abgehangen zu haben, doch wird der stattliche Band
zweifellos einen Schmuck jeder Bücherei bilden.
Will man eine schriftstellerische Leistung einzig danach bewerten, wie weit sie
hält, was im Vorwort versprochen wurde, so darf man das vorliegende Buch als
geglückt bezeichnen. Weit davon entfernt, eine geschichtliche oder systematische
Darstellung des Virtuosentums als Gesamterscheinung geben zu wollen, bietet
Weißmann biographische Skizzen einer Reihe von berühmten, im Deutschland
des 19. Jahrhunderts aufgetretenen Instrumentalmusikern. Aus wenig erklärten
Gründen bleiben sämtliche Gesangsvirtuosen, mit einziger Ausnahme von Theresa
Careno, überhaupt sämtliche Frauen fort; es fehlt die glänzendste Epoche des
Virtuosentums vom Ende des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts, die sich zum großen
Teil auf den Opernbühnen abgespielt hat; es fehlen die italienischen, französischen
und englischen Schauplätze. In flott hingeschleuderter Manier, mit einer impressio-
nistisch wirkenden Technik, werden die vom Verfasser in fast absichtlich anmutender
Regellosigkeit herausgegriffenen Personen und Lebensläufe möglichst auf ihre virtuo-
sischen Elemente hin ausgedeutet, wobei — zumal in den drei größeren Aufsätzen
über Paganini, Liszt und Joachim — einige vortreffliche Beobachtungen und schlag-
kräftige Bemerkungen abfallen. Aber es rächt sich das Fehlen einer von vornherein
klaren begrifflichen Grundlage und Abgrenzung, insofern dem Leser trotz aller sti-
listischen Künste eine eigentliche Belehrung über das Wesen des Virtuosentums
vorenthalten bleibt.
Immerhin vermag dies Buch vielleicht das längst fällige Problem einer Theorie
des Virtuosentums vom Standpunkt der allgemeinen Kunstwissenschaft aus in Be-
wegung zu bringen, wozu hier einige kurze Anregungen gegeben seien.
Um zu einer sicheren Begriffsdefinition zu gelangen, wird man meines Erachtens
am vorteilhaftesten den philologischen Weg beschreiten. Ein uomo virtuoso ist ja wohl
seiner innersten Natur nach an erster Stelle der große Künstler war? daß Kunst
den eigentlichen Inhalt seiner Seele ausmacht und nur die gedankliche Formulie-
rung des Unbewußten ihm die Form des Philosophen gibt? In der Vaihingerschen
Darstellung liegt der Verdacht nahe, daß »Kunst« mit »Kunst der Form« gleich-
gesetzt wird. Daß alle Kunst der Form nichts ohne bedeutenden Inhalt ist, — kann
man Vaihinger nachdrücklich bestätigen. Nun aber müßte gezeigt werden, daß
Nietzsche kein bloßer »Künstler der Form«, kein Formkünstler (Artist) ist, sondern
daß seine Kunst im höchsten Sinne Inhaltskunst bedeutet, daß Form und Inhalt
bei Nietzsche ein Organismus ist. Vaihinger jedoch tut mit der Wendung »alle
Kunst der Form« auch die Inhaltskunst ab, — das Inhaltliche überhaupt erscheint
ihm als das Philosophische überhaupt. Es erweckt den Anschein, als hätte Kunst
eo ipso nur eine formale Funktion in der Darstellung eines im übrigen philosophi-
schen Inhaltes. Die Äußerungen Vaihingers über das Ästhetische bei Nietzsche
betreffen nur das Formale seiner Kunst. Sie lassen die eigentliche künstlerische
Schöpfung Nietzsches im Dunkeln. Nach der ästhetischen Seite hin enthält die
Vaihingersche Schrift eine Lücke, die allerdings durch die methodische Beschränkung
auf den leitenden Gesichtspunkt erklärt wird.
Breslau. Walter Meckauer.
Adolf Weißmann, Der Virtuose. Berlin 1918, Paul Cassirer, 174 S. gr. 4°
und 39 Faksimiles und Lichtdrucke.
Der Verlag bietet in dieser Neuerscheinung eine Gabe von seltenem buch-
technischem Range dar. Papier, Druck und Abbildungen sind von ungewöhnlicher
Vorzüglichkeit. Die Wahl der an sich sehr interessanten Illustrationen scheint aller-
dings ziemlich vom Zufall abgehangen zu haben, doch wird der stattliche Band
zweifellos einen Schmuck jeder Bücherei bilden.
Will man eine schriftstellerische Leistung einzig danach bewerten, wie weit sie
hält, was im Vorwort versprochen wurde, so darf man das vorliegende Buch als
geglückt bezeichnen. Weit davon entfernt, eine geschichtliche oder systematische
Darstellung des Virtuosentums als Gesamterscheinung geben zu wollen, bietet
Weißmann biographische Skizzen einer Reihe von berühmten, im Deutschland
des 19. Jahrhunderts aufgetretenen Instrumentalmusikern. Aus wenig erklärten
Gründen bleiben sämtliche Gesangsvirtuosen, mit einziger Ausnahme von Theresa
Careno, überhaupt sämtliche Frauen fort; es fehlt die glänzendste Epoche des
Virtuosentums vom Ende des 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts, die sich zum großen
Teil auf den Opernbühnen abgespielt hat; es fehlen die italienischen, französischen
und englischen Schauplätze. In flott hingeschleuderter Manier, mit einer impressio-
nistisch wirkenden Technik, werden die vom Verfasser in fast absichtlich anmutender
Regellosigkeit herausgegriffenen Personen und Lebensläufe möglichst auf ihre virtuo-
sischen Elemente hin ausgedeutet, wobei — zumal in den drei größeren Aufsätzen
über Paganini, Liszt und Joachim — einige vortreffliche Beobachtungen und schlag-
kräftige Bemerkungen abfallen. Aber es rächt sich das Fehlen einer von vornherein
klaren begrifflichen Grundlage und Abgrenzung, insofern dem Leser trotz aller sti-
listischen Künste eine eigentliche Belehrung über das Wesen des Virtuosentums
vorenthalten bleibt.
Immerhin vermag dies Buch vielleicht das längst fällige Problem einer Theorie
des Virtuosentums vom Standpunkt der allgemeinen Kunstwissenschaft aus in Be-
wegung zu bringen, wozu hier einige kurze Anregungen gegeben seien.
Um zu einer sicheren Begriffsdefinition zu gelangen, wird man meines Erachtens
am vorteilhaftesten den philologischen Weg beschreiten. Ein uomo virtuoso ist ja wohl