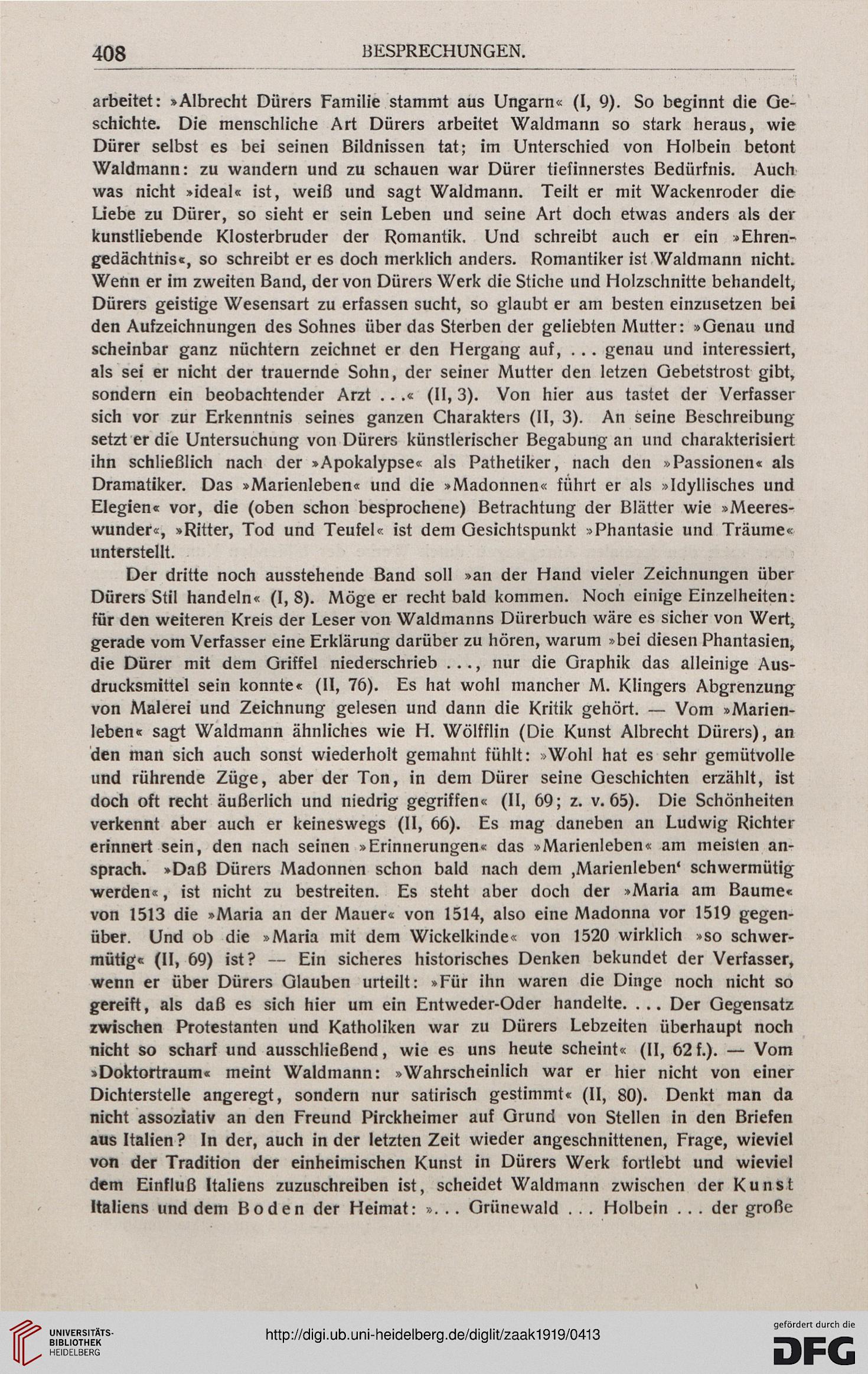408 BESPRECHUNGEN.
arbeitet: »Albrecht Dürers Familie stammt aus Ungarn« (I, 9). So beginnt die Ge-
schichte. Die menschliche Art Dürers arbeitet Waldmann so stark heraus, wie
Dürer selbst es bei seinen Bildnissen tat; im Unterschied von Holbein betont
Waldmann: zu wandern und zu schauen war Dürer tiefinnerstes Bedürfnis. Auch
was nicht »ideal« ist, weiß und sagt Waldmann. Teilt er mit Wackenroder die
liebe zu Dürer, so sieht er sein Leben und seine Art doch etwas anders als der
kunstliebende Klosterbruder der Romantik. Und schreibt auch er ein »Ehren-
gedächtnis«, so schreibt er es doch merklich anders. Romantiker ist Waldmann nicht.
Wenn er im zweiten Band, der von Dürers Werk die Stiche und Holzschnitte behandelt,
Dürers geistige Wesensart zu erfassen sucht, so glaubt er am besten einzusetzen bei
den Aufzeichnungen des Sohnes über das Sterben der geliebten Mutter: »Genau und
scheinbar ganz nüchtern zeichnet er den Hergang auf, . .. genau und interessiert,
als sei er nicht der trauernde Sohn, der seiner Mutter den letzen Gebetstrost gibt,
sondern ein beobachtender Arzt ...« (II, 3). Von hier aus tastet der Verfasser
sich vor zur Erkenntnis seines ganzen Charakters (II, 3). An seine Beschreibung
setzt er die Untersuchung von Dürers künstlerischer Begabung an und charakterisiert
ihn schließlich nach der »Apokalypse« als Pathetiker, nach den »Passionen« als
Dramatiker. Das »Marienleben« und die »Madonnen« führt er als »Idyllisches und
Elegien« vor, die (oben schon besprochene) Betrachtung der Blätter wie »Meeres-
wunder«, »Ritter, Tod und Teufel« ist dem Gesichtspunkt »Phantasie und Träume«
unterstellt.
Der dritte noch ausstehende Band soll »an der Hand vieler Zeichnungen über
Dürers Stil handeln« (1,8). Möge er recht bald kommen. Noch einige Einzelheiten:
für den weiteren Kreis der Leser von Waldmanns Dürerbuch wäre es sicher von Wert,
gerade vom Verfasser eine Erklärung darüber zu hören, warum »bei diesen Phantasien,
die Dürer mit dem Griffel niederschrieb ..., nur die Graphik das alleinige Aus-
drucksmittel sein konnte« (II, 76). Es hat wohl mancher M. Ktingers Abgrenzung
von Malerei und Zeichnung gelesen und dann die Kritik gehört. — Vom »Marien-
leben« sagt Waldmann ähnliches wie H. Wölfflin (Die Kunst Albrecht Dürers), an
den man sich auch sonst wiederholt gemahnt fühlt: »Wohl hat es sehr gemütvolle
und rührende Züge, aber der Ton, in dem Dürer seine Geschichten erzählt, ist
doch oft recht äußerlich und niedrig gegriffen« (II, 69; z. v. 65). Die Schönheiten
verkennt aber auch er keineswegs (II, 66). Es mag daneben an Ludwig Richter
erinnert sein, den nach seinen »Erinnerungen« das »Marienleben« am meisten an-
sprach. »Daß Dürers Madonnen schon bald nach dem .Marienleben' schwermütig
werden«, ist nicht zu bestreiten. Es steht aber doch der »Maria am Baume«
von 1513 die »Maria an der Mauer« von 1514, also eine Madonna vor 1519 gegen-
über. Und ob die »Maria mit dem Wickelkinde« von 1520 wirklich »so schwer-
mütig« (II, 69) ist? — Ein sicheres historisches Denken bekundet der Verfasser,
wenn er über Dürers Glauben urteilt: »Für ihn waren die Dinge noch nicht so
gereift, als daß es sich hier um ein Entweder-Oder handelte. ... Der Gegensatz
zwischen Protestanten und Katholiken war zu Dürers Lebzeiten überhaupt noch
nicht so scharf und ausschließend, wie es uns heute scheint« (II, 62f.). — Vom
»Doktortraum« meint Waldmann: »Wahrscheinlich war er hier nicht von einer
Dichterstelle angeregt, sondern nur satirisch gestimmt« (II, 80). Denkt man da
nicht assoziativ an den Freund Pirckheimer auf Grund von Stellen in den Briefen
aus Italien ? In der, auch in der letzten Zeit wieder angeschnittenen, Frage, wieviel
von der Tradition der einheimischen Kunst in Dürers Werk fortlebt und wieviel
dem Einfluß Italiens zuzuschreiben ist, scheidet Waldmann zwischen der Kunst
Italiens und dem Boden der Heimat: ». .. Grünewald . . . Holbein . . . der große
arbeitet: »Albrecht Dürers Familie stammt aus Ungarn« (I, 9). So beginnt die Ge-
schichte. Die menschliche Art Dürers arbeitet Waldmann so stark heraus, wie
Dürer selbst es bei seinen Bildnissen tat; im Unterschied von Holbein betont
Waldmann: zu wandern und zu schauen war Dürer tiefinnerstes Bedürfnis. Auch
was nicht »ideal« ist, weiß und sagt Waldmann. Teilt er mit Wackenroder die
liebe zu Dürer, so sieht er sein Leben und seine Art doch etwas anders als der
kunstliebende Klosterbruder der Romantik. Und schreibt auch er ein »Ehren-
gedächtnis«, so schreibt er es doch merklich anders. Romantiker ist Waldmann nicht.
Wenn er im zweiten Band, der von Dürers Werk die Stiche und Holzschnitte behandelt,
Dürers geistige Wesensart zu erfassen sucht, so glaubt er am besten einzusetzen bei
den Aufzeichnungen des Sohnes über das Sterben der geliebten Mutter: »Genau und
scheinbar ganz nüchtern zeichnet er den Hergang auf, . .. genau und interessiert,
als sei er nicht der trauernde Sohn, der seiner Mutter den letzen Gebetstrost gibt,
sondern ein beobachtender Arzt ...« (II, 3). Von hier aus tastet der Verfasser
sich vor zur Erkenntnis seines ganzen Charakters (II, 3). An seine Beschreibung
setzt er die Untersuchung von Dürers künstlerischer Begabung an und charakterisiert
ihn schließlich nach der »Apokalypse« als Pathetiker, nach den »Passionen« als
Dramatiker. Das »Marienleben« und die »Madonnen« führt er als »Idyllisches und
Elegien« vor, die (oben schon besprochene) Betrachtung der Blätter wie »Meeres-
wunder«, »Ritter, Tod und Teufel« ist dem Gesichtspunkt »Phantasie und Träume«
unterstellt.
Der dritte noch ausstehende Band soll »an der Hand vieler Zeichnungen über
Dürers Stil handeln« (1,8). Möge er recht bald kommen. Noch einige Einzelheiten:
für den weiteren Kreis der Leser von Waldmanns Dürerbuch wäre es sicher von Wert,
gerade vom Verfasser eine Erklärung darüber zu hören, warum »bei diesen Phantasien,
die Dürer mit dem Griffel niederschrieb ..., nur die Graphik das alleinige Aus-
drucksmittel sein konnte« (II, 76). Es hat wohl mancher M. Ktingers Abgrenzung
von Malerei und Zeichnung gelesen und dann die Kritik gehört. — Vom »Marien-
leben« sagt Waldmann ähnliches wie H. Wölfflin (Die Kunst Albrecht Dürers), an
den man sich auch sonst wiederholt gemahnt fühlt: »Wohl hat es sehr gemütvolle
und rührende Züge, aber der Ton, in dem Dürer seine Geschichten erzählt, ist
doch oft recht äußerlich und niedrig gegriffen« (II, 69; z. v. 65). Die Schönheiten
verkennt aber auch er keineswegs (II, 66). Es mag daneben an Ludwig Richter
erinnert sein, den nach seinen »Erinnerungen« das »Marienleben« am meisten an-
sprach. »Daß Dürers Madonnen schon bald nach dem .Marienleben' schwermütig
werden«, ist nicht zu bestreiten. Es steht aber doch der »Maria am Baume«
von 1513 die »Maria an der Mauer« von 1514, also eine Madonna vor 1519 gegen-
über. Und ob die »Maria mit dem Wickelkinde« von 1520 wirklich »so schwer-
mütig« (II, 69) ist? — Ein sicheres historisches Denken bekundet der Verfasser,
wenn er über Dürers Glauben urteilt: »Für ihn waren die Dinge noch nicht so
gereift, als daß es sich hier um ein Entweder-Oder handelte. ... Der Gegensatz
zwischen Protestanten und Katholiken war zu Dürers Lebzeiten überhaupt noch
nicht so scharf und ausschließend, wie es uns heute scheint« (II, 62f.). — Vom
»Doktortraum« meint Waldmann: »Wahrscheinlich war er hier nicht von einer
Dichterstelle angeregt, sondern nur satirisch gestimmt« (II, 80). Denkt man da
nicht assoziativ an den Freund Pirckheimer auf Grund von Stellen in den Briefen
aus Italien ? In der, auch in der letzten Zeit wieder angeschnittenen, Frage, wieviel
von der Tradition der einheimischen Kunst in Dürers Werk fortlebt und wieviel
dem Einfluß Italiens zuzuschreiben ist, scheidet Waldmann zwischen der Kunst
Italiens und dem Boden der Heimat: ». .. Grünewald . . . Holbein . . . der große