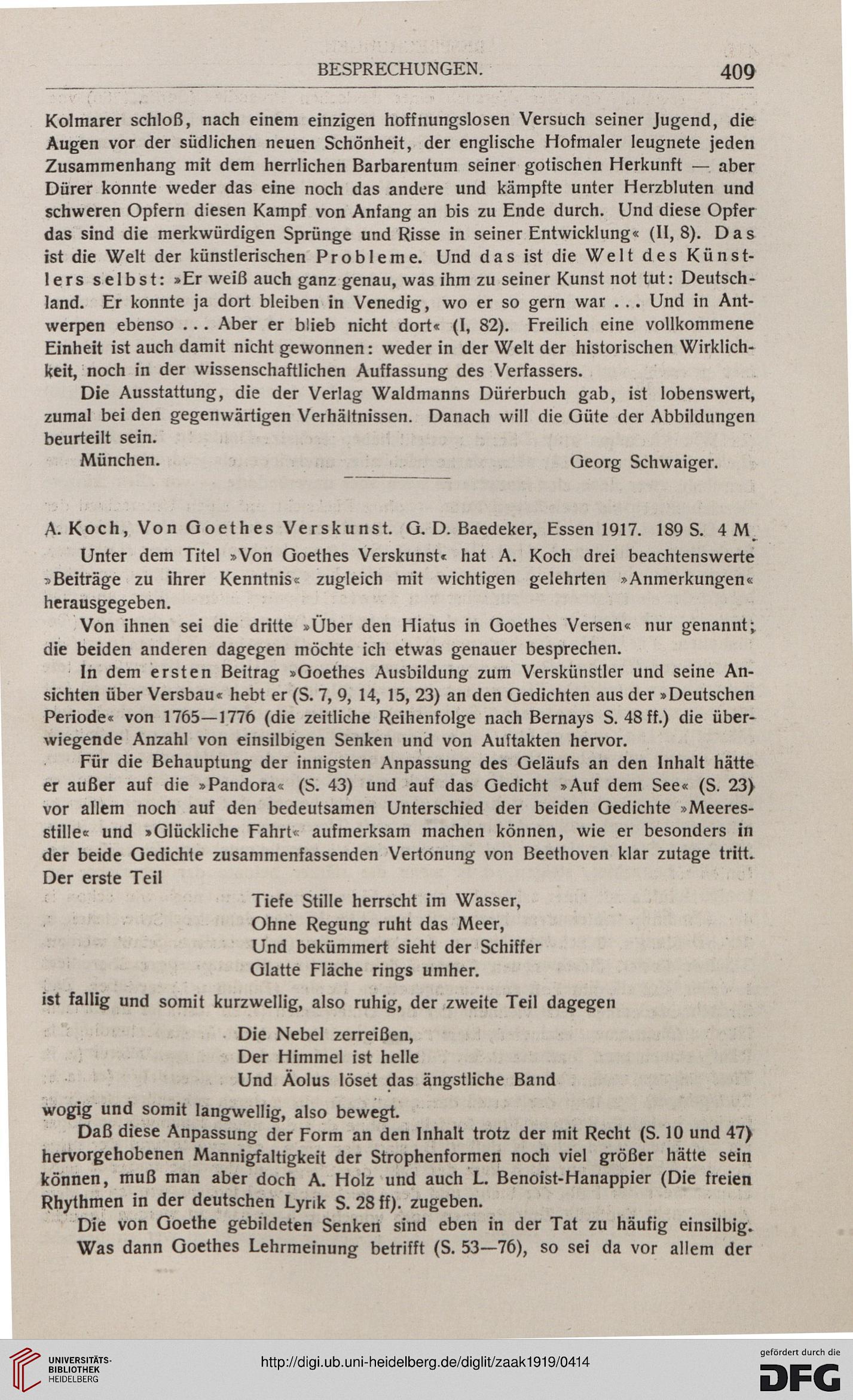BESPRECHUNGEN. 409
Kolmarer schloß, nach einem einzigen hoffnungslosen Versuch seiner Jugend, die
Augen vor der südlichen neuen Schönheit, der englische Hofmaler leugnete jeden
Zusammenhang mit dem herrlichen Barbarentum seiner gotischen Herkunft — aber
Dürer konnte weder das eine noch das andere und kämpfte unter Herzbluten und
schweren Opfern diesen Kampf von Anfang an bis zu Ende durch. Und diese Opfer
das sind die merkwürdigen Sprünge und Risse in seiner Entwicklung« (II, 8). Das
ist die Welt der künstlerischen Probleme. Und das ist die Welt des Künst-
lers selbst: »Er weiß auch ganz genau, was ihm zu seiner Kunst not tut: Deutsch-
land. Er konnte ja dort bleiben in Venedig, wo er so gern war ... Und in Ant-
werpen ebenso ... Aber er blieb nicht dort« (I, 82). Freilich eine vollkommene
Einheit ist auch damit nicht gewonnen: weder in der Welt der historischen Wirklich-
keit, noch in der wissenschaftlichen Auffassung des Verfassers.
Die Ausstattung, die der Verlag Waldmanns Düferbuch gab, ist lobenswert,
zumal bei den gegenwärtigen Verhältnissen. Danach will die Güte der Abbildungen
beurteilt sein.
München. Georg Schwaiger.
A-Koch, Von Goethes Verskunst. G. D. Baedeker, Essen 1917. 189 S. 4M
Unter dem Titel »Von Goethes Verskunst« hat A. Koch drei beachtenswerte
»Beiträge zu ihrer Kenntnis«: zugleich mit wichtigen gelehrten »Anmerkungen«
herausgegeben.
Von ihnen sei die dritte »Über den Hiatus in Goethes Versen« nur genannti
die beiden anderen dagegen möchte ich etwas genauer besprechen.
In dem ersten Beitrag »Goethes Ausbildung zum Verskünstler und seine An-
sichten über Versbau« hebt er (S. 7, 9, 14, 15, 23) an den Gedichten aus der »Deutschen
Periode« von 1765—1776 (die zeitliche Reihenfolge nach Bernays S. 48 ff.) die über-
wiegende Anzahl von einsilbigen Senken und von Auftakten hervor.
Für die Behauptung der innigsten Anpassung des Geläufs an den Inhalt hätte
er außer auf die »Pandora« (S. 43) und auf das Gedicht »Auf dem See« (S. 23)
vor allem noch auf den bedeutsamen Unterschied der beiden Gedichte »Meeres-
stille« und »Glückliche Fahrt< aufmerksam machen können, wie er besonders in
der beide Gedichte zusammenfassenden Vertonung von Beethoven klar zutage tritt.
Der erste Teil
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.
ist fallig und somit kurzwellig, also ruhig, der zweite Teil dagegen
Die Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle
Und Äolus löset das ängstliche Band
wogig und somit langwellig, also bewegt.
Daß diese Anpassung der Form an den Inhalt trotz der mit Recht (S. 10 und 47)
hervorgehobenen Mannigfaltigkeit der Strophenformen noch viel größer hätte sein
können, muß man aber doch A. Holz und auch L. Benoist-Hanappier (Die freien
Rhythmen in der deutschen Lyrik S. 28 ff), zugeben.
Die von Goethe gebildeten Senken sind eben in der Tat zu häufig einsilbig.
Was dann Goethes Lehrmeinung betrifft (S. 53—76), so sei da vor allem der
Kolmarer schloß, nach einem einzigen hoffnungslosen Versuch seiner Jugend, die
Augen vor der südlichen neuen Schönheit, der englische Hofmaler leugnete jeden
Zusammenhang mit dem herrlichen Barbarentum seiner gotischen Herkunft — aber
Dürer konnte weder das eine noch das andere und kämpfte unter Herzbluten und
schweren Opfern diesen Kampf von Anfang an bis zu Ende durch. Und diese Opfer
das sind die merkwürdigen Sprünge und Risse in seiner Entwicklung« (II, 8). Das
ist die Welt der künstlerischen Probleme. Und das ist die Welt des Künst-
lers selbst: »Er weiß auch ganz genau, was ihm zu seiner Kunst not tut: Deutsch-
land. Er konnte ja dort bleiben in Venedig, wo er so gern war ... Und in Ant-
werpen ebenso ... Aber er blieb nicht dort« (I, 82). Freilich eine vollkommene
Einheit ist auch damit nicht gewonnen: weder in der Welt der historischen Wirklich-
keit, noch in der wissenschaftlichen Auffassung des Verfassers.
Die Ausstattung, die der Verlag Waldmanns Düferbuch gab, ist lobenswert,
zumal bei den gegenwärtigen Verhältnissen. Danach will die Güte der Abbildungen
beurteilt sein.
München. Georg Schwaiger.
A-Koch, Von Goethes Verskunst. G. D. Baedeker, Essen 1917. 189 S. 4M
Unter dem Titel »Von Goethes Verskunst« hat A. Koch drei beachtenswerte
»Beiträge zu ihrer Kenntnis«: zugleich mit wichtigen gelehrten »Anmerkungen«
herausgegeben.
Von ihnen sei die dritte »Über den Hiatus in Goethes Versen« nur genannti
die beiden anderen dagegen möchte ich etwas genauer besprechen.
In dem ersten Beitrag »Goethes Ausbildung zum Verskünstler und seine An-
sichten über Versbau« hebt er (S. 7, 9, 14, 15, 23) an den Gedichten aus der »Deutschen
Periode« von 1765—1776 (die zeitliche Reihenfolge nach Bernays S. 48 ff.) die über-
wiegende Anzahl von einsilbigen Senken und von Auftakten hervor.
Für die Behauptung der innigsten Anpassung des Geläufs an den Inhalt hätte
er außer auf die »Pandora« (S. 43) und auf das Gedicht »Auf dem See« (S. 23)
vor allem noch auf den bedeutsamen Unterschied der beiden Gedichte »Meeres-
stille« und »Glückliche Fahrt< aufmerksam machen können, wie er besonders in
der beide Gedichte zusammenfassenden Vertonung von Beethoven klar zutage tritt.
Der erste Teil
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.
ist fallig und somit kurzwellig, also ruhig, der zweite Teil dagegen
Die Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle
Und Äolus löset das ängstliche Band
wogig und somit langwellig, also bewegt.
Daß diese Anpassung der Form an den Inhalt trotz der mit Recht (S. 10 und 47)
hervorgehobenen Mannigfaltigkeit der Strophenformen noch viel größer hätte sein
können, muß man aber doch A. Holz und auch L. Benoist-Hanappier (Die freien
Rhythmen in der deutschen Lyrik S. 28 ff), zugeben.
Die von Goethe gebildeten Senken sind eben in der Tat zu häufig einsilbig.
Was dann Goethes Lehrmeinung betrifft (S. 53—76), so sei da vor allem der