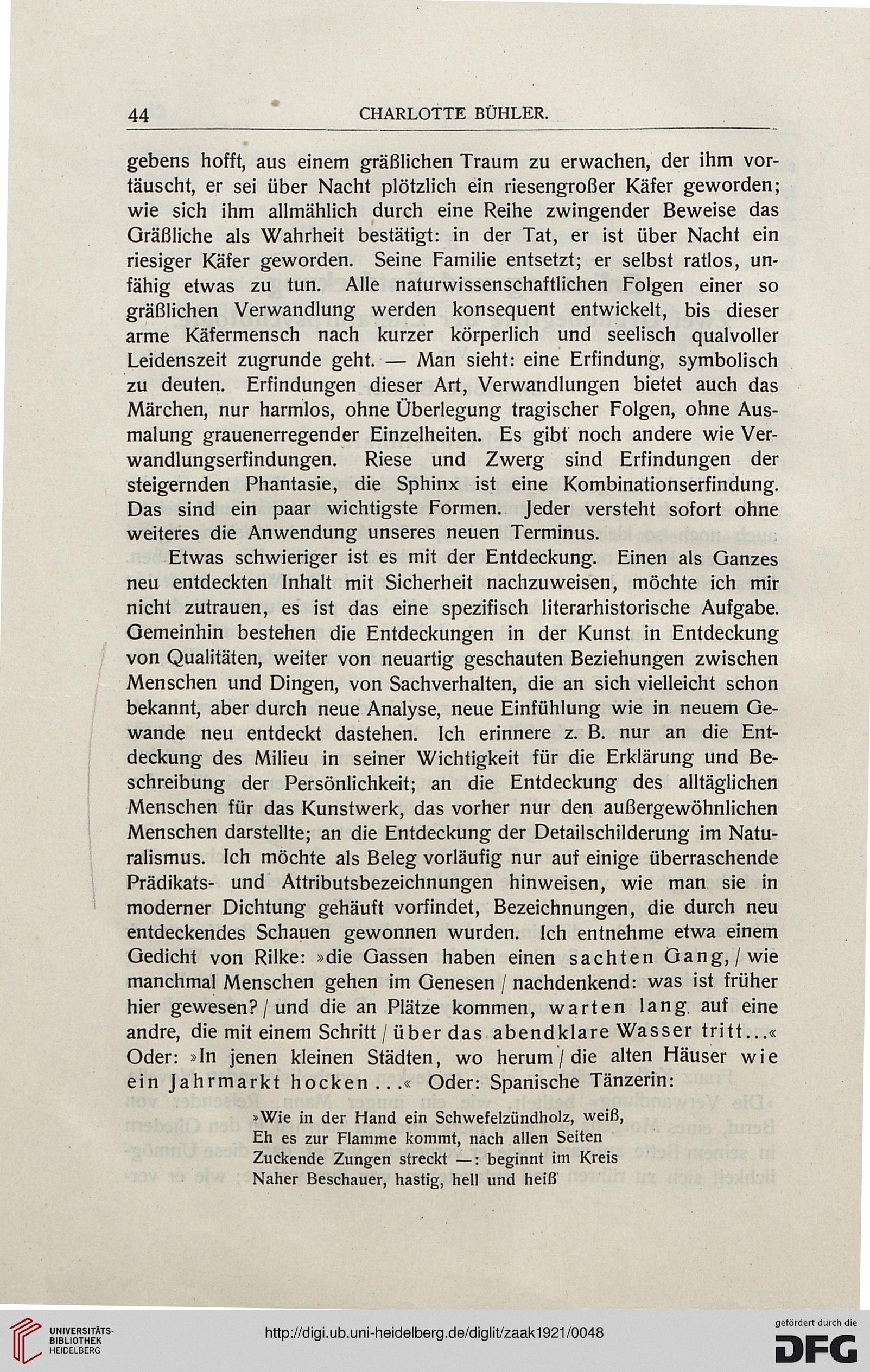44 CHARLOTTE BÜHLER.
gebens hofft, aus einem gräßlichen Traum zu erwachen, der ihm vor-
täuscht, er sei über Nacht plötzlich ein riesengroßer Käfer geworden;
wie sich ihm allmählich durch eine Reihe zwingender Beweise das
Gräßliche als Wahrheit bestätigt: in der Tat, er ist über Nacht ein
riesiger Käfer geworden. Seine Familie entsetzt; er selbst ratlos, un-
fähig etwas zu tun. Alle naturwissenschaftlichen Folgen einer so
gräßlichen Verwandlung werden konsequent entwickelt, bis dieser
arme Käfermensch nach kurzer körperlich und seelisch qualvoller
Leidenszeit zugrunde geht. — Man sieht: eine Erfindung, symbolisch
zu deuten. Erfindungen dieser Art, Verwandlungen bietet auch das
Märchen, nur harmlos, ohne Überlegung tragischer Folgen, ohne Aus-
malung grauenerregender Einzelheiten. Es gibt noch andere wie Ver-
wandlungserfindungen. Riese und Zwerg sind Erfindungen der
steigernden Phantasie, die Sphinx ist eine Kombinationserfindung.
Das sind ein paar wichtigste Formen. Jeder versteht sofort ohne
weiteres die Anwendung unseres neuen Terminus.
Etwas schwieriger ist es mit der Entdeckung. Einen als Ganzes
neu entdeckten Inhalt mit Sicherheit nachzuweisen, möchte ich mir
nicht zutrauen, es ist das eine spezifisch literarhistorische Aufgabe.
Gemeinhin bestehen die Entdeckungen in der Kunst in Entdeckung
von Qualitäten, weiter von neuartig geschauten Beziehungen zwischen
Menschen und Dingen, von Sachverhalten, die an sich vielleicht schon
bekannt, aber durch neue Analyse, neue Einfühlung wie in neuem Ge-
wände neu entdeckt dastehen. Ich erinnere z. B. nur an die Ent-
deckung des Milieu in seiner Wichtigkeit für die Erklärung und Be-
schreibung der Persönlichkeit; an die Entdeckung des alltäglichen
Menschen für das Kunstwerk, das vorher nur den außergewöhnlichen
Menschen darstellte; an die Entdeckung der Detailschilderung im Natu-
ralismus. Ich möchte als Beleg vorläufig nur auf einige überraschende
Prädikats- und Attributsbezeichnungen hinweisen, wie man sie in
moderner Dichtung gehäuft vorfindet, Bezeichnungen, die durch neu
entdeckendes Schauen gewonnen wurden. Ich entnehme etwa einem
Gedicht von Rilke: »die Gassen haben einen sachten Gang, /wie
manchmal Menschen gehen im Genesen / nachdenkend: was ist früher
hier gewesen?/und die an Plätze kommen, warten lang auf eine
andre, die mit einem Schritt / über das abendklare Wasser tritt...«
Oder: »In jenen kleinen Städten, wo herum / die alten Häuser wie
ein Jahrmarkt hocken ...« Oder: Spanische Tänzerin:
»Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
Eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
Zuckende Zungen streckt —: beginnt im Kreis
Naher Beschauer, hastig, hell und heiß
gebens hofft, aus einem gräßlichen Traum zu erwachen, der ihm vor-
täuscht, er sei über Nacht plötzlich ein riesengroßer Käfer geworden;
wie sich ihm allmählich durch eine Reihe zwingender Beweise das
Gräßliche als Wahrheit bestätigt: in der Tat, er ist über Nacht ein
riesiger Käfer geworden. Seine Familie entsetzt; er selbst ratlos, un-
fähig etwas zu tun. Alle naturwissenschaftlichen Folgen einer so
gräßlichen Verwandlung werden konsequent entwickelt, bis dieser
arme Käfermensch nach kurzer körperlich und seelisch qualvoller
Leidenszeit zugrunde geht. — Man sieht: eine Erfindung, symbolisch
zu deuten. Erfindungen dieser Art, Verwandlungen bietet auch das
Märchen, nur harmlos, ohne Überlegung tragischer Folgen, ohne Aus-
malung grauenerregender Einzelheiten. Es gibt noch andere wie Ver-
wandlungserfindungen. Riese und Zwerg sind Erfindungen der
steigernden Phantasie, die Sphinx ist eine Kombinationserfindung.
Das sind ein paar wichtigste Formen. Jeder versteht sofort ohne
weiteres die Anwendung unseres neuen Terminus.
Etwas schwieriger ist es mit der Entdeckung. Einen als Ganzes
neu entdeckten Inhalt mit Sicherheit nachzuweisen, möchte ich mir
nicht zutrauen, es ist das eine spezifisch literarhistorische Aufgabe.
Gemeinhin bestehen die Entdeckungen in der Kunst in Entdeckung
von Qualitäten, weiter von neuartig geschauten Beziehungen zwischen
Menschen und Dingen, von Sachverhalten, die an sich vielleicht schon
bekannt, aber durch neue Analyse, neue Einfühlung wie in neuem Ge-
wände neu entdeckt dastehen. Ich erinnere z. B. nur an die Ent-
deckung des Milieu in seiner Wichtigkeit für die Erklärung und Be-
schreibung der Persönlichkeit; an die Entdeckung des alltäglichen
Menschen für das Kunstwerk, das vorher nur den außergewöhnlichen
Menschen darstellte; an die Entdeckung der Detailschilderung im Natu-
ralismus. Ich möchte als Beleg vorläufig nur auf einige überraschende
Prädikats- und Attributsbezeichnungen hinweisen, wie man sie in
moderner Dichtung gehäuft vorfindet, Bezeichnungen, die durch neu
entdeckendes Schauen gewonnen wurden. Ich entnehme etwa einem
Gedicht von Rilke: »die Gassen haben einen sachten Gang, /wie
manchmal Menschen gehen im Genesen / nachdenkend: was ist früher
hier gewesen?/und die an Plätze kommen, warten lang auf eine
andre, die mit einem Schritt / über das abendklare Wasser tritt...«
Oder: »In jenen kleinen Städten, wo herum / die alten Häuser wie
ein Jahrmarkt hocken ...« Oder: Spanische Tänzerin:
»Wie in der Hand ein Schwefelzündholz, weiß,
Eh es zur Flamme kommt, nach allen Seiten
Zuckende Zungen streckt —: beginnt im Kreis
Naher Beschauer, hastig, hell und heiß