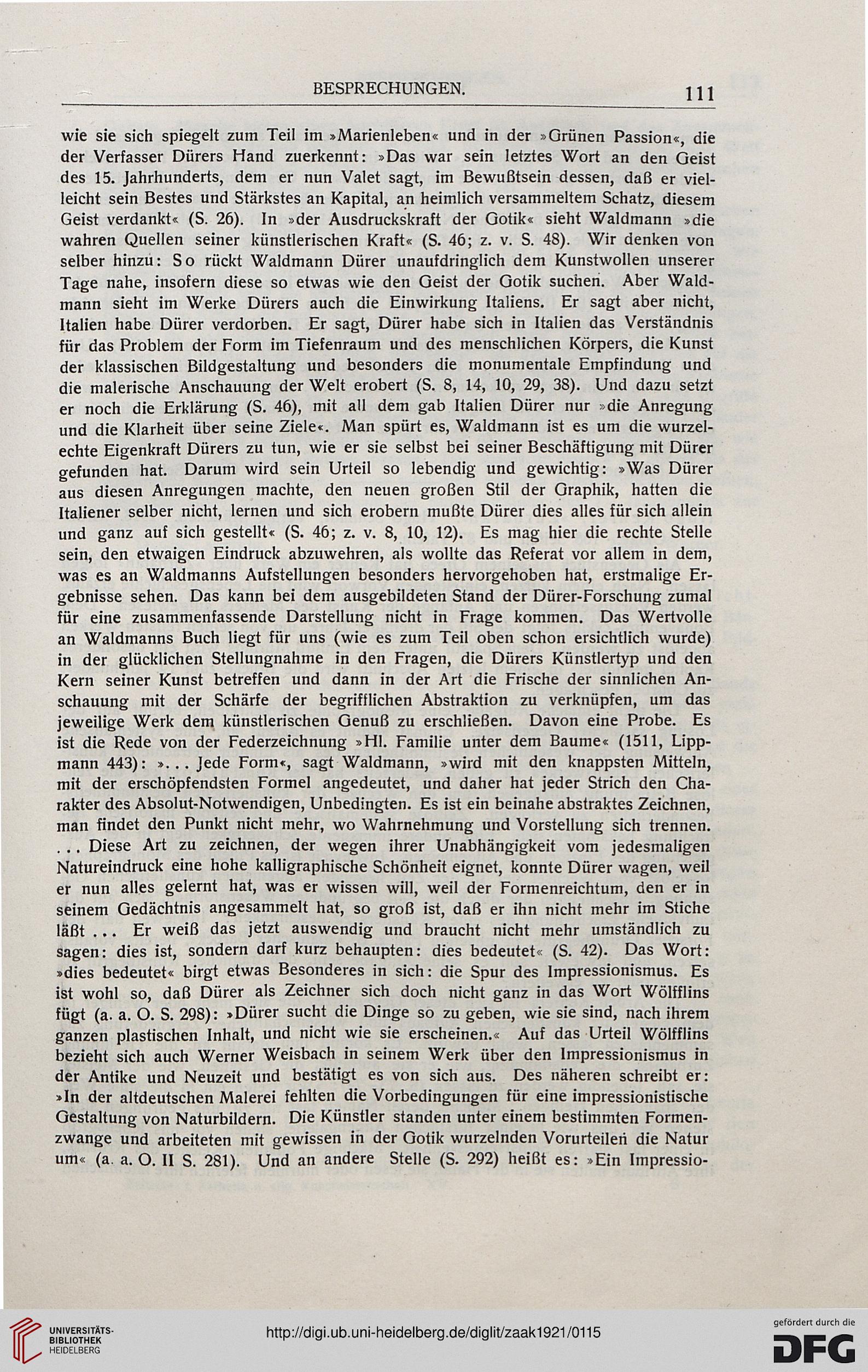BESPRECHUNGEN. ] j j
wie sie sich spiegelt zum Teil im »Marienleben« und in der »Grünen Passion«, die
der Verfasser Dürers Hand zuerkennt: »Das war sein letztes Wort an den Geist
des 15. Jahrhunderts, dem er nun Valet sagt, im Bewußtsein dessen, daß er viel-
leicht sein Bestes und Stärkstes an Kapital, an heimlich versammeltem Schatz, diesem
Geist verdankt« (S. 26). In »der Ausdruckskraft der Gotik« sieht Waldmann »die
wahren Quellen seiner künstlerischen Kraft« (S. 46; z. v. S. 48). Wir denken von
selber hinzu: So rückt Waldmann Dürer unaufdringlich dem Kunstwollen unserer
Tage nahe, insofern diese so etwas wie den Geist der Gotik suchen. Aber Wald-
mann sieht im Werke Dürers auch die Einwirkung Italiens. Er sagt aber nicht,
Italien habe Dürer verdorben. Er sagt, Dürer habe sich in Italien das Verständnis
für das Problem der Form im Tiefenraum und des menschlichen Körpers, die Kunst
der klassischen Bildgestaltung und besonders die monumentale Empfindung und
die malerische Anschauung der Welt erobert (S. 8, 14, 10, 29, 38). Und dazu setzt
er noch die Erklärung (S. 46), mit all dem gab Italien Dürer nur »die Anregung
und die Klarheit über seine Ziele«. Man spürt es, Waldmann ist es um die wurzel-
echte Eigenkraft Dürers zu tun, wie er sie selbst bei seiner Beschäftigung mit Dürer
gefunden hat. Darum wird sein Urteil so lebendig und gewichtig: »Was Dürer
aus diesen Anregungen machte, den neuen großen Stil der Graphik, hatten die
Italiener selber nicht, lernen und sich erobern mußte Dürer dies alles für sich allein
und ganz auf sich gestellt« (S. 46; z. v. 8, 10, 12). Es mag hier die rechte Stelle
sein, den etwaigen Eindruck abzuwehren, als wollte das Referat vor allem in dem,
was es an Waldmanns Aufstellungen besonders hervorgehoben hat, erstmalige Er-
gebnisse sehen. Das kann bei dem ausgebildeten Stand der Dürer-Forschung zumal
für eine zusammenfassende Darstellung nicht in Frage kommen. Das Wertvolle
an Waldmanns Buch liegt für uns (wie es zum Teil oben schon ersichtlich wurde)
in der glücklichen Stellungnahme in den Fragen, die Dürers Künstlertyp und den
Kern seiner Kunst betreffen und dann in der Art die Frische der sinnlichen An-
schauung mit der Schärfe der begrifflichen Abstraktion zu verknüpfen, um das
jeweilige Werk dem künstlerischen Genuß zu erschließen. Davon eine Probe. Es
ist die Rede von der Federzeichnung »Hl. Familie unter dem Baume« (1511, Lipp-
mann 443): ». . . Jede Form«, sagt Waldmann, »wird mit den knappsten Mitteln,
mit der erschöpfendsten Formel angedeutet, und daher hat jeder Strich den Cha-
rakter des Absolut-Notwendigen, Unbedingten. Es ist ein beinahe abstraktes Zeichnen,
man findet den Punkt nicht mehr, wo Wahrnehmung und Vorstellung sich trennen.
. .. Diese Art zu zeichnen, der wegen ihrer Unabhängigkeit vom jedesmaligen
Natureindruck eine hohe kalligraphische Schönheit eignet, konnte Dürer wagen, weil
er nun alles gelernt hat, was er wissen will, weil der Formenreichtum, den er in
seinem Gedächtnis angesammelt hat, so groß ist, daß er ihn nicht mehr im Stiche
läßt ... Er weiß das jetzt auswendig und braucht nicht mehr umständlich zu
sagen: dies ist, sondern darf kurz behaupten: dies bedeutet« (S. 42). Das Wort:
»dies bedeutet« birgt etwas Besonderes in sich: die Spur des Impressionismus. Es
ist wohl so, daß Dürer als Zeichner sich doch nicht ganz in das Wort Wölfflins
fügt (a. a. O. S. 298): »Dürer sucht die Dinge so zu geben, wie sie sind, nach ihrem
ganzen plastischen Inhalt, und nicht wie sie erscheinen.« Auf das Urteil Wölfflins
bezieht sich auch Werner Weisbach in seinem Werk über den Impressionismus in
der Antike und Neuzeit und bestätigt es von sich aus. Des näheren schreibt er:
»In der altdeutschen Malerei fehlten die Vorbedingungen für eine impressionistische
Gestaltung von Naturbildern. Die Künstler standen unter einem bestimmten Formen-
zwange und arbeiteten mit gewissen in der Gotik wurzelnden Vorurteilen die Natur
um« (a. a. O. II S. 281). Und an andere Stelle (S. 292) heißt es: »Ein Impressio-
wie sie sich spiegelt zum Teil im »Marienleben« und in der »Grünen Passion«, die
der Verfasser Dürers Hand zuerkennt: »Das war sein letztes Wort an den Geist
des 15. Jahrhunderts, dem er nun Valet sagt, im Bewußtsein dessen, daß er viel-
leicht sein Bestes und Stärkstes an Kapital, an heimlich versammeltem Schatz, diesem
Geist verdankt« (S. 26). In »der Ausdruckskraft der Gotik« sieht Waldmann »die
wahren Quellen seiner künstlerischen Kraft« (S. 46; z. v. S. 48). Wir denken von
selber hinzu: So rückt Waldmann Dürer unaufdringlich dem Kunstwollen unserer
Tage nahe, insofern diese so etwas wie den Geist der Gotik suchen. Aber Wald-
mann sieht im Werke Dürers auch die Einwirkung Italiens. Er sagt aber nicht,
Italien habe Dürer verdorben. Er sagt, Dürer habe sich in Italien das Verständnis
für das Problem der Form im Tiefenraum und des menschlichen Körpers, die Kunst
der klassischen Bildgestaltung und besonders die monumentale Empfindung und
die malerische Anschauung der Welt erobert (S. 8, 14, 10, 29, 38). Und dazu setzt
er noch die Erklärung (S. 46), mit all dem gab Italien Dürer nur »die Anregung
und die Klarheit über seine Ziele«. Man spürt es, Waldmann ist es um die wurzel-
echte Eigenkraft Dürers zu tun, wie er sie selbst bei seiner Beschäftigung mit Dürer
gefunden hat. Darum wird sein Urteil so lebendig und gewichtig: »Was Dürer
aus diesen Anregungen machte, den neuen großen Stil der Graphik, hatten die
Italiener selber nicht, lernen und sich erobern mußte Dürer dies alles für sich allein
und ganz auf sich gestellt« (S. 46; z. v. 8, 10, 12). Es mag hier die rechte Stelle
sein, den etwaigen Eindruck abzuwehren, als wollte das Referat vor allem in dem,
was es an Waldmanns Aufstellungen besonders hervorgehoben hat, erstmalige Er-
gebnisse sehen. Das kann bei dem ausgebildeten Stand der Dürer-Forschung zumal
für eine zusammenfassende Darstellung nicht in Frage kommen. Das Wertvolle
an Waldmanns Buch liegt für uns (wie es zum Teil oben schon ersichtlich wurde)
in der glücklichen Stellungnahme in den Fragen, die Dürers Künstlertyp und den
Kern seiner Kunst betreffen und dann in der Art die Frische der sinnlichen An-
schauung mit der Schärfe der begrifflichen Abstraktion zu verknüpfen, um das
jeweilige Werk dem künstlerischen Genuß zu erschließen. Davon eine Probe. Es
ist die Rede von der Federzeichnung »Hl. Familie unter dem Baume« (1511, Lipp-
mann 443): ». . . Jede Form«, sagt Waldmann, »wird mit den knappsten Mitteln,
mit der erschöpfendsten Formel angedeutet, und daher hat jeder Strich den Cha-
rakter des Absolut-Notwendigen, Unbedingten. Es ist ein beinahe abstraktes Zeichnen,
man findet den Punkt nicht mehr, wo Wahrnehmung und Vorstellung sich trennen.
. .. Diese Art zu zeichnen, der wegen ihrer Unabhängigkeit vom jedesmaligen
Natureindruck eine hohe kalligraphische Schönheit eignet, konnte Dürer wagen, weil
er nun alles gelernt hat, was er wissen will, weil der Formenreichtum, den er in
seinem Gedächtnis angesammelt hat, so groß ist, daß er ihn nicht mehr im Stiche
läßt ... Er weiß das jetzt auswendig und braucht nicht mehr umständlich zu
sagen: dies ist, sondern darf kurz behaupten: dies bedeutet« (S. 42). Das Wort:
»dies bedeutet« birgt etwas Besonderes in sich: die Spur des Impressionismus. Es
ist wohl so, daß Dürer als Zeichner sich doch nicht ganz in das Wort Wölfflins
fügt (a. a. O. S. 298): »Dürer sucht die Dinge so zu geben, wie sie sind, nach ihrem
ganzen plastischen Inhalt, und nicht wie sie erscheinen.« Auf das Urteil Wölfflins
bezieht sich auch Werner Weisbach in seinem Werk über den Impressionismus in
der Antike und Neuzeit und bestätigt es von sich aus. Des näheren schreibt er:
»In der altdeutschen Malerei fehlten die Vorbedingungen für eine impressionistische
Gestaltung von Naturbildern. Die Künstler standen unter einem bestimmten Formen-
zwange und arbeiteten mit gewissen in der Gotik wurzelnden Vorurteilen die Natur
um« (a. a. O. II S. 281). Und an andere Stelle (S. 292) heißt es: »Ein Impressio-