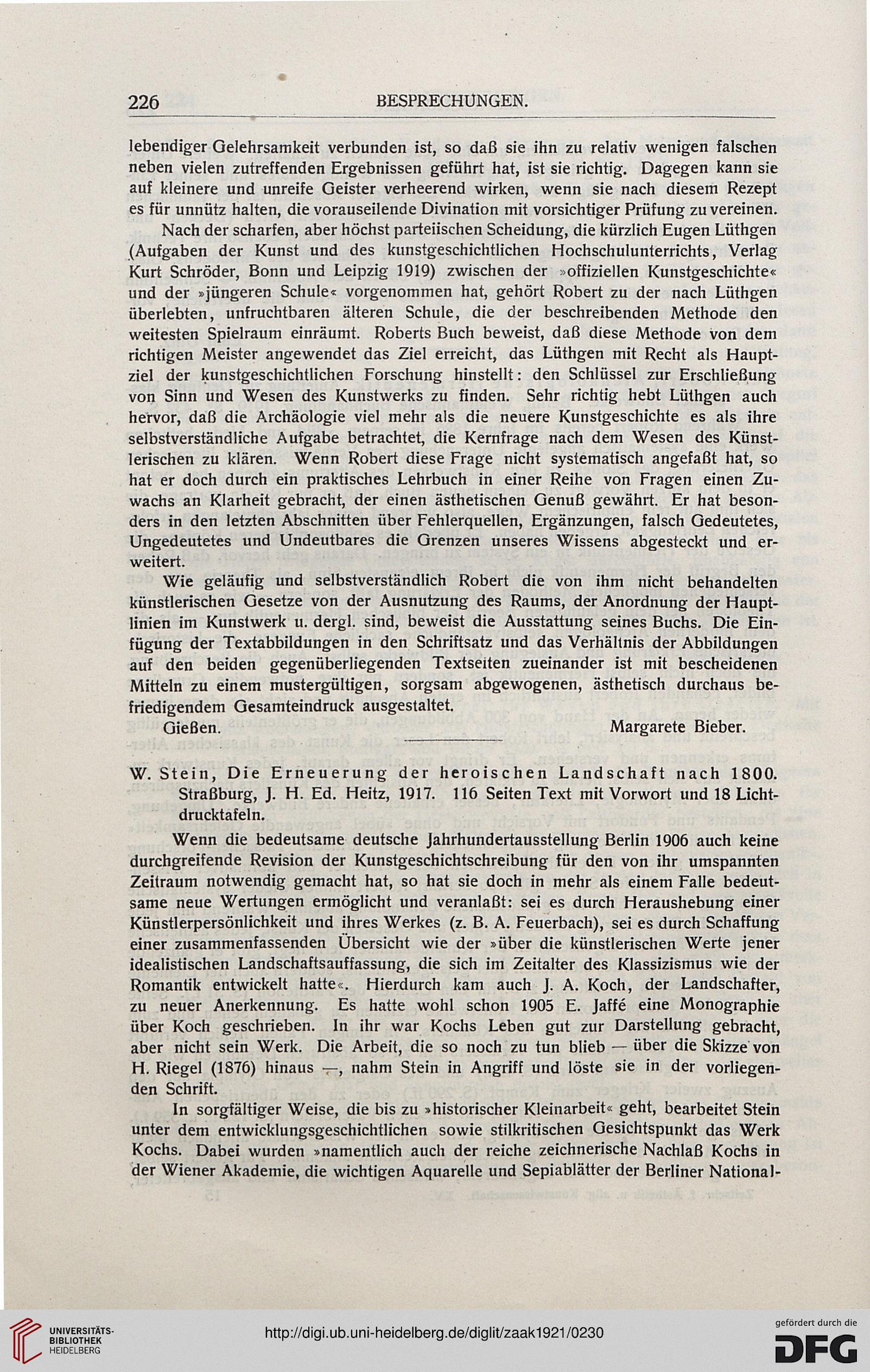226 BESPRECHUNGEN.
lebendiger Gelehrsamkeit verbunden ist, so daß sie ihn zu relativ wenigen falschen
neben vielen zutreffenden Ergebnissen geführt hat, ist sie richtig. Dagegen kann sie
auf kleinere und unreife Geister verheerend wirken, wenn sie nach diesem Rezept
es für unnütz halten, die vorauseilende Divination mit vorsichtiger Prüfung zu vereinen.
Nach der scharfen, aber höchst parteiischen Scheidung, die kürzlich Eugen Lüthgen
(Aufgaben der Kunst und des kunstgeschichtlichen Hochschulunterrichts, Verlag
Kurt Schröder, Bonn und Leipzig 1919) zwischen der »offiziellen Kunstgeschichte«
und der »jüngeren Schule* vorgenommen hat, gehört Robert zu der nach Lüthgen
überlebten, unfruchtbaren älteren Schule, die der beschreibenden Methode den
weitesten Spielraum einräumt. Roberts Buch beweist, daß diese Methode von dem
richtigen Meister angewendet das Ziel erreicht, das Lüthgen mit Recht als Haupt-
ziel der kunstgeschichtlichen Forschung hinstellt: den Schlüssel zur Erschließung
von Sinn und Wesen des Kunstwerks zu finden. Sehr richtig hebt Lüthgen auch
hervor, daß die Archäologie viel mehr als die neuere Kunstgeschichte es als ihre
selbstverständliche Aufgabe betrachtet, die Kernfrage nach dem Wesen des Künst-
lerischen zu klären. Wenn Robert diese Frage nicht systematisch angefaßt hat, so
hat er doch durch ein praktisches Lehrbuch in einer Reihe von Fragen einen Zu-
wachs an Klarheit gebracht, der einen ästhetischen Genuß gewährt. Er hat beson-
ders in den letzten Abschnitten über Fehlerquellen, Ergänzungen, falsch Gedeutetes,
Ungedeutetes und Undeutbares die Grenzen unseres Wissens abgesteckt und er-
weitert.
Wie geläufig und selbstverständlich Robert die von ihm nicht behandelten
künstlerischen Gesetze von der Ausnutzung des Raums, der Anordnung der Haupt-
linien im Kunstwerk u. dergl. sind, beweist die Ausstattung seines Buchs. Die Ein-
fügung der Textabbildungen in den Schriftsatz und das Verhältnis der Abbildungen
auf den beiden gegenüberliegenden Textseiten zueinander ist mit bescheidenen
Mitteln zu einem mustergültigen, sorgsam abgewogenen, ästhetisch durchaus be-
friedigendem Gesamteindruck ausgestaltet.
Gießen. Margarete Bieber.
W. Stein, Die Erneuerung der heroischen Landschaft nach 1800.
Straßburg, J. H. Ed. Heitz, 1917. 116 Seiten Text mit Vorwort und 18 Licht-
drucktafeln.
Wenn die bedeutsame deutsche Jahrhundertausstellung Berlin 1906 auch keine
durchgreifende Revision der Kunstgeschichtschreibung für den von ihr umspannten
Zeitraum notwendig gemacht hat, so hat sie doch in mehr als einem Falle bedeut-
same neue Wertungen ermöglicht und veranlaßt: sei es durch Heraushebung einer
Künstlerpersönlichkeit und ihres Werkes (z. B. A. Feuerbach), sei es durch Schaffung
einer zusammenfassenden Übersicht wie der »über die künstlerischen Werte jener
idealistischen Landschaftsauffassung, die sich im Zeitalter des Klassizismus wie der
Romantik entwickelt hatte«. Hierdurch kam auch J. A. Koch, der Landschafter,
zu neuer Anerkennung. Es hatte wohl schon 1905 E. Jaffe eine Monographie
über Koch geschrieben. In ihr war Kochs Leben gut zur Darstellung gebracht,
aber nicht sein Werk. Die Arbeit, die so noch zu tun blieb — über die Skizze von
H. Riegel (1876) hinaus —, nahm Stein in Angriff und löste sie in der vorliegen-
den Schrift.
In sorgfältiger Weise, die bis zu »historischer Kleinarbeit« geht, bearbeitet Stein
unter dem entwicklungsgeschichtlichen sowie stilkritischen Gesichtspunkt das Werk
Kochs. Dabei wurden »namentlich auch der reiche zeichnerische Nachlaß Kochs in
der Wiener Akademie, die wichtigen Aquarelle und Sepiablätter der Berliner National-
lebendiger Gelehrsamkeit verbunden ist, so daß sie ihn zu relativ wenigen falschen
neben vielen zutreffenden Ergebnissen geführt hat, ist sie richtig. Dagegen kann sie
auf kleinere und unreife Geister verheerend wirken, wenn sie nach diesem Rezept
es für unnütz halten, die vorauseilende Divination mit vorsichtiger Prüfung zu vereinen.
Nach der scharfen, aber höchst parteiischen Scheidung, die kürzlich Eugen Lüthgen
(Aufgaben der Kunst und des kunstgeschichtlichen Hochschulunterrichts, Verlag
Kurt Schröder, Bonn und Leipzig 1919) zwischen der »offiziellen Kunstgeschichte«
und der »jüngeren Schule* vorgenommen hat, gehört Robert zu der nach Lüthgen
überlebten, unfruchtbaren älteren Schule, die der beschreibenden Methode den
weitesten Spielraum einräumt. Roberts Buch beweist, daß diese Methode von dem
richtigen Meister angewendet das Ziel erreicht, das Lüthgen mit Recht als Haupt-
ziel der kunstgeschichtlichen Forschung hinstellt: den Schlüssel zur Erschließung
von Sinn und Wesen des Kunstwerks zu finden. Sehr richtig hebt Lüthgen auch
hervor, daß die Archäologie viel mehr als die neuere Kunstgeschichte es als ihre
selbstverständliche Aufgabe betrachtet, die Kernfrage nach dem Wesen des Künst-
lerischen zu klären. Wenn Robert diese Frage nicht systematisch angefaßt hat, so
hat er doch durch ein praktisches Lehrbuch in einer Reihe von Fragen einen Zu-
wachs an Klarheit gebracht, der einen ästhetischen Genuß gewährt. Er hat beson-
ders in den letzten Abschnitten über Fehlerquellen, Ergänzungen, falsch Gedeutetes,
Ungedeutetes und Undeutbares die Grenzen unseres Wissens abgesteckt und er-
weitert.
Wie geläufig und selbstverständlich Robert die von ihm nicht behandelten
künstlerischen Gesetze von der Ausnutzung des Raums, der Anordnung der Haupt-
linien im Kunstwerk u. dergl. sind, beweist die Ausstattung seines Buchs. Die Ein-
fügung der Textabbildungen in den Schriftsatz und das Verhältnis der Abbildungen
auf den beiden gegenüberliegenden Textseiten zueinander ist mit bescheidenen
Mitteln zu einem mustergültigen, sorgsam abgewogenen, ästhetisch durchaus be-
friedigendem Gesamteindruck ausgestaltet.
Gießen. Margarete Bieber.
W. Stein, Die Erneuerung der heroischen Landschaft nach 1800.
Straßburg, J. H. Ed. Heitz, 1917. 116 Seiten Text mit Vorwort und 18 Licht-
drucktafeln.
Wenn die bedeutsame deutsche Jahrhundertausstellung Berlin 1906 auch keine
durchgreifende Revision der Kunstgeschichtschreibung für den von ihr umspannten
Zeitraum notwendig gemacht hat, so hat sie doch in mehr als einem Falle bedeut-
same neue Wertungen ermöglicht und veranlaßt: sei es durch Heraushebung einer
Künstlerpersönlichkeit und ihres Werkes (z. B. A. Feuerbach), sei es durch Schaffung
einer zusammenfassenden Übersicht wie der »über die künstlerischen Werte jener
idealistischen Landschaftsauffassung, die sich im Zeitalter des Klassizismus wie der
Romantik entwickelt hatte«. Hierdurch kam auch J. A. Koch, der Landschafter,
zu neuer Anerkennung. Es hatte wohl schon 1905 E. Jaffe eine Monographie
über Koch geschrieben. In ihr war Kochs Leben gut zur Darstellung gebracht,
aber nicht sein Werk. Die Arbeit, die so noch zu tun blieb — über die Skizze von
H. Riegel (1876) hinaus —, nahm Stein in Angriff und löste sie in der vorliegen-
den Schrift.
In sorgfältiger Weise, die bis zu »historischer Kleinarbeit« geht, bearbeitet Stein
unter dem entwicklungsgeschichtlichen sowie stilkritischen Gesichtspunkt das Werk
Kochs. Dabei wurden »namentlich auch der reiche zeichnerische Nachlaß Kochs in
der Wiener Akademie, die wichtigen Aquarelle und Sepiablätter der Berliner National-