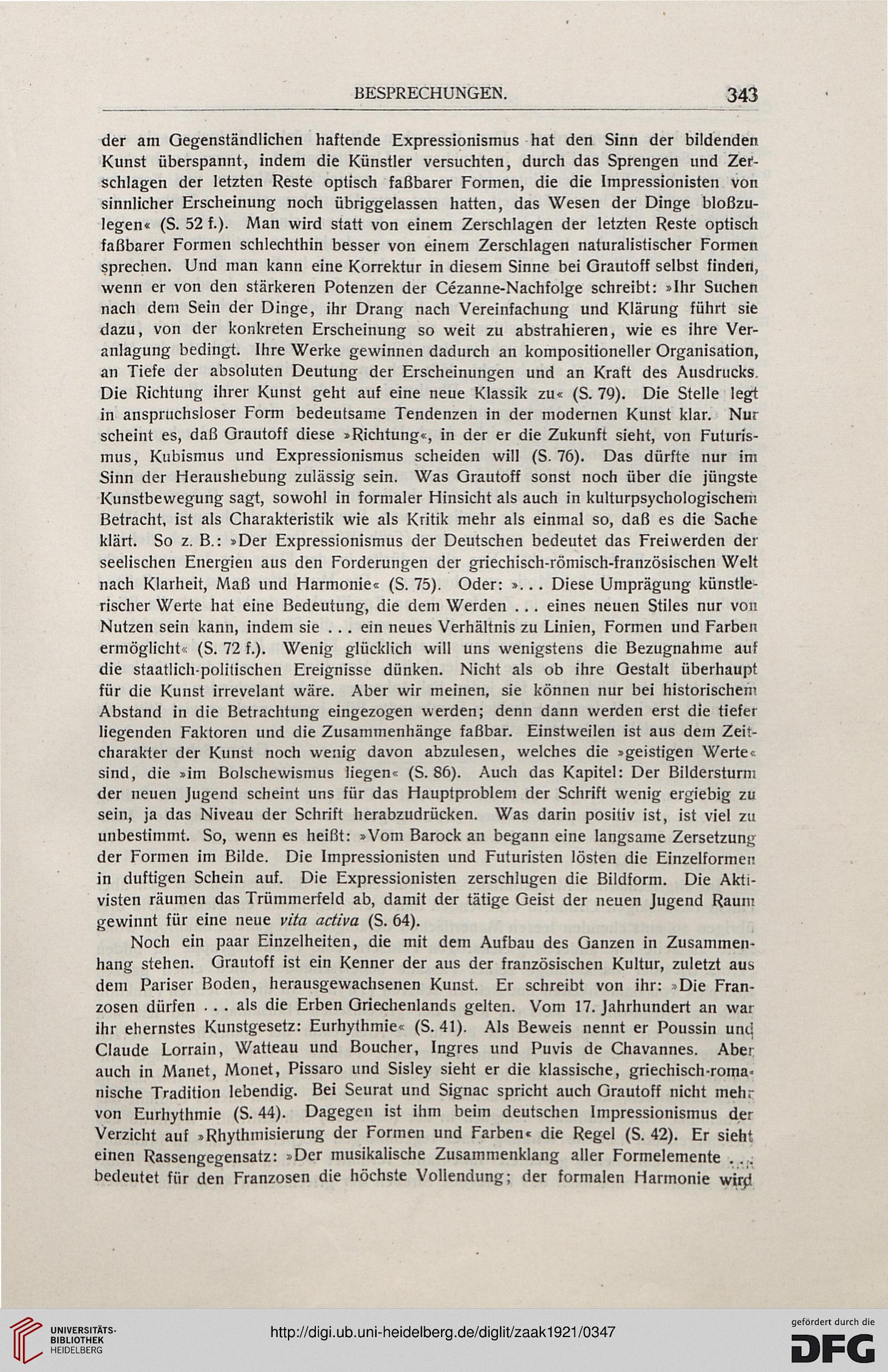BESPRECHUNGEN. 343
der am Gegenständlichen haftende Expressionismus hat den Sinn der bildenden
Kunst überspannt, indem die Künstler versuchten, durch das Sprengen und Zer-
schlagen der letzten Reste optisch faßbarer Formen, die die Impressionisten von
sinnlicher Erscheinung noch übriggelassen hatten, das Wesen der Dinge bloßzu-
legen« (S. 52 f.). Man wird statt von einem Zerschlagen der letzten Reste optisch
faßbarer Formen schlechthin besser von einem Zerschlagen naturalistischer Formen
sprechen. Und man kann eine Korrektur in diesem Sinne bei Grautoff selbst finden,
wenn er von den stärkeren Potenzen der Cezanne-Nachfolge schreibt: »Ihr Suchen
nach dem Sein der Dinge, ihr Drang nach Vereinfachung und Klärung führt sie
dazu, von der konkreten Erscheinung so weit zu abstrahieren, wie es ihre Ver-
anlagung bedingt. Ihre Werke gewinnen dadurch an kompositioneller Organisation,
an Tiefe der absoluten Deutung der Erscheinungen und an Kraft des Ausdrucks.
Die Richtung ihrer Kunst geht auf eine neue Klassik zu« (S. 79). Die Stelle legt
in anspruchsloser Form bedeutsame Tendenzen in der modernen Kunst klar. Nur
scheint es, daß Grautoff diese »Richtung«, in der er die Zukunft sieht, von Futuris-
mus, Kubismus und Expressionismus scheiden will (S. 76). Das dürfte nur im
Sinn der Heraushebung zulässig sein. Was Grautoff sonst noch über die jüngste
Kunstbewegung sagt, sowohl in formaler Hinsicht als auch in kulturpsychologischem
Betracht, ist als Charakteristik wie als Kritik mehr als einmal so, daß es die Sache
klärt. So z. B.: »Der Expressionismus der Deutschen bedeutet das Freiwerden der
seelischen Energien aus den Forderungen der griechisch-römisch-französischen Welt
nach Klarheit, Maß und Harmonie« (S. 75). Oder: ».. . Diese Umprägung künstle-
rischer Werte hat eine Bedeutung, die dem Werden ... eines neuen Stiles nur von
Nutzen sein kann, indem sie ... ein neues Verhältnis zu Linien, Formen und Farben
ermöglicht« (S. 72 f.). Wenig glücklich will uns wenigstens die Bezugnahme auf
die staatlich-politischen Ereignisse dünken. Nicht als ob ihre Gestalt überhaupt
für die Kunst irrevelant wäre. Aber wir meinen, sie können nur bei historischem
Abstand in die Betrachtung eingezogen werden; denn dann werden erst die tiefer
liegenden Faktoren und die Zusammenhänge faßbar. Einstweilen ist aus dem Zeit-
charakter der Kunst noch wenig davon abzulesen, welches die »geistigen Werte«
sind, die »im Bolschewismus liegen« (S. 86). Auch das Kapitel: Der Bildersturm
der neuen Jugend scheint uns für das Hauptproblem der Schrift wenig ergiebig zu
sein, ja das Niveau der Schrift herabzudrücken. Was darin positiv ist, ist viel zu
unbestimmt. So, wenn es heißt: »Vom Barock an begann eine langsame Zersetzung
der Formen im Bilde. Die Impressionisten und Futuristen lösten die Einzelformen
in duftigen Schein auf. Die Expressionisten zerschlugen die Bildform. Die Akti-
visten räumen das Trümmerfeld ab, damit der tätige Geist der neuen Jugend Raum
gewinnt für eine neue vita activa (S. 64).
Noch ein paar Einzelheiten, die mit dem Aufbau des Ganzen in Zusammen-
hang stehen. Grautoff ist ein Kenner der aus der französischen Kultur, zuletzt aus
dem Pariser Boden, herausgewachsenen Kunst. Er schreibt von ihr: »Die Fran-
zosen dürfeii ... als die Erben Griechenlands gelten. Vom 17. Jahrhundert an war
ihr ehernstes Kunstgesetz: Eurhythmie« (S. 41). Als Beweis nennt er Poussin und
Claude Lorrain, Watteau und Boucher, Ingres und Puvis de Chavannes. Aber
auch in Manet, Monet, Pissaro und Sisley sieht er die klassische, griechisch-roma-
nische Tradition lebendig. Bei Seurat und Signac spricht auch Grautoff nicht mehr
von Eurhythmie (S. 44). Dagegen ist ihm beim deutschen Impressionismus der
Verzicht auf »Rhythmisierung der Formen und Farben« die Regel (S. 42). Er sieht
einen Rassengegensatz: »Der musikalische Zusammenklang aller Formelemente ....
bedeutet für den Franzosen die höchste Vollendung; der formalen Harmonie wird
der am Gegenständlichen haftende Expressionismus hat den Sinn der bildenden
Kunst überspannt, indem die Künstler versuchten, durch das Sprengen und Zer-
schlagen der letzten Reste optisch faßbarer Formen, die die Impressionisten von
sinnlicher Erscheinung noch übriggelassen hatten, das Wesen der Dinge bloßzu-
legen« (S. 52 f.). Man wird statt von einem Zerschlagen der letzten Reste optisch
faßbarer Formen schlechthin besser von einem Zerschlagen naturalistischer Formen
sprechen. Und man kann eine Korrektur in diesem Sinne bei Grautoff selbst finden,
wenn er von den stärkeren Potenzen der Cezanne-Nachfolge schreibt: »Ihr Suchen
nach dem Sein der Dinge, ihr Drang nach Vereinfachung und Klärung führt sie
dazu, von der konkreten Erscheinung so weit zu abstrahieren, wie es ihre Ver-
anlagung bedingt. Ihre Werke gewinnen dadurch an kompositioneller Organisation,
an Tiefe der absoluten Deutung der Erscheinungen und an Kraft des Ausdrucks.
Die Richtung ihrer Kunst geht auf eine neue Klassik zu« (S. 79). Die Stelle legt
in anspruchsloser Form bedeutsame Tendenzen in der modernen Kunst klar. Nur
scheint es, daß Grautoff diese »Richtung«, in der er die Zukunft sieht, von Futuris-
mus, Kubismus und Expressionismus scheiden will (S. 76). Das dürfte nur im
Sinn der Heraushebung zulässig sein. Was Grautoff sonst noch über die jüngste
Kunstbewegung sagt, sowohl in formaler Hinsicht als auch in kulturpsychologischem
Betracht, ist als Charakteristik wie als Kritik mehr als einmal so, daß es die Sache
klärt. So z. B.: »Der Expressionismus der Deutschen bedeutet das Freiwerden der
seelischen Energien aus den Forderungen der griechisch-römisch-französischen Welt
nach Klarheit, Maß und Harmonie« (S. 75). Oder: ».. . Diese Umprägung künstle-
rischer Werte hat eine Bedeutung, die dem Werden ... eines neuen Stiles nur von
Nutzen sein kann, indem sie ... ein neues Verhältnis zu Linien, Formen und Farben
ermöglicht« (S. 72 f.). Wenig glücklich will uns wenigstens die Bezugnahme auf
die staatlich-politischen Ereignisse dünken. Nicht als ob ihre Gestalt überhaupt
für die Kunst irrevelant wäre. Aber wir meinen, sie können nur bei historischem
Abstand in die Betrachtung eingezogen werden; denn dann werden erst die tiefer
liegenden Faktoren und die Zusammenhänge faßbar. Einstweilen ist aus dem Zeit-
charakter der Kunst noch wenig davon abzulesen, welches die »geistigen Werte«
sind, die »im Bolschewismus liegen« (S. 86). Auch das Kapitel: Der Bildersturm
der neuen Jugend scheint uns für das Hauptproblem der Schrift wenig ergiebig zu
sein, ja das Niveau der Schrift herabzudrücken. Was darin positiv ist, ist viel zu
unbestimmt. So, wenn es heißt: »Vom Barock an begann eine langsame Zersetzung
der Formen im Bilde. Die Impressionisten und Futuristen lösten die Einzelformen
in duftigen Schein auf. Die Expressionisten zerschlugen die Bildform. Die Akti-
visten räumen das Trümmerfeld ab, damit der tätige Geist der neuen Jugend Raum
gewinnt für eine neue vita activa (S. 64).
Noch ein paar Einzelheiten, die mit dem Aufbau des Ganzen in Zusammen-
hang stehen. Grautoff ist ein Kenner der aus der französischen Kultur, zuletzt aus
dem Pariser Boden, herausgewachsenen Kunst. Er schreibt von ihr: »Die Fran-
zosen dürfeii ... als die Erben Griechenlands gelten. Vom 17. Jahrhundert an war
ihr ehernstes Kunstgesetz: Eurhythmie« (S. 41). Als Beweis nennt er Poussin und
Claude Lorrain, Watteau und Boucher, Ingres und Puvis de Chavannes. Aber
auch in Manet, Monet, Pissaro und Sisley sieht er die klassische, griechisch-roma-
nische Tradition lebendig. Bei Seurat und Signac spricht auch Grautoff nicht mehr
von Eurhythmie (S. 44). Dagegen ist ihm beim deutschen Impressionismus der
Verzicht auf »Rhythmisierung der Formen und Farben« die Regel (S. 42). Er sieht
einen Rassengegensatz: »Der musikalische Zusammenklang aller Formelemente ....
bedeutet für den Franzosen die höchste Vollendung; der formalen Harmonie wird