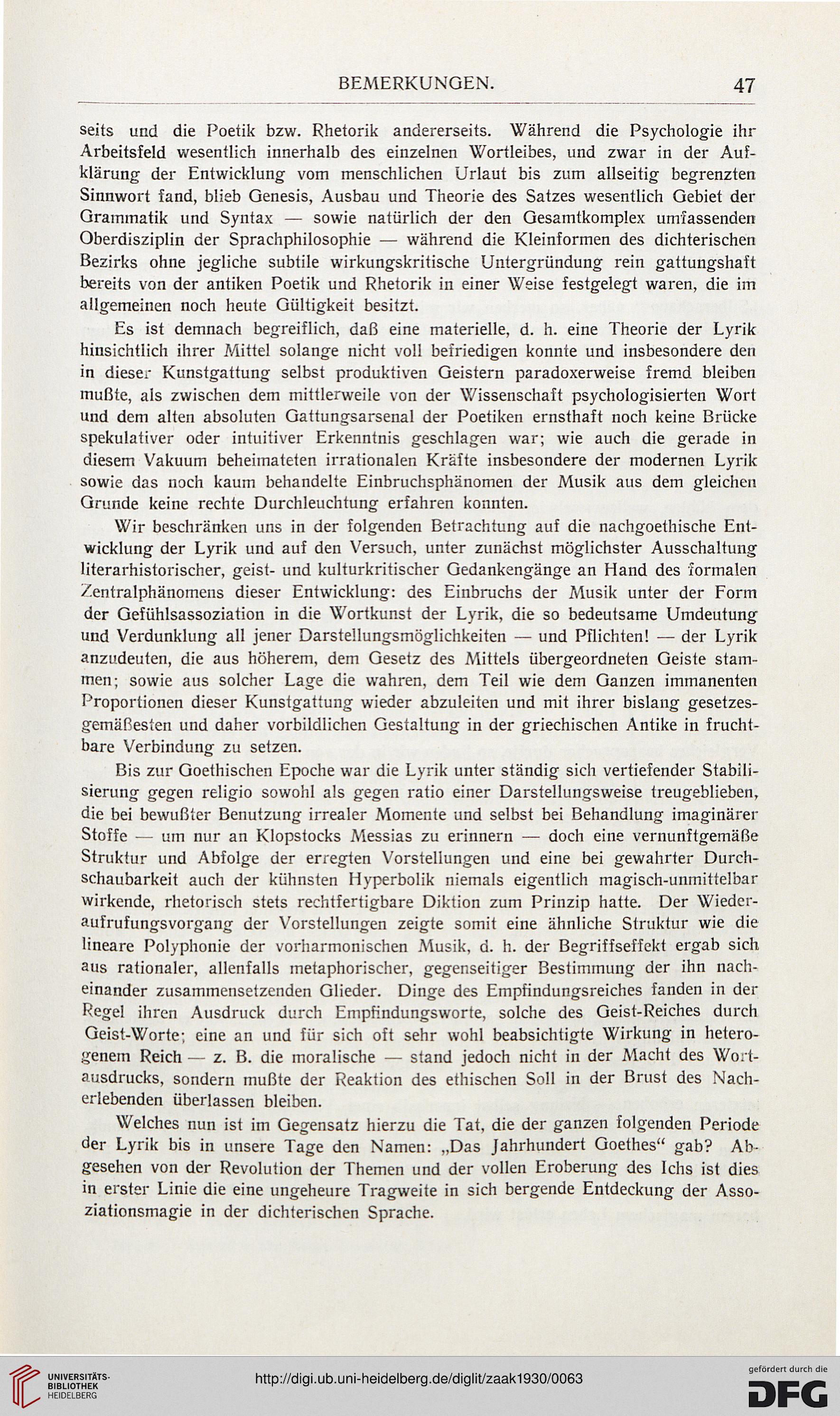47
seits und die Poetik bzw. Rhetorik andererseits. Während die Psychologie ihr
Arbeitsfeld wesentlich innerhalb des einzelnen Wortleibes, und zwar in der Auf-
klärung der Entwicklung vom menschlichen Urlaut bis zum allseitig begrenzten
Sinnwort fand, blieb Genesis, Ausbau und Theorie des Satzes wesentlich Gebiet der
Grammatik und Syntax — sowie natürlich der den Gesamtkomplex umfassenden
Oberdisziplin der Sprachphilosophie — während die Kleinformen des dichterischen
Bezirks ohne jegliche subtile wirkungskritische Untergründung rein gattungshaft
bereits von der antiken Poetik und Rhetorik in einer Weise festgelegt waren, die im
allgemeinen noch heute Gültigkeit besitzt.
Es ist demnach begreiflich, daß eine materielle, d. h. eine Theorie der Lyrik
hinsichtlich ihrer Mittel solange nicht voll befriedigen konnte und insbesondere den
in dieser Kunstgattung selbst produktiven Geistern paradoxerweise fremd bleiben
mußte, als zwischen dem mittlerweile von der Wissenschaft psychologisierten Wort
und dem alten absoluten Gattungsarsenal der Poetiken ernsthaft noch keine Brücke
spekulativer oder intuitiver Erkenntnis geschlagen war; wie auch die gerade in
diesem Vakuum beheimateten irrationalen Kräfte insbesondere der modernen Lyrik
sowie das noch kaum behandelte Einbruchsphänomen der Musik aus dem gleichen
Grunde keine rechte Durchleuchtung erfahren konnten.
Wir beschränken uns in der folgenden Betrachtung auf die nachgoethische Ent-
wicklung der Lyrik und auf den Versuch, unter zunächst möglichster Ausschaltung
literarhistorischer, geist- und kulturkritischer Gedankengänge an Hand des formalen
/'entralphänomens dieser Entwicklung: des Einbruchs der Musik unter der Form
der Gefühlsassoziation in die Wortkunst der Lyrik, die so bedeutsame Umdeutung
und Verdunklung all jener Darstellungsmöglichkeiten — und Pflichten! — der Lyrik
anzudeuten, die aus höherem, dem Gesetz des Mittels übergeordneten Geiste stam-
men; sowie aus solcher Lage die wahren, dem Teil wie dem Ganzen immanenten
Proportionen dieser Kunstgattung wieder abzuleiten und mit ihrer bislang gesetzes-
gemäßesten und daher vorbildlichen Gestaltung in der griechischen Antike in frucht-
bare Verbindung zu setzen.
Bis zur Goethischen Epoche war die Lyrik unter ständig sich vertiefender Stabili-
sierung gegen religio sowohl als gegen ratio einer Darstellungsweise treugeblieben,
die bei bewußter Benutzung irrealer Momente und selbst bei Behandlung imaginärer
Stoffe — um nur an Klopstocks Messias zu erinnern — doch eine vernunftgemäße
Struktur und Abfolge der erregten Vorstellungen und eine bei gewahrter Durch-
schaubarkeit auch der kühnsten Hyperbolik niemals eigentlich magisch-unmittelbar
wirkende, rhetorisch stets rechtfertigbare Diktion zum Prinzip hatte. Der Wieder-
aufruf ungsvorgang der Vorstellungen zeigte somit eine ähnliche Struktur wie die
lineare Polyphonie der vorharmonischen Musik, d. h. der Begriffseffekt ergab sich
aus rationaler, allenfalls metaphorischer, gegenseitiger Bestimmung der ihn nach-
einander zusammensetzenden Glieder. Dinge des Empfindungsreiches fanden in der
Regel ihren Ausdruck durch Empfindungsworte, solche des Geist-Reiches durch
Geist-Worte; eine an und für sich oft sehr wohl beabsichtigte Wirkung in hetero-
genem Reich — z. B. die moralische — stand jedoch nicht in der Macht des Wort-
ausdrucks, sondern mußte der Reaktion des ethischen Soll in der Brust des Nach-
erlebenden überlassen bleiben.
Welches nun ist im Gegensatz hierzu die Tat, die der ganzen folgenden Periode
der Lyrik bis in unsere Tage den Namen: „Das Jahrhundert Goethes" gab? Ab-
gesehen von der Revolution der Themen und der vollen Eroberung des Ichs ist dies
in erster Linie die eine ungeheure Tragweite in sich bergende Entdeckung der Asso-
ziationsmagie in der dichterischen Sprache.
seits und die Poetik bzw. Rhetorik andererseits. Während die Psychologie ihr
Arbeitsfeld wesentlich innerhalb des einzelnen Wortleibes, und zwar in der Auf-
klärung der Entwicklung vom menschlichen Urlaut bis zum allseitig begrenzten
Sinnwort fand, blieb Genesis, Ausbau und Theorie des Satzes wesentlich Gebiet der
Grammatik und Syntax — sowie natürlich der den Gesamtkomplex umfassenden
Oberdisziplin der Sprachphilosophie — während die Kleinformen des dichterischen
Bezirks ohne jegliche subtile wirkungskritische Untergründung rein gattungshaft
bereits von der antiken Poetik und Rhetorik in einer Weise festgelegt waren, die im
allgemeinen noch heute Gültigkeit besitzt.
Es ist demnach begreiflich, daß eine materielle, d. h. eine Theorie der Lyrik
hinsichtlich ihrer Mittel solange nicht voll befriedigen konnte und insbesondere den
in dieser Kunstgattung selbst produktiven Geistern paradoxerweise fremd bleiben
mußte, als zwischen dem mittlerweile von der Wissenschaft psychologisierten Wort
und dem alten absoluten Gattungsarsenal der Poetiken ernsthaft noch keine Brücke
spekulativer oder intuitiver Erkenntnis geschlagen war; wie auch die gerade in
diesem Vakuum beheimateten irrationalen Kräfte insbesondere der modernen Lyrik
sowie das noch kaum behandelte Einbruchsphänomen der Musik aus dem gleichen
Grunde keine rechte Durchleuchtung erfahren konnten.
Wir beschränken uns in der folgenden Betrachtung auf die nachgoethische Ent-
wicklung der Lyrik und auf den Versuch, unter zunächst möglichster Ausschaltung
literarhistorischer, geist- und kulturkritischer Gedankengänge an Hand des formalen
/'entralphänomens dieser Entwicklung: des Einbruchs der Musik unter der Form
der Gefühlsassoziation in die Wortkunst der Lyrik, die so bedeutsame Umdeutung
und Verdunklung all jener Darstellungsmöglichkeiten — und Pflichten! — der Lyrik
anzudeuten, die aus höherem, dem Gesetz des Mittels übergeordneten Geiste stam-
men; sowie aus solcher Lage die wahren, dem Teil wie dem Ganzen immanenten
Proportionen dieser Kunstgattung wieder abzuleiten und mit ihrer bislang gesetzes-
gemäßesten und daher vorbildlichen Gestaltung in der griechischen Antike in frucht-
bare Verbindung zu setzen.
Bis zur Goethischen Epoche war die Lyrik unter ständig sich vertiefender Stabili-
sierung gegen religio sowohl als gegen ratio einer Darstellungsweise treugeblieben,
die bei bewußter Benutzung irrealer Momente und selbst bei Behandlung imaginärer
Stoffe — um nur an Klopstocks Messias zu erinnern — doch eine vernunftgemäße
Struktur und Abfolge der erregten Vorstellungen und eine bei gewahrter Durch-
schaubarkeit auch der kühnsten Hyperbolik niemals eigentlich magisch-unmittelbar
wirkende, rhetorisch stets rechtfertigbare Diktion zum Prinzip hatte. Der Wieder-
aufruf ungsvorgang der Vorstellungen zeigte somit eine ähnliche Struktur wie die
lineare Polyphonie der vorharmonischen Musik, d. h. der Begriffseffekt ergab sich
aus rationaler, allenfalls metaphorischer, gegenseitiger Bestimmung der ihn nach-
einander zusammensetzenden Glieder. Dinge des Empfindungsreiches fanden in der
Regel ihren Ausdruck durch Empfindungsworte, solche des Geist-Reiches durch
Geist-Worte; eine an und für sich oft sehr wohl beabsichtigte Wirkung in hetero-
genem Reich — z. B. die moralische — stand jedoch nicht in der Macht des Wort-
ausdrucks, sondern mußte der Reaktion des ethischen Soll in der Brust des Nach-
erlebenden überlassen bleiben.
Welches nun ist im Gegensatz hierzu die Tat, die der ganzen folgenden Periode
der Lyrik bis in unsere Tage den Namen: „Das Jahrhundert Goethes" gab? Ab-
gesehen von der Revolution der Themen und der vollen Eroberung des Ichs ist dies
in erster Linie die eine ungeheure Tragweite in sich bergende Entdeckung der Asso-
ziationsmagie in der dichterischen Sprache.