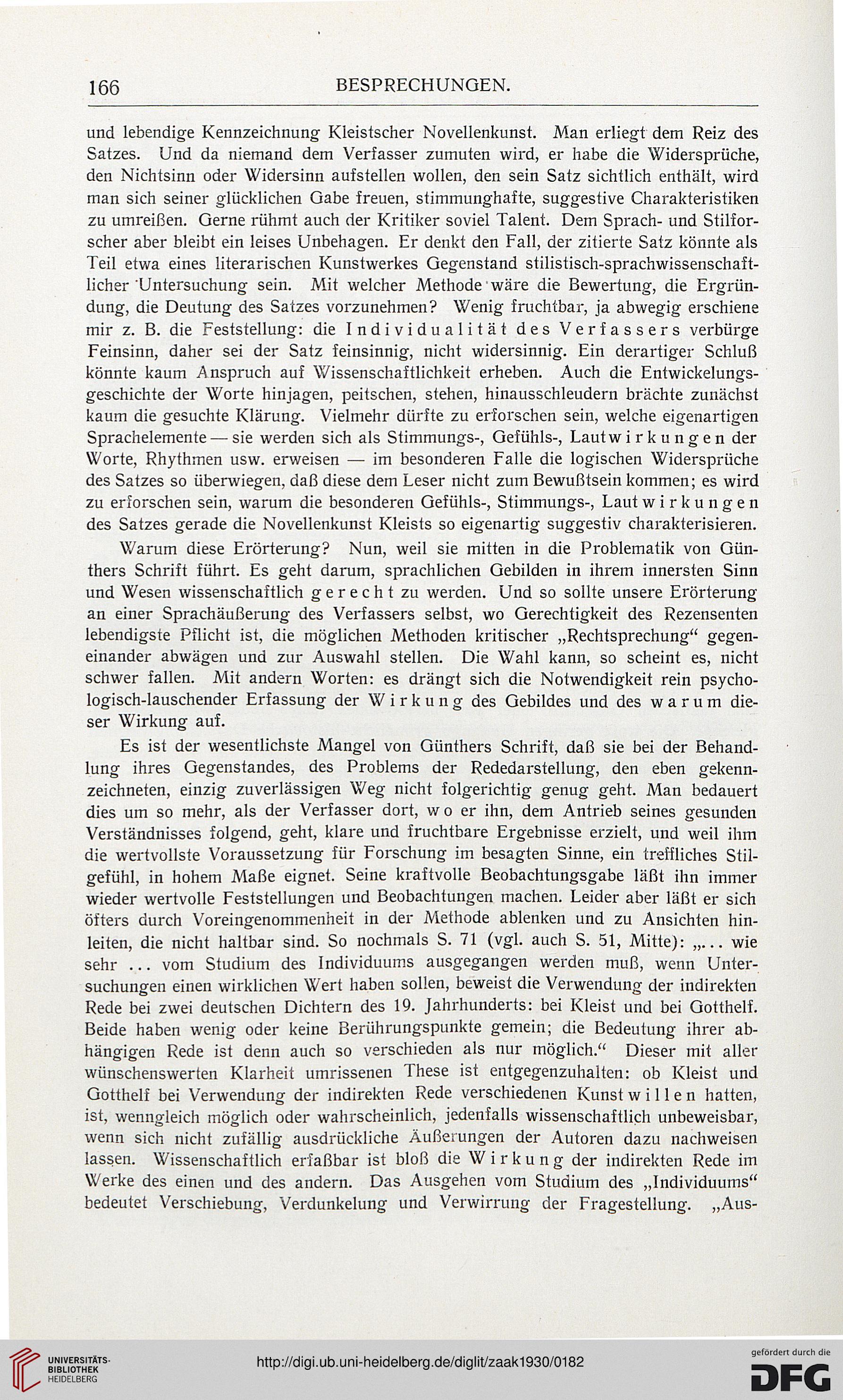166
BESPRECHUNGEN.
und lebendige Kennzeichnung Kleistscher Novellenkunst. Man erliegt dem Reiz des
Satzes. Und da niemand dem Verfasser zumuten wird, er habe die Widersprüche,
den Nichtsinn oder Widersinn aufstellen wollen, den sein Satz sichtlich enthält, wird
man sich seiner glücklichen Gabe freuen, stimmunghafte, suggestive Charakteristiken
zu umreißen. Gerne rühmt auch der Kritiker soviel Talent. Dem Sprach- und Stilfor-
scher aber bleibt ein leises Unbehagen. Er denkt den Fall, der zitierte Satz könnte als
Teil etwa eines literarischen Kunstwerkes Gegenstand stilistisch-sprachwissenschaft-
licher'Untersuchung sein. Mit welcher Methode wäre die Bewertung, die Ergrün-
dung, die Deutung des Satzes vorzunehmen? Wenig fruchtbar, ja abwegig erschiene
mir z. B. die Feststellung: die Individualität des Verfassers verbürge
Feinsinn, daher sei der Satz feinsinnig, nicht widersinnig. Ein derartiger Schluß
könnte kaum Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben. Auch die Entwickelungs-
geschichte der Worte hinjagen, peitschen, stehen, hinausschleudern brächte zunächst
kaum die gesuchte Klärung. Vielmehr dürfte zu erforschen sein, welche eigenartigen
Sprachelemente — sie werden sich als Stimmungs-, Gefühls-, Lautw i r k u n g e n der
Worte, Rhythmen usw. erweisen — im besonderen Falle die logischen Widersprüche
des Satzes so überwiegen, daß diese dem Leser nicht zum Bewußtsein kommen; es wird
zu erforschen sein, warum die besonderen Gefühls-, Stimmungs-, Laut Wirkungen
des Satzes gerade die Novellenkunst Kleists so eigenartig suggestiv charakterisieren.
Warum diese Erörterung? Nun, weil sie mitten in die Problematik von Gün-
thers Schrift führt. Es geht darum, sprachlichen Gebilden in ihrem innersten Sinn
und Wesen wissenschaftlich gerecht zu werden. Und so sollte unsere Erörterung
an einer Sprachäußerung des Verfassers selbst, wo Gerechtigkeit des Rezensenten
lebendigste Pflicht ist, die möglichen Methoden kritischer „Rechtsprechung" gegen-
einander abwägen und zur Auswahl stellen. Die Wahl kann, so scheint es, nicht
schwer fallen. Mit andern Worten: es drängt sich die Notwendigkeit rein psycho-
logisch-lauschender Erfassung der Wirkung des Gebildes und des warum die-
ser Wirkung auf.
Es ist der wesentlichste Mangel von Günthers Schrift, daß sie bei der Behand-
lung ihres Gegenstandes, des Problems der Rededarstellung, den eben gekenn-
zeichneten, einzig zuverlässigen Weg nicht folgerichtig genug geht. Man bedauert
dies um so mehr, als der Verfasser dort, wo er ihn, dem Antrieb seines gesunden
Verständnisses folgend, geht, klare und fruchtbare Ergebnisse erzielt, und weil ihm
die wertvollste Voraussetzung für Forschung im besagten Sinne, ein treffliches Stil-
gefühl, in hohem Maße eignet. Seine kraftvolle Beobachtungsgabe läßt ihn immer
wieder wertvolle Feststellungen und Beobachtungen machen. Leider aber läßt er sich
öfters durch Voreingenommenheit in der Methode ablenken und zu Ansichten hin-
leiten, die nicht haltbar sind. So nochmals S. 71 (vgl. auch S. 51, Mitte): „... wie
sehr ... vom Studium des Individuums ausgegangen werden muß, wenn Unter-
suchungen einen wirklichen Wert haben sollen, beweist die Verwendung der indirekten
Rede bei zwei deutschen Dichtern des 19. Jahrhunderts: bei Kleist und bei Gotthelf.
Beide haben wenig oder keine Berührungspunkte gemein; die Bedeutung ihrer ab-
hängigen Rede ist denn auch so verschieden als nur möglich." Dieser mit aller
wünschenswerten Klarheit umrissenen These ist entgegenzuhalten: ob Kleist und
Gotthelf bei Verwendung der indirekten Rede verschiedenen Kunst willen hatten,
ist, wenngleich möglich oder wahrscheinlich, jedenfalls wissenschaftlich unbeweisbar,
wenn sich nicht zufällig ausdrückliche Äußerungen der Autoren dazu nachweisen
lassen. Wissenschaftlich erfaßbar ist bloß die Wirkung der indirekten Rede im
Werke des einen und des andern. Das Ausgehen vom Studium des „Individuums"
bedeutet Verschiebung, Verdunkelung und Verwirrung der Fragestellung. „Aus-
BESPRECHUNGEN.
und lebendige Kennzeichnung Kleistscher Novellenkunst. Man erliegt dem Reiz des
Satzes. Und da niemand dem Verfasser zumuten wird, er habe die Widersprüche,
den Nichtsinn oder Widersinn aufstellen wollen, den sein Satz sichtlich enthält, wird
man sich seiner glücklichen Gabe freuen, stimmunghafte, suggestive Charakteristiken
zu umreißen. Gerne rühmt auch der Kritiker soviel Talent. Dem Sprach- und Stilfor-
scher aber bleibt ein leises Unbehagen. Er denkt den Fall, der zitierte Satz könnte als
Teil etwa eines literarischen Kunstwerkes Gegenstand stilistisch-sprachwissenschaft-
licher'Untersuchung sein. Mit welcher Methode wäre die Bewertung, die Ergrün-
dung, die Deutung des Satzes vorzunehmen? Wenig fruchtbar, ja abwegig erschiene
mir z. B. die Feststellung: die Individualität des Verfassers verbürge
Feinsinn, daher sei der Satz feinsinnig, nicht widersinnig. Ein derartiger Schluß
könnte kaum Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben. Auch die Entwickelungs-
geschichte der Worte hinjagen, peitschen, stehen, hinausschleudern brächte zunächst
kaum die gesuchte Klärung. Vielmehr dürfte zu erforschen sein, welche eigenartigen
Sprachelemente — sie werden sich als Stimmungs-, Gefühls-, Lautw i r k u n g e n der
Worte, Rhythmen usw. erweisen — im besonderen Falle die logischen Widersprüche
des Satzes so überwiegen, daß diese dem Leser nicht zum Bewußtsein kommen; es wird
zu erforschen sein, warum die besonderen Gefühls-, Stimmungs-, Laut Wirkungen
des Satzes gerade die Novellenkunst Kleists so eigenartig suggestiv charakterisieren.
Warum diese Erörterung? Nun, weil sie mitten in die Problematik von Gün-
thers Schrift führt. Es geht darum, sprachlichen Gebilden in ihrem innersten Sinn
und Wesen wissenschaftlich gerecht zu werden. Und so sollte unsere Erörterung
an einer Sprachäußerung des Verfassers selbst, wo Gerechtigkeit des Rezensenten
lebendigste Pflicht ist, die möglichen Methoden kritischer „Rechtsprechung" gegen-
einander abwägen und zur Auswahl stellen. Die Wahl kann, so scheint es, nicht
schwer fallen. Mit andern Worten: es drängt sich die Notwendigkeit rein psycho-
logisch-lauschender Erfassung der Wirkung des Gebildes und des warum die-
ser Wirkung auf.
Es ist der wesentlichste Mangel von Günthers Schrift, daß sie bei der Behand-
lung ihres Gegenstandes, des Problems der Rededarstellung, den eben gekenn-
zeichneten, einzig zuverlässigen Weg nicht folgerichtig genug geht. Man bedauert
dies um so mehr, als der Verfasser dort, wo er ihn, dem Antrieb seines gesunden
Verständnisses folgend, geht, klare und fruchtbare Ergebnisse erzielt, und weil ihm
die wertvollste Voraussetzung für Forschung im besagten Sinne, ein treffliches Stil-
gefühl, in hohem Maße eignet. Seine kraftvolle Beobachtungsgabe läßt ihn immer
wieder wertvolle Feststellungen und Beobachtungen machen. Leider aber läßt er sich
öfters durch Voreingenommenheit in der Methode ablenken und zu Ansichten hin-
leiten, die nicht haltbar sind. So nochmals S. 71 (vgl. auch S. 51, Mitte): „... wie
sehr ... vom Studium des Individuums ausgegangen werden muß, wenn Unter-
suchungen einen wirklichen Wert haben sollen, beweist die Verwendung der indirekten
Rede bei zwei deutschen Dichtern des 19. Jahrhunderts: bei Kleist und bei Gotthelf.
Beide haben wenig oder keine Berührungspunkte gemein; die Bedeutung ihrer ab-
hängigen Rede ist denn auch so verschieden als nur möglich." Dieser mit aller
wünschenswerten Klarheit umrissenen These ist entgegenzuhalten: ob Kleist und
Gotthelf bei Verwendung der indirekten Rede verschiedenen Kunst willen hatten,
ist, wenngleich möglich oder wahrscheinlich, jedenfalls wissenschaftlich unbeweisbar,
wenn sich nicht zufällig ausdrückliche Äußerungen der Autoren dazu nachweisen
lassen. Wissenschaftlich erfaßbar ist bloß die Wirkung der indirekten Rede im
Werke des einen und des andern. Das Ausgehen vom Studium des „Individuums"
bedeutet Verschiebung, Verdunkelung und Verwirrung der Fragestellung. „Aus-