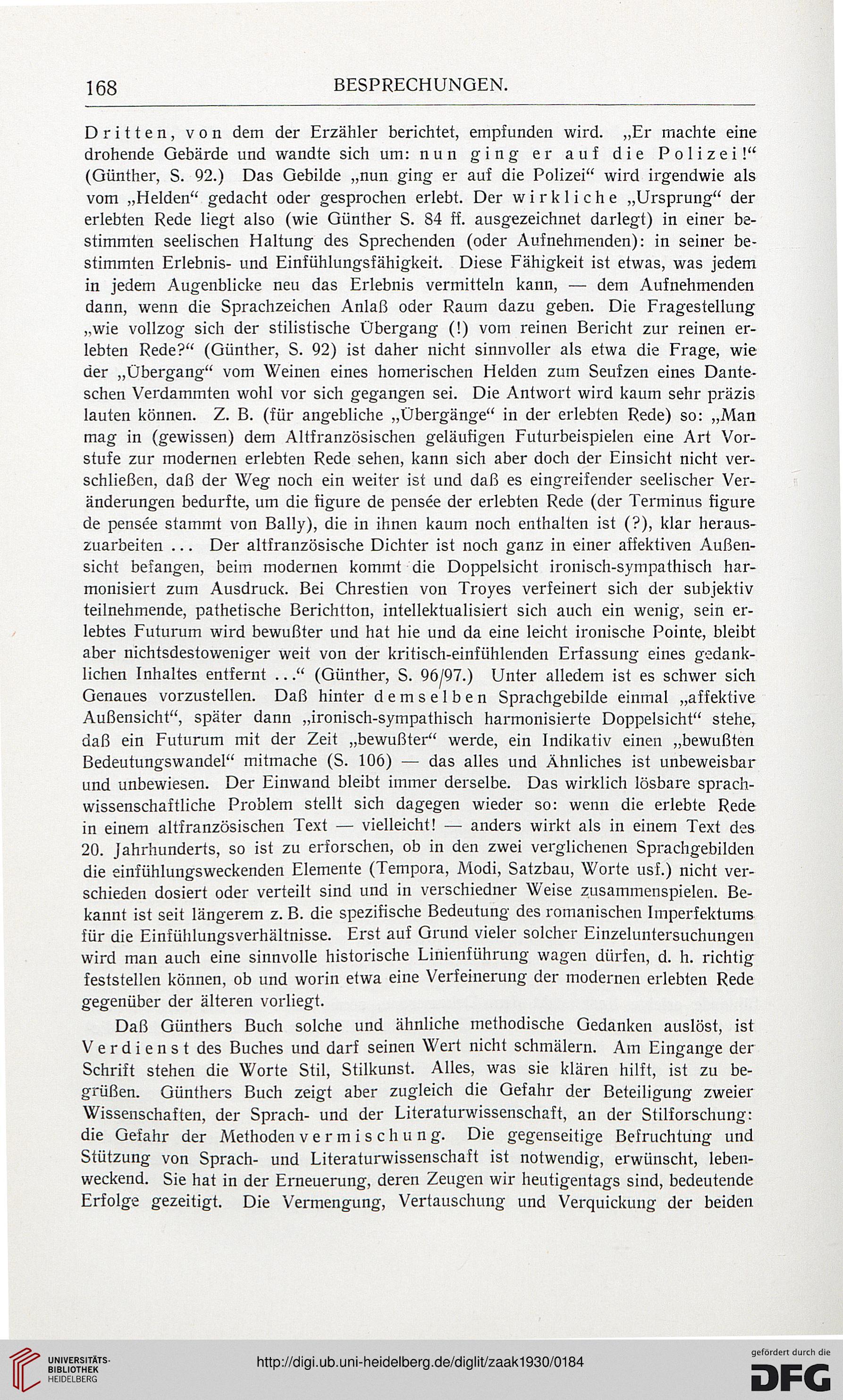168
BESPRECHUNGEN.
Dritten, von dem der Erzähler berichtet, empfunden wird. „Er machte eine
drohende Gebärde und wandte sich um: nun ging er auf die Polizei!"
(Günther, S. 92.) Das Gebilde „nun ging er auf die Polizei" wird irgendwie als
vom „Helden" gedacht oder gesprochen erlebt. Der wirkliche „Ursprung" der
erlebten Rede liegt also (wie Günther S. 84 ff. ausgezeichnet darlegt) in einer be-
stimmten seelischen Haltung des Sprechenden (oder Aufnehmenden): in seiner be-
stimmten Erlebnis- und Einfühlungsfähigkeit. Diese Fähigkeit ist etwas, was jedem
in jedem Augenblicke neu das Erlebnis vermitteln kann, — dem Aufnehmenden
dann, wenn die Sprachzeichen Anlaß oder Raum dazu geben. Die Fragestellung
„wie vollzog sich der stilistische Übergang (!) vom reinen Bericht zur reinen er-
lebten Rede?" (Günther, S. 92) ist daher nicht sinnvoller als etwa die Frage, wie
der „Obergang" vom Weinen eines homerischen Helden zum Seufzen eines Dante-
sehen Verdammten wohl vor sich gegangen sei. Die Antwort wird kaum sehr präzis
lauten können. Z. B. (für angebliche „Übergänge" in der erlebten Rede) so: „Man
mag in (gewissen) dem Altfranzösischen geläufigen Futurbeispielen eine Art Vor-
stufe zur modernen erlebten Rede sehen, kann sich aber doch der Einsicht nicht ver-
schließen, daß der Weg noch ein weiter ist und daß es eingreifender seelischer Ver-
änderungen bedurfte, um die figure de pensee der erlebten Rede (der Terminus figure
de pensee stammt von Bally), die in ihnen kaum noch enthalten ist (?), klar heraus-
zuarbeiten ... Der altfranzösische Dichter ist noch ganz in einer affektiven Außen-
sicht befangen, beim modernen kommt die Doppelsicht ironisch-sympathisch har-
monisiert zum Ausdruck. Bei Chrestien von Troyes verfeinert sich der subjektiv
teilnehmende, pathetische Berichtton, intellektualisiert sich auch ein wenig, sein er-
lebtes Futurum wird bewußter und hat hie und da eine leicht ironische Pointe, bleibt
aber nichtsdestoweniger weit von der kritisch-einfühlenden Erfassung eines gedank-
lichen Inhaltes entfernt ..." (Günther, S. 96/97.) Unter alledem ist es schwer sich
Genaues vorzustellen. Daß hinter demselben Sprachgebilde einmal „affektive
Außensicht", später dann „ironisch-sympathisch harmonisierte Doppelsicht" stehe,
daß ein Futurum mit der Zeit „bewußter" werde, ein Indikativ einen „bewußten
Bedeutungswandel" mitmache (S. 106) — das alles und Ähnliches ist unbeweisbar
und unbewiesen. Der Einwand bleibt immer derselbe. Das wirklich lösbare sprach-
wissenschaftliche Problem stellt sich dagegen wieder so: wenn die erlebte Rede
in einem altfranzösischen Text — vielleicht! — anders wirkt als in einem Text des
20. Jahrhunderts, so ist zu erforschen, ob in den zwei verglichenen Sprachgebilden
die einfühlungsweckenden Elemente (Tempora, Modi, Satzbau, Worte usf.) nicht ver-
schieden dosiert oder verteilt sind und in verschiedner Weise zusammenspielen. Be-
kannt ist seit längerem z. B. die spezifische Bedeutung des romanischen Imperfektums
für die Einfühlungsverhältnisse. Erst auf Grund vieler solcher Einzeluntersuchungen
wird man auch eine sinnvolle historische Linienführung wagen dürfen, d. h. richtig
feststellen können, ob und worin etwa eine Verfeinerung der modernen erlebten Rede
gegenüber der älteren vorliegt.
Daß Günthers Buch solche und ähnliche methodische Gedanken auslöst, ist
Verdienst des Buches und darf seinen Wert nicht schmälern. Am Eingange der
Schrift stehen die Worte Stil, Stilkunst. Alles, was sie klären hilft, ist zu be-
grüßen. Günthers Buch zeigt aber zugleich die Gefahr der Beteiligung zweier
Wissenschaften, der Sprach- und der Literaturwissenschaft, an der Stilforschung:
die Gefahr der Methoden vermiscliun g. Die gegenseitige Befruchtung und
Stützung von Sprach- und Literaturwissenschaft ist notwendig, erwünscht, leben-
weckend. Sie hat in der Erneuerung, deren Zeugen wir heutigentags sind, bedeutende
Erfolge gezeitigt. Die Vermengung, Vertauschung und Verquickung der beiden
BESPRECHUNGEN.
Dritten, von dem der Erzähler berichtet, empfunden wird. „Er machte eine
drohende Gebärde und wandte sich um: nun ging er auf die Polizei!"
(Günther, S. 92.) Das Gebilde „nun ging er auf die Polizei" wird irgendwie als
vom „Helden" gedacht oder gesprochen erlebt. Der wirkliche „Ursprung" der
erlebten Rede liegt also (wie Günther S. 84 ff. ausgezeichnet darlegt) in einer be-
stimmten seelischen Haltung des Sprechenden (oder Aufnehmenden): in seiner be-
stimmten Erlebnis- und Einfühlungsfähigkeit. Diese Fähigkeit ist etwas, was jedem
in jedem Augenblicke neu das Erlebnis vermitteln kann, — dem Aufnehmenden
dann, wenn die Sprachzeichen Anlaß oder Raum dazu geben. Die Fragestellung
„wie vollzog sich der stilistische Übergang (!) vom reinen Bericht zur reinen er-
lebten Rede?" (Günther, S. 92) ist daher nicht sinnvoller als etwa die Frage, wie
der „Obergang" vom Weinen eines homerischen Helden zum Seufzen eines Dante-
sehen Verdammten wohl vor sich gegangen sei. Die Antwort wird kaum sehr präzis
lauten können. Z. B. (für angebliche „Übergänge" in der erlebten Rede) so: „Man
mag in (gewissen) dem Altfranzösischen geläufigen Futurbeispielen eine Art Vor-
stufe zur modernen erlebten Rede sehen, kann sich aber doch der Einsicht nicht ver-
schließen, daß der Weg noch ein weiter ist und daß es eingreifender seelischer Ver-
änderungen bedurfte, um die figure de pensee der erlebten Rede (der Terminus figure
de pensee stammt von Bally), die in ihnen kaum noch enthalten ist (?), klar heraus-
zuarbeiten ... Der altfranzösische Dichter ist noch ganz in einer affektiven Außen-
sicht befangen, beim modernen kommt die Doppelsicht ironisch-sympathisch har-
monisiert zum Ausdruck. Bei Chrestien von Troyes verfeinert sich der subjektiv
teilnehmende, pathetische Berichtton, intellektualisiert sich auch ein wenig, sein er-
lebtes Futurum wird bewußter und hat hie und da eine leicht ironische Pointe, bleibt
aber nichtsdestoweniger weit von der kritisch-einfühlenden Erfassung eines gedank-
lichen Inhaltes entfernt ..." (Günther, S. 96/97.) Unter alledem ist es schwer sich
Genaues vorzustellen. Daß hinter demselben Sprachgebilde einmal „affektive
Außensicht", später dann „ironisch-sympathisch harmonisierte Doppelsicht" stehe,
daß ein Futurum mit der Zeit „bewußter" werde, ein Indikativ einen „bewußten
Bedeutungswandel" mitmache (S. 106) — das alles und Ähnliches ist unbeweisbar
und unbewiesen. Der Einwand bleibt immer derselbe. Das wirklich lösbare sprach-
wissenschaftliche Problem stellt sich dagegen wieder so: wenn die erlebte Rede
in einem altfranzösischen Text — vielleicht! — anders wirkt als in einem Text des
20. Jahrhunderts, so ist zu erforschen, ob in den zwei verglichenen Sprachgebilden
die einfühlungsweckenden Elemente (Tempora, Modi, Satzbau, Worte usf.) nicht ver-
schieden dosiert oder verteilt sind und in verschiedner Weise zusammenspielen. Be-
kannt ist seit längerem z. B. die spezifische Bedeutung des romanischen Imperfektums
für die Einfühlungsverhältnisse. Erst auf Grund vieler solcher Einzeluntersuchungen
wird man auch eine sinnvolle historische Linienführung wagen dürfen, d. h. richtig
feststellen können, ob und worin etwa eine Verfeinerung der modernen erlebten Rede
gegenüber der älteren vorliegt.
Daß Günthers Buch solche und ähnliche methodische Gedanken auslöst, ist
Verdienst des Buches und darf seinen Wert nicht schmälern. Am Eingange der
Schrift stehen die Worte Stil, Stilkunst. Alles, was sie klären hilft, ist zu be-
grüßen. Günthers Buch zeigt aber zugleich die Gefahr der Beteiligung zweier
Wissenschaften, der Sprach- und der Literaturwissenschaft, an der Stilforschung:
die Gefahr der Methoden vermiscliun g. Die gegenseitige Befruchtung und
Stützung von Sprach- und Literaturwissenschaft ist notwendig, erwünscht, leben-
weckend. Sie hat in der Erneuerung, deren Zeugen wir heutigentags sind, bedeutende
Erfolge gezeitigt. Die Vermengung, Vertauschung und Verquickung der beiden