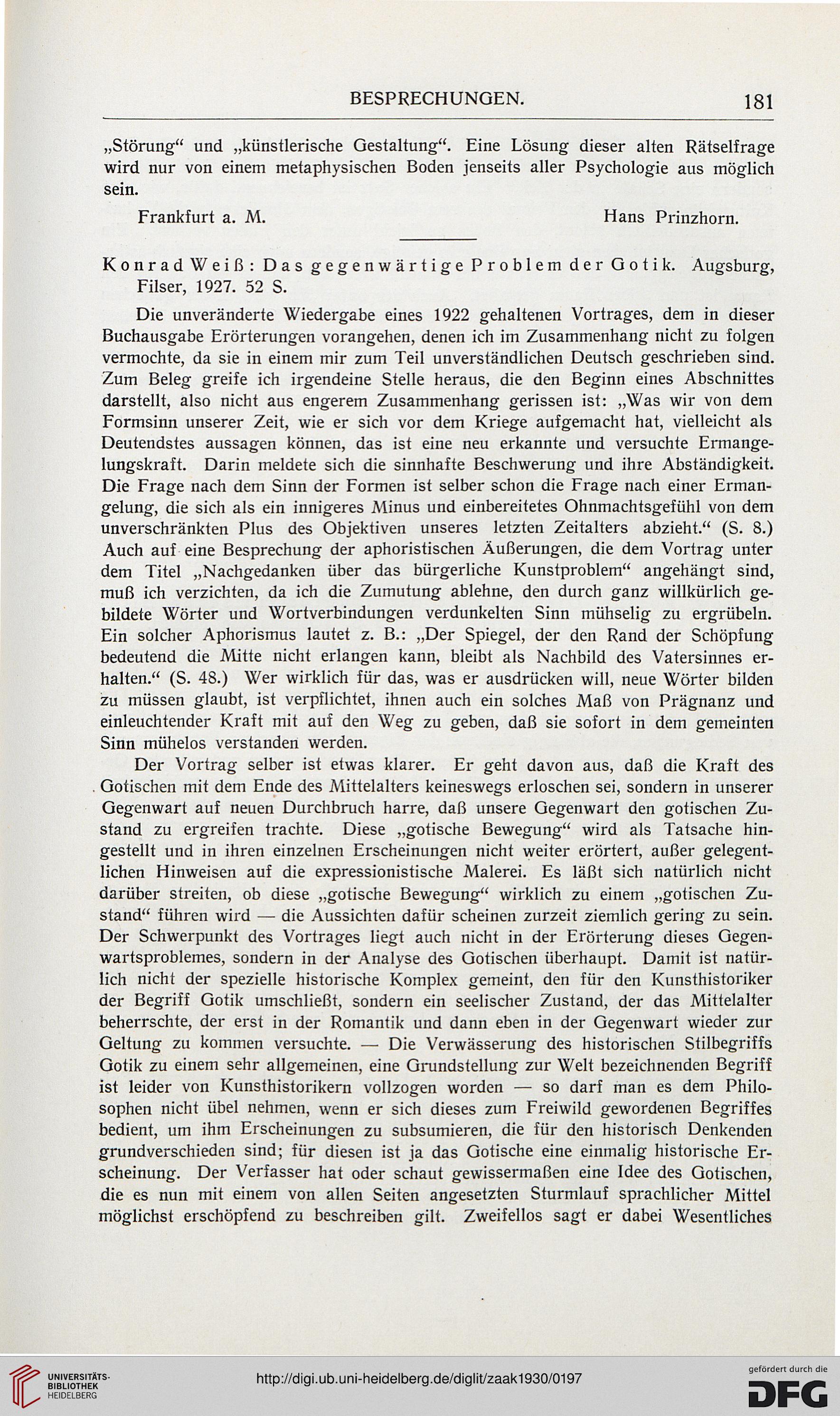BESPRECHUNGEN.
181
„Störung" und „künstlerische Gestaltung". Eine Lösung dieser alten Rätselfrage
wird nur von einem metaphysischen Boden jenseits aller Psychologie aus möglich
sein.
Frankfurt a. M. Hans Prinzhorn.
Konrad Weiß: Das gegenwärtige Problem der Gotik. Augsburg,
Filser, 1927. 52 S.
Die unveränderte Wiedergabe eines 1922 gehaltenen Vortrages, dem in dieser
Buchausgabe Erörterungen vorangehen, denen ich im Zusammenhang nicht zu folgen
vermochte, da sie in einem mir zum Teil unverständlichen Deutsch geschrieben sind.
Zum Beleg greife ich irgendeine Stelle heraus, die den Beginn eines Abschnittes
darstellt, also nicht aus engerem Zusammenhang gerissen ist: „Was wir von dem
Formsinn unserer Zeit, wie er sich vor dem Kriege aufgemacht hat, vielleicht als
Deutendstes aussagen können, das ist eine neu erkannte und versuchte Ermange-
lungskraft. Darin meldete sich die sinnhafte Beschwerung und ihre Abständigkeit.
Die Frage nach dem Sinn der Formen ist selber schon die Frage nach einer Erman-
gelung, die sich als ein innigeres Minus und einbereitetes Ohnmachtsgefühl von dem
unverschränkten Plus des Objektiven unseres letzten Zeitalters abzieht." (S. 8.)
Auch auf eine Besprechung der aphoristischen Äußerungen, die dem Vortrag unter
dem Titel „Nachgedanken über das bürgerliche Kunstproblem" angehängt sind,
muß ich verzichten, da ich die Zumutung ablehne, den durch ganz willkürlich ge-
bildete Wörter und Wortverbindungen verdunkelten Sinn mühselig zu ergrübein.
Ein solcher Aphorismus lautet z. B.: „Der Spiegel, der den Rand der Schöpfung
bedeutend die Mitte nicht erlangen kann, bleibt als Nachbild des Vatersinnes er-
halten." (S. 48.) Wer wirklich für das, was er ausdrücken will, neue Wörter bilden
zu müssen glaubt, ist verpflichtet, ihnen auch ein solches Maß von Prägnanz und
einleuchtender Kraft mit auf den Weg zu geben, daß sie sofort in dem gemeinten
Sinn mühelos verstanden werden.
Der Vortrag selber ist etwas klarer. Er geht davon aus, daß die Kraft des
Gotischen mit dem Ende des Mittelalters keineswegs erloschen sei, sondern in unserer
Gegenwart auf neuen Durchbruch harre, daß unsere Gegenwart den gotischen Zu-
stand zu ergreifen trachte. Diese „gotische Bewegung" wird als Tatsache hin-
gestellt und in ihren einzelnen Erscheinungen nicht weiter erörtert, außer gelegent-
lichen Hinweisen auf die expressionistische Malerei. Es läßt sich natürlich nicht
darüber streiten, ob diese „gotische Bewegung" wirklich zu einem „gotischen Zu-
stand" führen wird — die Aussichten dafür scheinen zurzeit ziemlich gering zu sein.
Der Schwerpunkt des Vortrages liegt auch nicht in der Erörterung dieses Gegen-
wartsproblemes, sondern in der Analyse des Gotischen überhaupt. Damit ist natür-
lich nicht der spezielle historische Komplex gemeint, den für den Kunsthistoriker
der Begriff Gotik umschließt, sondern ein seelischer Zustand, der das Mittelalter
beherrschte, der erst in der Romantik und dann eben in der Gegenwart wieder zur
Geltung zu kommen versuchte. — Die Verwässerung des historischen Stilbegriffs
Gotik zu einem sehr allgemeinen, eine Grundstellung zur Welt bezeichnenden Begriff
ist leider von Kunsthistorikern vollzogen worden — so darf man es dem Philo-
sophen nicht übel nehmen, wenn er sich dieses zum Freiwild gewordenen Begriffes
bedient, um ihm Erscheinungen zu subsumieren, die für den historisch Denkenden
grundverschieden sind; für diesen ist ja das Gotische eine einmalig historische Er-
scheinung. Der Verfasser hat oder schaut gewissermaßen eine Idee des Gotischen,
die es nun mit einem von allen Seiten angesetzten Sturmlauf sprachlicher Mittel
möglichst erschöpfend zu beschreiben gilt. Zweifellos sagt er dabei Wesentliches
181
„Störung" und „künstlerische Gestaltung". Eine Lösung dieser alten Rätselfrage
wird nur von einem metaphysischen Boden jenseits aller Psychologie aus möglich
sein.
Frankfurt a. M. Hans Prinzhorn.
Konrad Weiß: Das gegenwärtige Problem der Gotik. Augsburg,
Filser, 1927. 52 S.
Die unveränderte Wiedergabe eines 1922 gehaltenen Vortrages, dem in dieser
Buchausgabe Erörterungen vorangehen, denen ich im Zusammenhang nicht zu folgen
vermochte, da sie in einem mir zum Teil unverständlichen Deutsch geschrieben sind.
Zum Beleg greife ich irgendeine Stelle heraus, die den Beginn eines Abschnittes
darstellt, also nicht aus engerem Zusammenhang gerissen ist: „Was wir von dem
Formsinn unserer Zeit, wie er sich vor dem Kriege aufgemacht hat, vielleicht als
Deutendstes aussagen können, das ist eine neu erkannte und versuchte Ermange-
lungskraft. Darin meldete sich die sinnhafte Beschwerung und ihre Abständigkeit.
Die Frage nach dem Sinn der Formen ist selber schon die Frage nach einer Erman-
gelung, die sich als ein innigeres Minus und einbereitetes Ohnmachtsgefühl von dem
unverschränkten Plus des Objektiven unseres letzten Zeitalters abzieht." (S. 8.)
Auch auf eine Besprechung der aphoristischen Äußerungen, die dem Vortrag unter
dem Titel „Nachgedanken über das bürgerliche Kunstproblem" angehängt sind,
muß ich verzichten, da ich die Zumutung ablehne, den durch ganz willkürlich ge-
bildete Wörter und Wortverbindungen verdunkelten Sinn mühselig zu ergrübein.
Ein solcher Aphorismus lautet z. B.: „Der Spiegel, der den Rand der Schöpfung
bedeutend die Mitte nicht erlangen kann, bleibt als Nachbild des Vatersinnes er-
halten." (S. 48.) Wer wirklich für das, was er ausdrücken will, neue Wörter bilden
zu müssen glaubt, ist verpflichtet, ihnen auch ein solches Maß von Prägnanz und
einleuchtender Kraft mit auf den Weg zu geben, daß sie sofort in dem gemeinten
Sinn mühelos verstanden werden.
Der Vortrag selber ist etwas klarer. Er geht davon aus, daß die Kraft des
Gotischen mit dem Ende des Mittelalters keineswegs erloschen sei, sondern in unserer
Gegenwart auf neuen Durchbruch harre, daß unsere Gegenwart den gotischen Zu-
stand zu ergreifen trachte. Diese „gotische Bewegung" wird als Tatsache hin-
gestellt und in ihren einzelnen Erscheinungen nicht weiter erörtert, außer gelegent-
lichen Hinweisen auf die expressionistische Malerei. Es läßt sich natürlich nicht
darüber streiten, ob diese „gotische Bewegung" wirklich zu einem „gotischen Zu-
stand" führen wird — die Aussichten dafür scheinen zurzeit ziemlich gering zu sein.
Der Schwerpunkt des Vortrages liegt auch nicht in der Erörterung dieses Gegen-
wartsproblemes, sondern in der Analyse des Gotischen überhaupt. Damit ist natür-
lich nicht der spezielle historische Komplex gemeint, den für den Kunsthistoriker
der Begriff Gotik umschließt, sondern ein seelischer Zustand, der das Mittelalter
beherrschte, der erst in der Romantik und dann eben in der Gegenwart wieder zur
Geltung zu kommen versuchte. — Die Verwässerung des historischen Stilbegriffs
Gotik zu einem sehr allgemeinen, eine Grundstellung zur Welt bezeichnenden Begriff
ist leider von Kunsthistorikern vollzogen worden — so darf man es dem Philo-
sophen nicht übel nehmen, wenn er sich dieses zum Freiwild gewordenen Begriffes
bedient, um ihm Erscheinungen zu subsumieren, die für den historisch Denkenden
grundverschieden sind; für diesen ist ja das Gotische eine einmalig historische Er-
scheinung. Der Verfasser hat oder schaut gewissermaßen eine Idee des Gotischen,
die es nun mit einem von allen Seiten angesetzten Sturmlauf sprachlicher Mittel
möglichst erschöpfend zu beschreiben gilt. Zweifellos sagt er dabei Wesentliches