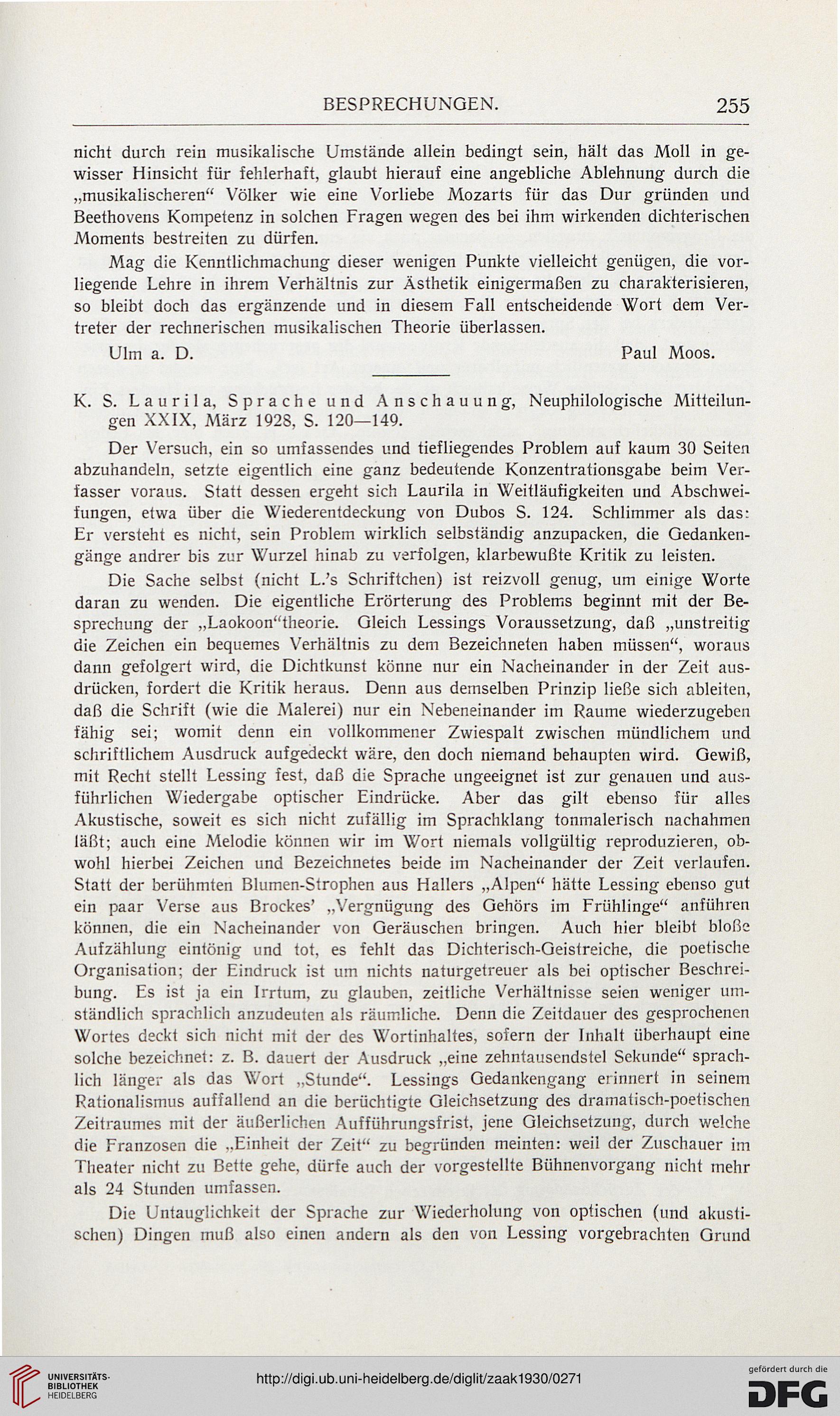BESPRECHUNGEN.
255
nicht durch rein musikalische Umstände allein bedingt sein, hält das Moll in ge-
wisser Hinsicht für fehlerhaft, glaubt hierauf eine angebliche Ablehnung durch die
„musikalischeren" Völker wie eine Vorliebe Mozarts für das Dur gründen und
Beethovens Kompetenz in solchen Fragen wegen des bei ihm wirkenden dichterischen
Moments bestreiten zu dürfen.
Mag die Kenntlichmachung dieser wenigen Punkte vielleicht genügen, die vor-
liegende Lehre in ihrem Verhältnis zur Ästhetik einigermaßen zu charakterisieren,
so bleibt doch das ergänzende und in diesem Fall entscheidende Wort dem Ver-
treter der rechnerischen musikalischen Theorie überlassen.
Ulm a. D. Paul Moos.
K. S. Laurila, Sprache und Anschauung, Neuphilologische Mitteilun-
gen XXIX, März 1928, S. 120—149.
Der Versuch, ein so umfassendes und tiefliegendes Problem auf kaum 30 Seiten
abzuhandeln, setzte eigentlich eine ganz bedeutende Konzentrationsgabe beim Ver-
fasser voraus. Statt dessen ergeht sich Laurila in Weitläufigkeiten und Abschwei-
fungen, etwa über die Wiederentdeckung von Dubos S. 124. Schlimmer als das:
Er versteht es nicht, sein Problem wirklich selbständig anzupacken, die Gedanken-
gänge andrer bis zur Wurzel hinab zu verfolgen, klarbewußte Kritik zu leisten.
Die Sache selbst (nicht L.'s Schriftchen) ist reizvoll genug, um einige Worte
daran zu wenden. Die eigentliche Erörterung des Problems beginnt mit der Be-
sprechung der „Laokoon"theorie. Gleich Lessings Voraussetzung, daß „unstreitig
die Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen", woraus
dann gefolgert wird, die Dichtkunst könne nur ein Nacheinander in der Zeit aus-
drücken, fordert die Kritik heraus. Denn aus demselben Prinzip ließe sich ableiten,
daß die Schrift (wie die Malerei) nur ein Nebeneinander im Räume wiederzugeben
fähig sei; womit denn ein vollkommener Zwiespalt zwischen mündlichem und
schriftlichem Ausdruck aufgedeckt wäre, den doch niemand behaupten wird. Gewiß,
mit Recht stellt Lessing fest, daß die Sprache ungeeignet ist zur genauen und aus-
führlichen Wiedergabe optischer Eindrücke. Aber das gilt ebenso für alles
Akustische, soweit es sich nicht zufällig im Sprachklang tonmalerisch nachahmen
läßt; auch eine Melodie können wir im Wort niemals vollgültig reproduzieren, ob-
wohl hierbei Zeichen und Bezeichnetes beide im Nacheinander der Zeit verlaufen.
Statt der berühmten Blumen-Strophen aus Hallers „Alpen" hätte Lessing ebenso gut
ein paar Verse aus Brockes' „Vergnügung des Gehörs im Frühlinge" anführen
können, die ein Nacheinander von Geräuschen bringen. Auch hier bleibt bloße
Aufzählung eintönig und tot, es fehlt das Dichterisch-Geistreiche, die poetische
Organisation; der Eindruck ist um nichts naturgetreuer als bei optischer Beschrei-
bung. Es ist ja ein Irrtum, zu glauben, zeitliche Verhältnisse seien weniger um-
ständlich sprachlich anzudeuten als räumliche. Denn die Zeitdauer des gesprochenen
Wortes deckt sich nicht mit der des Wortinhaltes, sofern der Inhalt überhaupt eine
solche bezeichnet: z. B. dauert der Ausdruck „eine zehntausendstel Sekunde" sprach-
lich länger als das Wort „Stunde". Lessings Gedankengang erinnert in seinem
Rationalismus auffallend an die berüchtigte Gleichsetzung des dramatisch-poetischen
Zeitraumes mit der äußerlichen Aufführungsfrist, jene Gleichsetzung, durch welche
die Franzosen die „Einheit der Zeit" zu begründen meinten: weil der Zuschauer im
Theater nicht zu Bette gehe, dürfe auch der vorgestellte Bühnenvorgang nicht mehr
als 24 Stunden umfassen.
Die Untauglichkeit der Sprache zur Wiederholung von optischen (und akusti-
schen) Dingen muß also einen andern als den von Lessing vorgebrachten Grund
255
nicht durch rein musikalische Umstände allein bedingt sein, hält das Moll in ge-
wisser Hinsicht für fehlerhaft, glaubt hierauf eine angebliche Ablehnung durch die
„musikalischeren" Völker wie eine Vorliebe Mozarts für das Dur gründen und
Beethovens Kompetenz in solchen Fragen wegen des bei ihm wirkenden dichterischen
Moments bestreiten zu dürfen.
Mag die Kenntlichmachung dieser wenigen Punkte vielleicht genügen, die vor-
liegende Lehre in ihrem Verhältnis zur Ästhetik einigermaßen zu charakterisieren,
so bleibt doch das ergänzende und in diesem Fall entscheidende Wort dem Ver-
treter der rechnerischen musikalischen Theorie überlassen.
Ulm a. D. Paul Moos.
K. S. Laurila, Sprache und Anschauung, Neuphilologische Mitteilun-
gen XXIX, März 1928, S. 120—149.
Der Versuch, ein so umfassendes und tiefliegendes Problem auf kaum 30 Seiten
abzuhandeln, setzte eigentlich eine ganz bedeutende Konzentrationsgabe beim Ver-
fasser voraus. Statt dessen ergeht sich Laurila in Weitläufigkeiten und Abschwei-
fungen, etwa über die Wiederentdeckung von Dubos S. 124. Schlimmer als das:
Er versteht es nicht, sein Problem wirklich selbständig anzupacken, die Gedanken-
gänge andrer bis zur Wurzel hinab zu verfolgen, klarbewußte Kritik zu leisten.
Die Sache selbst (nicht L.'s Schriftchen) ist reizvoll genug, um einige Worte
daran zu wenden. Die eigentliche Erörterung des Problems beginnt mit der Be-
sprechung der „Laokoon"theorie. Gleich Lessings Voraussetzung, daß „unstreitig
die Zeichen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen", woraus
dann gefolgert wird, die Dichtkunst könne nur ein Nacheinander in der Zeit aus-
drücken, fordert die Kritik heraus. Denn aus demselben Prinzip ließe sich ableiten,
daß die Schrift (wie die Malerei) nur ein Nebeneinander im Räume wiederzugeben
fähig sei; womit denn ein vollkommener Zwiespalt zwischen mündlichem und
schriftlichem Ausdruck aufgedeckt wäre, den doch niemand behaupten wird. Gewiß,
mit Recht stellt Lessing fest, daß die Sprache ungeeignet ist zur genauen und aus-
führlichen Wiedergabe optischer Eindrücke. Aber das gilt ebenso für alles
Akustische, soweit es sich nicht zufällig im Sprachklang tonmalerisch nachahmen
läßt; auch eine Melodie können wir im Wort niemals vollgültig reproduzieren, ob-
wohl hierbei Zeichen und Bezeichnetes beide im Nacheinander der Zeit verlaufen.
Statt der berühmten Blumen-Strophen aus Hallers „Alpen" hätte Lessing ebenso gut
ein paar Verse aus Brockes' „Vergnügung des Gehörs im Frühlinge" anführen
können, die ein Nacheinander von Geräuschen bringen. Auch hier bleibt bloße
Aufzählung eintönig und tot, es fehlt das Dichterisch-Geistreiche, die poetische
Organisation; der Eindruck ist um nichts naturgetreuer als bei optischer Beschrei-
bung. Es ist ja ein Irrtum, zu glauben, zeitliche Verhältnisse seien weniger um-
ständlich sprachlich anzudeuten als räumliche. Denn die Zeitdauer des gesprochenen
Wortes deckt sich nicht mit der des Wortinhaltes, sofern der Inhalt überhaupt eine
solche bezeichnet: z. B. dauert der Ausdruck „eine zehntausendstel Sekunde" sprach-
lich länger als das Wort „Stunde". Lessings Gedankengang erinnert in seinem
Rationalismus auffallend an die berüchtigte Gleichsetzung des dramatisch-poetischen
Zeitraumes mit der äußerlichen Aufführungsfrist, jene Gleichsetzung, durch welche
die Franzosen die „Einheit der Zeit" zu begründen meinten: weil der Zuschauer im
Theater nicht zu Bette gehe, dürfe auch der vorgestellte Bühnenvorgang nicht mehr
als 24 Stunden umfassen.
Die Untauglichkeit der Sprache zur Wiederholung von optischen (und akusti-
schen) Dingen muß also einen andern als den von Lessing vorgebrachten Grund