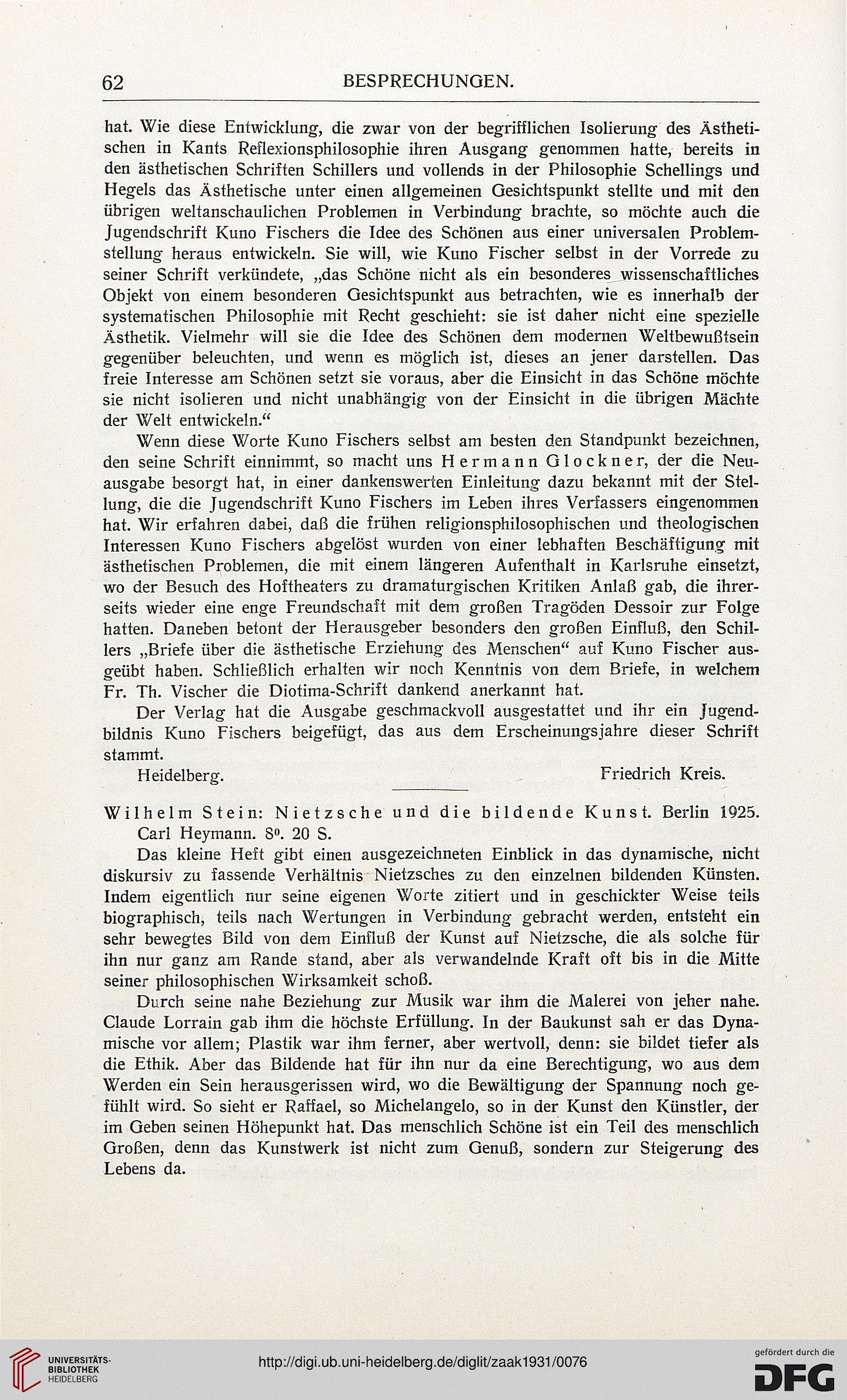62
BESPRECHUNGEN.
hat. Wie diese Entwicklung-, die zwar von der begrifflichen Isolierung des Ästheti-
schen in Kants Reflexionsphilosophie ihren Ausgang genommen hatte, bereits in
den ästhetischen Schriften Schillers und vollends in der Philosophie Schellings und
Hegels das Ästhetische unter einen allgemeinen Gesichtspunkt stellte und mit den
übrigen weltanschaulichen Problemen in Verbindung brachte, so möchte auch die
Jugendschrift Kuno Fischers die Idee des Schönen aus einer universalen Problem-
stellung heraus entwickeln. Sie will, wie Kuno Fischer selbst in der Vorrede zu
seiner Schrift verkündete, „das Schöne nicht als ein besonderes wissenschaftliches
Objekt von einem besonderen Gesichtspunkt aus betrachten, wie es innerhalb der
systematischen Philosophie mit Recht geschieht: sie ist daher nicht eine spezielle
Ästhetik. Vielmehr will sie die Idee des Schönen dem modernen Weltbewußtsein
gegenüber beleuchten, und wenn es möglich ist, dieses an jener darstellen. Das
freie Interesse am Schönen setzt sie voraus, aber die Einsicht in das Schöne möchte
sie nicht isolieren und nicht unabhängig von der Einsicht in die übrigen Mächte
der Welt entwickeln."
Wenn diese Worte Kuno Fischers selbst am besten den Standpunkt bezeichnen,
den seine Schrift einnimmt, so macht uns Hermann Glockner, der die Neu-
ausgabe besorgt hat, in einer dankenswerten Einleitung dazu bekannt mit der Stel-
lung, die die Jugendschrift Kuno Fischers im Leben ihres Verfassers eingenommen
hat. Wir erfahren dabei, daß die frühen religionsphilosophischen und theologischen
Interessen Kuno Fischers abgelöst wurden von einer lebhaften Beschäftigung mit
ästhetischen Problemen, die mit einem längeren Aufenthalt in Karlsruhe einsetzt,
wo der Besuch des Hoftheaters zu dramaturgischen Kritiken Anlaß gab, die ihrer-
seits wieder eine enge Freundschaft mit dem großen Tragöden Dessoir zur Folge
hatten. Daneben betont der Herausgeber besonders den großen Einfluß, den Schil-
lers „Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" auf Kuno Fischer aus-
geübt haben. Schließlich erhalten wir noch Kenntnis von dem Briefe, in welchem
Fr. Th. Vischer die Diotima-Schrift dankend anerkannt hat.
Der Verlag hat die Ausgabe geschmackvoll ausgestattet und ihr ein Jugend-
bildnis Kuno Fischers beigefügt, das aus dem Erscheinungsjahre dieser Schrift
stammt.
Heidelberg. Friedrich Kreis.
Wilhelm Stein: Nietzsche und die bildende Kunst. Berlin 1925.
Carl Heymann. 8°. 20 S.
Das kleine Heft gibt einen ausgezeichneten Einblick in das dynamische, nicht
diskursiv zu fassende Verhältnis Nietzsches zu den einzelnen bildenden Künsten.
Indem eigentlich nur seine eigenen Worte zitiert und in geschickter Weise teils
biographisch, teils nach Wertungen in Verbindung gebracht werden, entsteht ein
sehr bewegtes Bild von dem Einfluß der Kunst auf Nietzsche, die als solche für
ihn nur ganz am Rande stand, aber als verwandelnde Kraft oft bis in die Mitte
seiner philosophischen Wirksamkeit schoß.
Durch seine nahe Beziehung zur Musik war ihm die Malerei von jeher nahe.
Claude Lorrain gab ihm die höchste Erfüllung. In der Baukunst sah er das Dyna-
mische vor allem; Plastik war ihm ferner, aber wertvoll, denn: sie bildet tiefer als
die Ethik. Aber das Bildende hat für ihn nur da eine Berechtigung, wo aus dem
Werden ein Sein herausgerissen wird, wo die Bewältigung der Spannung noch ge-
fühlt wird. So sieht er Raffael, so Michelangelo, so in der Kunst den Künstler, der
im Geben seinen Höhepunkt hat. Das menschlich Schöne ist ein Teil des menschlich
Großen, denn das Kunstwerk ist nicht zum Genuß, sondern zur Steigerung des
Lebens da.
BESPRECHUNGEN.
hat. Wie diese Entwicklung-, die zwar von der begrifflichen Isolierung des Ästheti-
schen in Kants Reflexionsphilosophie ihren Ausgang genommen hatte, bereits in
den ästhetischen Schriften Schillers und vollends in der Philosophie Schellings und
Hegels das Ästhetische unter einen allgemeinen Gesichtspunkt stellte und mit den
übrigen weltanschaulichen Problemen in Verbindung brachte, so möchte auch die
Jugendschrift Kuno Fischers die Idee des Schönen aus einer universalen Problem-
stellung heraus entwickeln. Sie will, wie Kuno Fischer selbst in der Vorrede zu
seiner Schrift verkündete, „das Schöne nicht als ein besonderes wissenschaftliches
Objekt von einem besonderen Gesichtspunkt aus betrachten, wie es innerhalb der
systematischen Philosophie mit Recht geschieht: sie ist daher nicht eine spezielle
Ästhetik. Vielmehr will sie die Idee des Schönen dem modernen Weltbewußtsein
gegenüber beleuchten, und wenn es möglich ist, dieses an jener darstellen. Das
freie Interesse am Schönen setzt sie voraus, aber die Einsicht in das Schöne möchte
sie nicht isolieren und nicht unabhängig von der Einsicht in die übrigen Mächte
der Welt entwickeln."
Wenn diese Worte Kuno Fischers selbst am besten den Standpunkt bezeichnen,
den seine Schrift einnimmt, so macht uns Hermann Glockner, der die Neu-
ausgabe besorgt hat, in einer dankenswerten Einleitung dazu bekannt mit der Stel-
lung, die die Jugendschrift Kuno Fischers im Leben ihres Verfassers eingenommen
hat. Wir erfahren dabei, daß die frühen religionsphilosophischen und theologischen
Interessen Kuno Fischers abgelöst wurden von einer lebhaften Beschäftigung mit
ästhetischen Problemen, die mit einem längeren Aufenthalt in Karlsruhe einsetzt,
wo der Besuch des Hoftheaters zu dramaturgischen Kritiken Anlaß gab, die ihrer-
seits wieder eine enge Freundschaft mit dem großen Tragöden Dessoir zur Folge
hatten. Daneben betont der Herausgeber besonders den großen Einfluß, den Schil-
lers „Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" auf Kuno Fischer aus-
geübt haben. Schließlich erhalten wir noch Kenntnis von dem Briefe, in welchem
Fr. Th. Vischer die Diotima-Schrift dankend anerkannt hat.
Der Verlag hat die Ausgabe geschmackvoll ausgestattet und ihr ein Jugend-
bildnis Kuno Fischers beigefügt, das aus dem Erscheinungsjahre dieser Schrift
stammt.
Heidelberg. Friedrich Kreis.
Wilhelm Stein: Nietzsche und die bildende Kunst. Berlin 1925.
Carl Heymann. 8°. 20 S.
Das kleine Heft gibt einen ausgezeichneten Einblick in das dynamische, nicht
diskursiv zu fassende Verhältnis Nietzsches zu den einzelnen bildenden Künsten.
Indem eigentlich nur seine eigenen Worte zitiert und in geschickter Weise teils
biographisch, teils nach Wertungen in Verbindung gebracht werden, entsteht ein
sehr bewegtes Bild von dem Einfluß der Kunst auf Nietzsche, die als solche für
ihn nur ganz am Rande stand, aber als verwandelnde Kraft oft bis in die Mitte
seiner philosophischen Wirksamkeit schoß.
Durch seine nahe Beziehung zur Musik war ihm die Malerei von jeher nahe.
Claude Lorrain gab ihm die höchste Erfüllung. In der Baukunst sah er das Dyna-
mische vor allem; Plastik war ihm ferner, aber wertvoll, denn: sie bildet tiefer als
die Ethik. Aber das Bildende hat für ihn nur da eine Berechtigung, wo aus dem
Werden ein Sein herausgerissen wird, wo die Bewältigung der Spannung noch ge-
fühlt wird. So sieht er Raffael, so Michelangelo, so in der Kunst den Künstler, der
im Geben seinen Höhepunkt hat. Das menschlich Schöne ist ein Teil des menschlich
Großen, denn das Kunstwerk ist nicht zum Genuß, sondern zur Steigerung des
Lebens da.