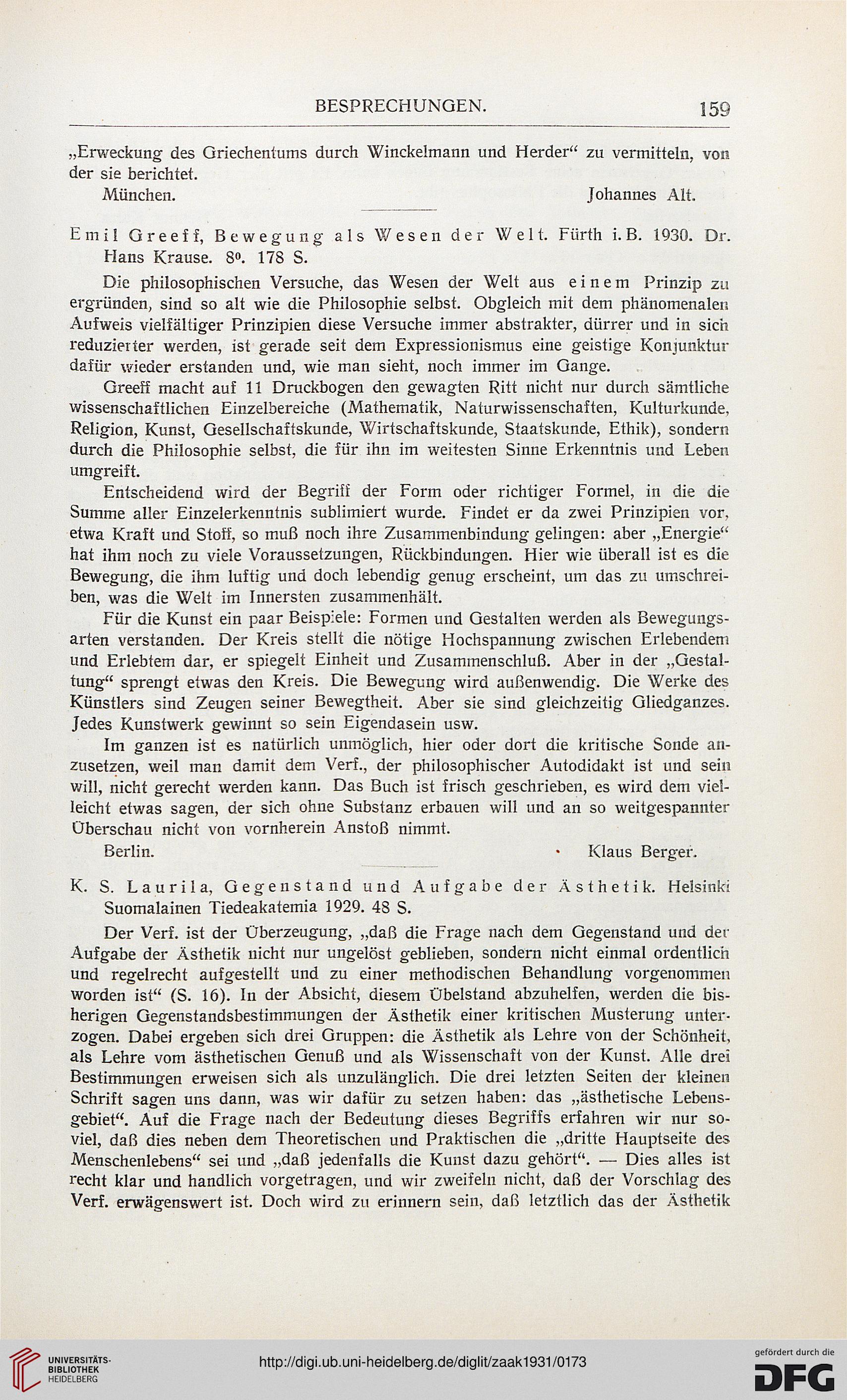BESPRECHUNGEN.
159
„Erweckung des Griechentums durch Winckelmann und Herder" zu vermitteln, von
der sie berichtet.
München. Johannes Alt.
Emil Greeff, Bewegung als Wesen der Welt. Fürth i. B. 1930. Dr.
Hans Krause. 8». 178 S.
Die philosophischen Versuche, das Wesen der Welt aus einem Prinzip zu
ergründen, sind so alt wie die Philosophie selbst. Obgleich mit dem phänomenalen
Aufweis vielfältiger Prinzipien diese Versuche immer abstrakter, dürrer und in sich
reduzierter werden, ist gerade seit dem Expressionismus eine geistige Konjunktur
dafür wieder erstanden und, wie man sieht, noch immer im Gange.
Greeff macht auf 11 Druckbogen den gewagten Ritt nicht nur durch sämtliche
wissenschaftlichen Einzelbereiche (Mathematik, Naturwissenschaften, Kulturkunde,
Religion, Kunst, Gesellschaftskunde, Wirtschaftskunde, Staatskunde, Ethik), sondern
durch die Philosophie selbst, die für ihn im weitesten Sinne Erkenntnis und Leben
umgreift.
Entscheidend wird der Begriff der Form oder richtiger Formel, in die die
Summe aller Einzelerkenntnis sublimiert wurde. Findet er da zwei Prinzipien vor,
etwa Kraft und Stoff, so muß noch ihre Zusammenbindung gelingen: aber „Energie"
hat ihm noch zu viele Voraussetzungen, Rückbindungen. Hier wie überall ist es die
Bewegung, die ihm luftig und doch lebendig genug erscheint, um das zu umschrei-
ben, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Für die Kunst ein paar Beispiele: Formen und Gestalten werden als Bewegungs-
arten verstanden. Der Kreis stellt die nötige Hochspannung zwischen Erlebendem
und Erlebtem dar, er spiegelt Einheit und Zusammenschluß. Aber in der „Gestal-
tung" sprengt etwas den Kreis. Die Bewegung wird außenwendig. Die Werke des
Künstlers sind Zeugen seiner Bewegtheit. Aber sie sind gleichzeitig Gliedganzes.
Jedes Kunstwerk gewinnt so sein Eigendasein usw.
Im ganzen ist es natürlich unmöglich, hier oder dort die kritische Sonde an-
zusetzen, weil man damit dem Verf., der philosophischer Autodidakt ist und sein
will, nicht gerecht werden kann. Das Buch ist frisch geschrieben, es wird dem viel-
leicht etwas sagen, der sich ohne Substanz erbauen will und an so weitgespannter
Überschau nicht von vornherein Anstoß nimmt.
Berlin. • Klaus Berger.
K. S. Laurila, Gegenstand und Aufgabe der Ästhetik. Helsinki
Suomalainen Tiedeakatemia 1929. 48 S.
Der Verf. ist der Überzeugung, „daß die Frage nach dem Gegenstand und der
Aufgabe der Ästhetik nicht nur ungelöst geblieben, sondern nicht einmal ordentlich
und regelrecht aufgestellt und zu einer methodischen Behandlung vorgenommen
worden ist" (S. 16). In der Absicht, diesem Übelstand abzuhelfen, werden die bis-
herigen Gegenstandsbestimmungen der Ästhetik einer kritischen Musterung unter-
zogen. Dabei ergeben sich drei Gruppen: die Ästhetik als Lehre von der Schönheit,
als Lehre vom ästhetischen Genuß und als Wissenschaft von der Kunst. Alle drei
Bestimmungen erweisen sich als unzulänglich. Die drei letzten Seiten der kleinen
Schrift sagen uns dann, was wir dafür zu setzen haben: das „ästhetische Lebens-
gebiet". Auf die Frage nach der Bedeutung dieses Begriffs erfahren wir nur so-
viel, daß dies neben dem Theoretischen und Praktischen die „dritte Hauptseite des
Menschenlebens" sei und „daß jedenfalls die Kunst dazu gehört". — Dies alles ist
recht klar und handlich vorgetragen, und wir zweifeln nicht, daß der Vorschlag des
Verf. erwägenswert ist. Doch wird zu erinnern sein, daß letztlich das der Ästhetik
159
„Erweckung des Griechentums durch Winckelmann und Herder" zu vermitteln, von
der sie berichtet.
München. Johannes Alt.
Emil Greeff, Bewegung als Wesen der Welt. Fürth i. B. 1930. Dr.
Hans Krause. 8». 178 S.
Die philosophischen Versuche, das Wesen der Welt aus einem Prinzip zu
ergründen, sind so alt wie die Philosophie selbst. Obgleich mit dem phänomenalen
Aufweis vielfältiger Prinzipien diese Versuche immer abstrakter, dürrer und in sich
reduzierter werden, ist gerade seit dem Expressionismus eine geistige Konjunktur
dafür wieder erstanden und, wie man sieht, noch immer im Gange.
Greeff macht auf 11 Druckbogen den gewagten Ritt nicht nur durch sämtliche
wissenschaftlichen Einzelbereiche (Mathematik, Naturwissenschaften, Kulturkunde,
Religion, Kunst, Gesellschaftskunde, Wirtschaftskunde, Staatskunde, Ethik), sondern
durch die Philosophie selbst, die für ihn im weitesten Sinne Erkenntnis und Leben
umgreift.
Entscheidend wird der Begriff der Form oder richtiger Formel, in die die
Summe aller Einzelerkenntnis sublimiert wurde. Findet er da zwei Prinzipien vor,
etwa Kraft und Stoff, so muß noch ihre Zusammenbindung gelingen: aber „Energie"
hat ihm noch zu viele Voraussetzungen, Rückbindungen. Hier wie überall ist es die
Bewegung, die ihm luftig und doch lebendig genug erscheint, um das zu umschrei-
ben, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Für die Kunst ein paar Beispiele: Formen und Gestalten werden als Bewegungs-
arten verstanden. Der Kreis stellt die nötige Hochspannung zwischen Erlebendem
und Erlebtem dar, er spiegelt Einheit und Zusammenschluß. Aber in der „Gestal-
tung" sprengt etwas den Kreis. Die Bewegung wird außenwendig. Die Werke des
Künstlers sind Zeugen seiner Bewegtheit. Aber sie sind gleichzeitig Gliedganzes.
Jedes Kunstwerk gewinnt so sein Eigendasein usw.
Im ganzen ist es natürlich unmöglich, hier oder dort die kritische Sonde an-
zusetzen, weil man damit dem Verf., der philosophischer Autodidakt ist und sein
will, nicht gerecht werden kann. Das Buch ist frisch geschrieben, es wird dem viel-
leicht etwas sagen, der sich ohne Substanz erbauen will und an so weitgespannter
Überschau nicht von vornherein Anstoß nimmt.
Berlin. • Klaus Berger.
K. S. Laurila, Gegenstand und Aufgabe der Ästhetik. Helsinki
Suomalainen Tiedeakatemia 1929. 48 S.
Der Verf. ist der Überzeugung, „daß die Frage nach dem Gegenstand und der
Aufgabe der Ästhetik nicht nur ungelöst geblieben, sondern nicht einmal ordentlich
und regelrecht aufgestellt und zu einer methodischen Behandlung vorgenommen
worden ist" (S. 16). In der Absicht, diesem Übelstand abzuhelfen, werden die bis-
herigen Gegenstandsbestimmungen der Ästhetik einer kritischen Musterung unter-
zogen. Dabei ergeben sich drei Gruppen: die Ästhetik als Lehre von der Schönheit,
als Lehre vom ästhetischen Genuß und als Wissenschaft von der Kunst. Alle drei
Bestimmungen erweisen sich als unzulänglich. Die drei letzten Seiten der kleinen
Schrift sagen uns dann, was wir dafür zu setzen haben: das „ästhetische Lebens-
gebiet". Auf die Frage nach der Bedeutung dieses Begriffs erfahren wir nur so-
viel, daß dies neben dem Theoretischen und Praktischen die „dritte Hauptseite des
Menschenlebens" sei und „daß jedenfalls die Kunst dazu gehört". — Dies alles ist
recht klar und handlich vorgetragen, und wir zweifeln nicht, daß der Vorschlag des
Verf. erwägenswert ist. Doch wird zu erinnern sein, daß letztlich das der Ästhetik