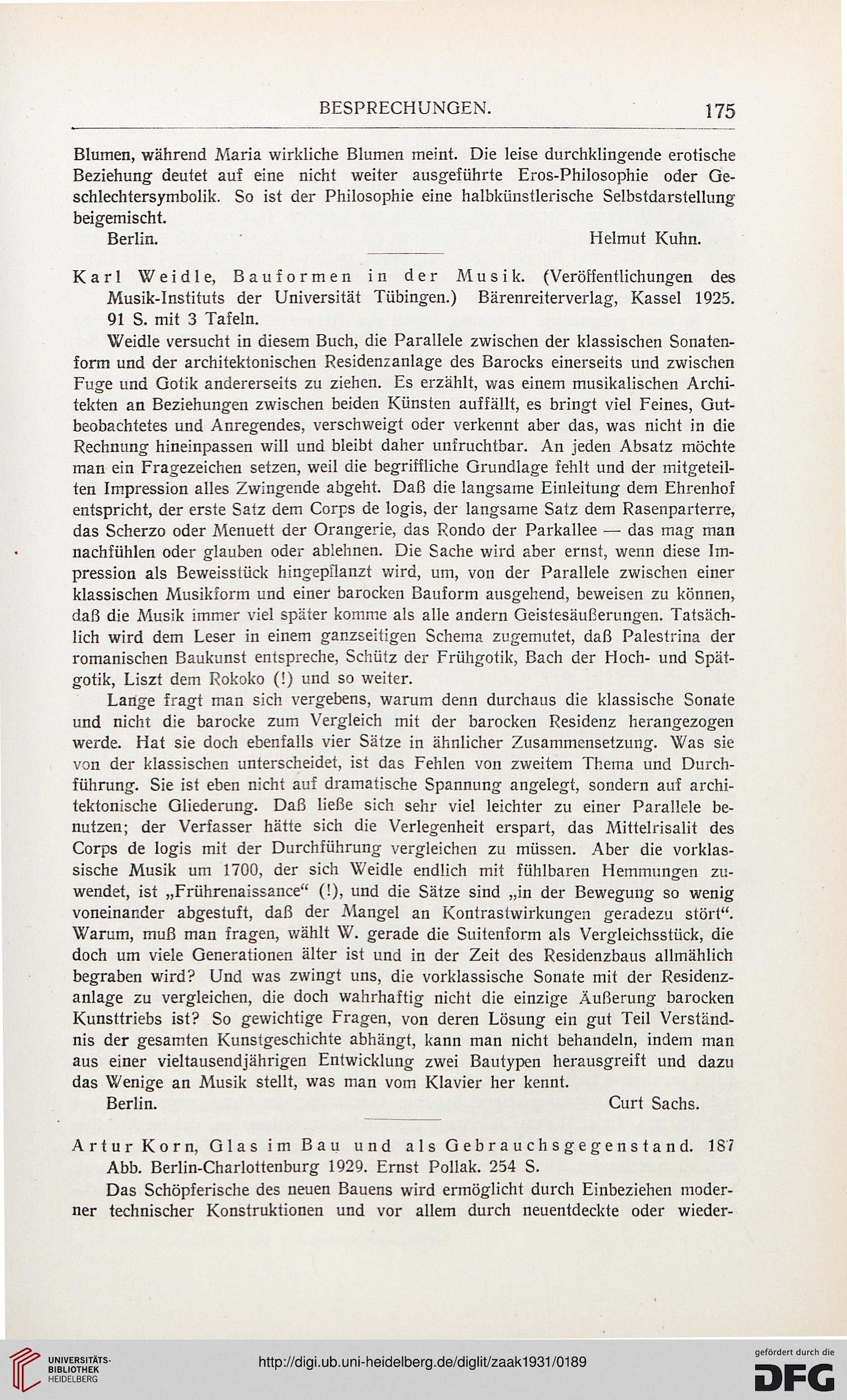BESPRECHUNGEN.
175
Blumen, während Maria wirkliche Blumen meint. Die leise durchklingende erotische
Beziehung deutet auf eine nicht weiter ausgeführte Eros-Philosophie oder Ge-
schlechtersymbolik. So ist der Philosophie eine halbkünstlerische Selbstdarstellung
beigemischt.
Berlin. Helmut Kuhn.
Karl Weidle, Bauformen in der Musik. (Veröffentlichungen des
Musik-Instituts der Universität Tübingen.) Bärenreiterverlag, Kassel 1925.
91 S. mit 3 Tafeln.
Weidle versucht in diesem Buch, die Parallele zwischen der klassischen Sonaten-
form und der architektonischen Residenzanlage des Barocks einerseits und zwischen
Fuge und Gotik andererseits zu ziehen. Es erzählt, was einem musikalischen Archi-
tekten an Beziehungen zwischen beiden Künsten auffällt, es bringt viel Feines, Gut-
beobachtetes und Anregendes, verschweigt oder verkennt aber das, was nicht in die
Rechnung hineinpassen will und bleibt daher unfruchtbar. An jeden Absatz möchte
man ein Fragezeichen setzen, weil die begriffliche Grundlage fehlt und der mitgeteil-
ten Impression alles Zwingende abgeht. Daß die langsame Einleitung dem Ehrenhof
entspricht, der erste Satz dem Corps de logis, der langsame Satz dem Rasenparterre,
das Scherzo oder Menuett der Orangerie, das Rondo der Parkallee — das mag man
nachfühlen oder glauben oder ablehnen. Die Sache wird aber ernst, wenn diese Im-
pression als Beweisstück hingepflanzt wird, um, von der Parallele zwischen einer
klassischen Musikiorm und einer barocken Bauform ausgehend, beweisen zu können,
daß die Musik immer viel später komme als alle andern Geistesäußerungen. Tatsäch-
lich wird dem Leser in einem ganzseitigen Schema zugemutet, daß Palestrina der
romanischen Baukunst entspreche, Schütz der Frühgotik, Bach der Hoch- und Spät-
gotik, Liszt dem Rokoko (!) und so weiter.
Lange fragt man sich vergebens, warum denn durchaus die klassische Sonate
und nicht die barocke zum Vergleich mit der barocken Residenz herangezogen
werde. Hat sie doch ebenfalls vier Sätze in ähnlicher Zusammensetzung. Was sie
von der klassischen unterscheidet, ist das Fehlen von zweitem Thema und Durch-
führung. Sie ist eben nicht auf dramatische Spannung angelegt, sondern auf archi-
tektonische Gliederung. Daß ließe sich sehr viel leichter zu einer Parallele be-
nutzen; der Verfasser hätte sich die Verlegenheit erspart, das Mittelrisalit des
Corps de logis mit der Durchführung vergleichen zu müssen. Aber die vorklas-
sische Musik um 1700, der sich Weidle endlich mit fühlbaren Hemmungen zu-
wendet, ist „Frührenaissance" (!), und die Sätze sind „in der Bewegung so wenig
voneinander abgestuft, daß der Mangel an Kontrastwirkungen geradezu stört".
Warum, muß man fragen, wählt W. gerade die Suitenform als Vergleichsstück, die
doch um viele Generationen älter ist und in der Zeit des Residenzbaus allmählich
begraben wird? Und was zwingt uns, die vorklassische Sonate mit der Residenz-
anlage zu vergleichen, die doch wahrhaftig nicht die einzige Äußerung barocken
Kunsttriebs ist? So gewichtige Fragen, von deren Lösung ein gut Teil Verständ-
nis der gesamten Kunstgeschichte abhängt, kann man nicht behandeln, indem man
aus einer vieltausendjährigen Entwicklung zwei Bautypen herausgreift und dazu
das Wenige an Musik stellt, was man vom Klavier her kennt.
Berlin. Curt Sachs.
Artur Korn, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand. 187
Abb. Berlin-Charlottenburg 1929. Ernst Pollak. 254 S.
Das Schöpferische des neuen Bauens wird ermöglicht durch Einbeziehen moder-
ner technischer Konstruktionen und vor allem durch neuentdeckte oder wieder-
175
Blumen, während Maria wirkliche Blumen meint. Die leise durchklingende erotische
Beziehung deutet auf eine nicht weiter ausgeführte Eros-Philosophie oder Ge-
schlechtersymbolik. So ist der Philosophie eine halbkünstlerische Selbstdarstellung
beigemischt.
Berlin. Helmut Kuhn.
Karl Weidle, Bauformen in der Musik. (Veröffentlichungen des
Musik-Instituts der Universität Tübingen.) Bärenreiterverlag, Kassel 1925.
91 S. mit 3 Tafeln.
Weidle versucht in diesem Buch, die Parallele zwischen der klassischen Sonaten-
form und der architektonischen Residenzanlage des Barocks einerseits und zwischen
Fuge und Gotik andererseits zu ziehen. Es erzählt, was einem musikalischen Archi-
tekten an Beziehungen zwischen beiden Künsten auffällt, es bringt viel Feines, Gut-
beobachtetes und Anregendes, verschweigt oder verkennt aber das, was nicht in die
Rechnung hineinpassen will und bleibt daher unfruchtbar. An jeden Absatz möchte
man ein Fragezeichen setzen, weil die begriffliche Grundlage fehlt und der mitgeteil-
ten Impression alles Zwingende abgeht. Daß die langsame Einleitung dem Ehrenhof
entspricht, der erste Satz dem Corps de logis, der langsame Satz dem Rasenparterre,
das Scherzo oder Menuett der Orangerie, das Rondo der Parkallee — das mag man
nachfühlen oder glauben oder ablehnen. Die Sache wird aber ernst, wenn diese Im-
pression als Beweisstück hingepflanzt wird, um, von der Parallele zwischen einer
klassischen Musikiorm und einer barocken Bauform ausgehend, beweisen zu können,
daß die Musik immer viel später komme als alle andern Geistesäußerungen. Tatsäch-
lich wird dem Leser in einem ganzseitigen Schema zugemutet, daß Palestrina der
romanischen Baukunst entspreche, Schütz der Frühgotik, Bach der Hoch- und Spät-
gotik, Liszt dem Rokoko (!) und so weiter.
Lange fragt man sich vergebens, warum denn durchaus die klassische Sonate
und nicht die barocke zum Vergleich mit der barocken Residenz herangezogen
werde. Hat sie doch ebenfalls vier Sätze in ähnlicher Zusammensetzung. Was sie
von der klassischen unterscheidet, ist das Fehlen von zweitem Thema und Durch-
führung. Sie ist eben nicht auf dramatische Spannung angelegt, sondern auf archi-
tektonische Gliederung. Daß ließe sich sehr viel leichter zu einer Parallele be-
nutzen; der Verfasser hätte sich die Verlegenheit erspart, das Mittelrisalit des
Corps de logis mit der Durchführung vergleichen zu müssen. Aber die vorklas-
sische Musik um 1700, der sich Weidle endlich mit fühlbaren Hemmungen zu-
wendet, ist „Frührenaissance" (!), und die Sätze sind „in der Bewegung so wenig
voneinander abgestuft, daß der Mangel an Kontrastwirkungen geradezu stört".
Warum, muß man fragen, wählt W. gerade die Suitenform als Vergleichsstück, die
doch um viele Generationen älter ist und in der Zeit des Residenzbaus allmählich
begraben wird? Und was zwingt uns, die vorklassische Sonate mit der Residenz-
anlage zu vergleichen, die doch wahrhaftig nicht die einzige Äußerung barocken
Kunsttriebs ist? So gewichtige Fragen, von deren Lösung ein gut Teil Verständ-
nis der gesamten Kunstgeschichte abhängt, kann man nicht behandeln, indem man
aus einer vieltausendjährigen Entwicklung zwei Bautypen herausgreift und dazu
das Wenige an Musik stellt, was man vom Klavier her kennt.
Berlin. Curt Sachs.
Artur Korn, Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand. 187
Abb. Berlin-Charlottenburg 1929. Ernst Pollak. 254 S.
Das Schöpferische des neuen Bauens wird ermöglicht durch Einbeziehen moder-
ner technischer Konstruktionen und vor allem durch neuentdeckte oder wieder-