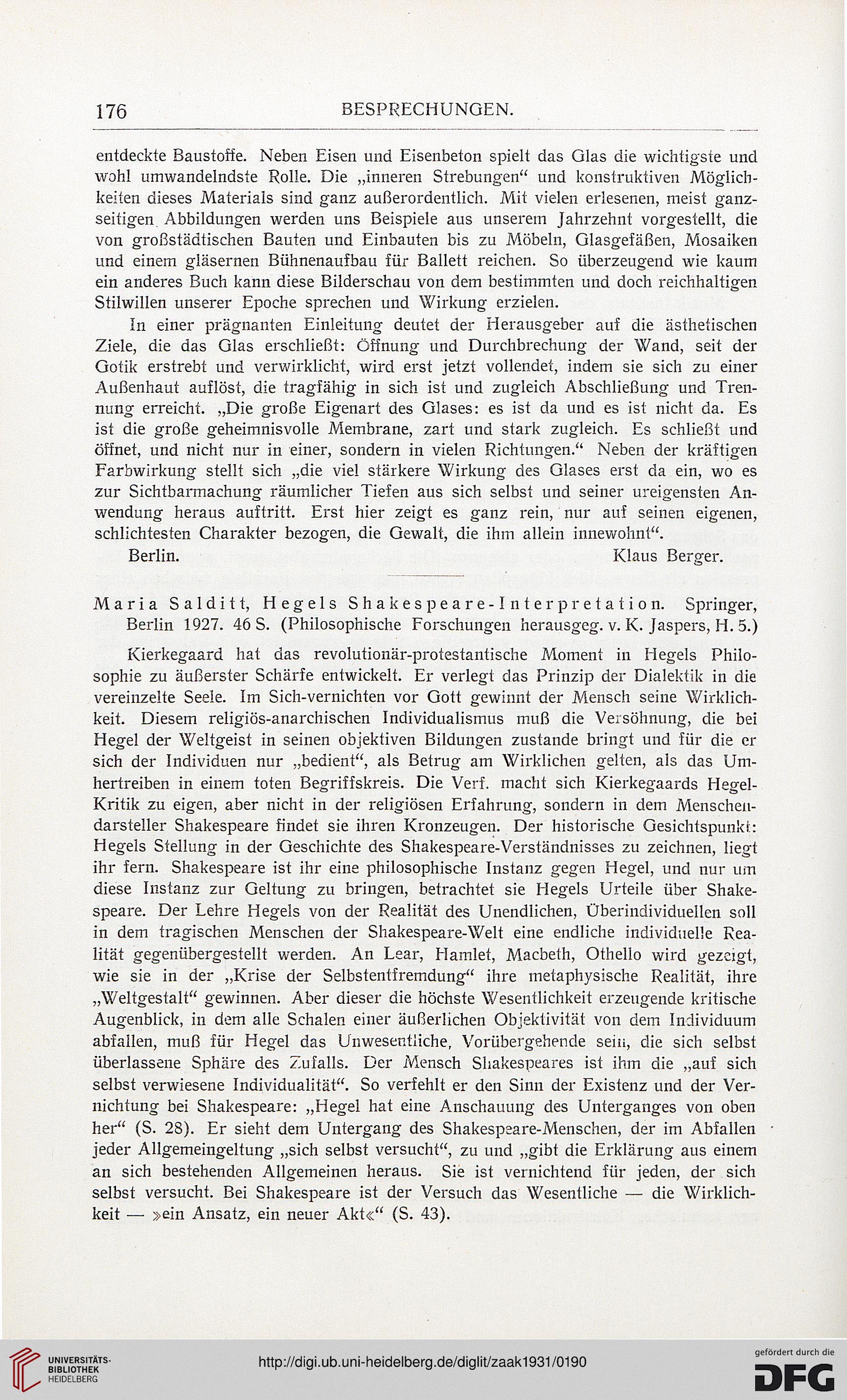176
BESPRECHUNGEN.
entdeckte Baustoffe. Neben Eisen und Eisenbeton spielt das Glas die wichtigste und
wohl umwandelndste Rolle. Die „inneren Strebungen" und konstruktiven Möglich-
keiten dieses Materials sind ganz außerordentlich. Mit vielen erlesenen, meist ganz-
seitigen Abbildungen werden uns Beispiele aus unserem Jahrzehnt vorgestellt, die
von großstädtischen Bauten und Einbauten bis zu Möbeln, Glasgefäßen, Mosaiken
und einem gläsernen Bühnenaufbau für Ballett reichen. So überzeugend wie kaum
ein anderes Buch kann diese Bilderschau von dem bestimmten und doch reichhaltigen
Stilwillen unserer Epoche sprechen und Wirkung erzielen.
In einer prägnanten Einleitung deutet der Herausgeber auf die ästhetischen
Ziele, die das Glas erschließt: Öffnung und Durchbrechung der Wand, seit der
Gotik erstrebt und verwirklicht, wird erst jetzt vollendet, indem sie sich zu einer
Außenhaut auflöst, die tragfähig in sich ist und zugleich Abschließung und Tren-
nung erreicht. „Die große Eigenart des Glases: es ist da und es ist nicht da. Es
ist die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zugleich. Es schließt und
öffnet, und nicht nur in einer, sondern in vielen Richtungen." Neben der kräftigen
Farbwirkung stellt sich „die viel stärkere Wirkung des Glases erst da ein, wo es
zur Sichtbarmachung räumlicher Tiefen aus sich selbst und seiner ureigensten An-
wendung heraus auftritt. Erst hier zeigt es ganz rein, nur auf seinen eigenen,
schlichtesten Charakter bezogen, die Gewalt, die ihm allein innewohnt".
Berlin. Klaus Berger.
Maria Salditt, Hegels Shakespeare-Interpretation. Springer,
Berlin 1927. 46 S. (Philosophische Forschungen herausgeg. v. K. Jaspers, H. 5.)
Kierkegaard hat das revolutionär-protestantische Moment in Hegels Philo-
sophie zu äußerster Schärfe entwickelt. Er verlegt das Prinzip der Dialektik in die
vereinzelte Seele. Im Sich-vernichten vor Gott gewinnt der Mensch seine Wirklich-
keit. Diesem religiös-anarchischen Individualismus muß die Versöhnung, die bei
Hegel der Weltgeist in seinen objektiven Bildungen zustande bringt und für die er
sich der Individuen nur „bedient", als Betrug am Wirklichen gelten, als das Um-
hertreiben in einem toten Begriffskreis. Die Verf. macht sich Kierkegaards Hegel-
Kritik zu eigen, aber nicht in der religiösen Erfahrung, sondern in dem Menschen-
darsteller Shakespeare findet sie ihren Kronzeugen. Der historische Gesichtspunkt:
Hegels Stellung in der Geschichte des Shakespeare-Verständnisses zu zeichnen, liegt
ihr fern. Shakespeare ist ihr eine philosophische Instanz gegen Hegel, und nur um
diese Instanz zur Geltung zu bringen, betrachtet sie Hegels Urteile über Shake-
speare. Der Lehre Hegels von der Realität des Unendlichen, Überindividuellen soll
in dem tragischen Menschen der Shakespeare-Welt eine endliche individuelle Rea-
lität gegenübergestellt werden. An Lear, Hamlet, Macbeth, Othello wird gezeigt,
wie sie in der „Krise der Selbstentfremdung" ihre metaphysische Realität, ihre
„Weltgestalt" gewinnen. Aber dieser die höchste Wesentlichkeit erzeugende kritische
Augenblick, in dem alle Schalen einer äußerlichen Objektivität von dem Individuum
abfallen, muß für Hegel das Unwesentliche, Vorübergehende sein, die sich selbst
Überlasseue Sphäre des Zufalls. Der Mensch Shakespeares ist ihm die „auf sich
selbst verwiesene Individualität". So verfehlt er den Sinn der Existenz und der Ver-
nichtung bei Shakespeare: „Hegel hat eine Anschauung des Unterganges von oben
her" (S. 28). Er sieht dem Untergang des Shakespeare-Menschen, der im Abfallen
jeder Allgemeingeltung „sich selbst versucht", zu und „gibt die Erklärung aus einem
an sich bestehenden Allgemeinen heraus. Sie ist vernichtend für jeden, der sich
selbst versucht. Bei Shakespeare ist der Versuch das Wesentliche — die Wirklich-
keit — »ein Ansatz, ein neuer Akt«" (S. 43).
BESPRECHUNGEN.
entdeckte Baustoffe. Neben Eisen und Eisenbeton spielt das Glas die wichtigste und
wohl umwandelndste Rolle. Die „inneren Strebungen" und konstruktiven Möglich-
keiten dieses Materials sind ganz außerordentlich. Mit vielen erlesenen, meist ganz-
seitigen Abbildungen werden uns Beispiele aus unserem Jahrzehnt vorgestellt, die
von großstädtischen Bauten und Einbauten bis zu Möbeln, Glasgefäßen, Mosaiken
und einem gläsernen Bühnenaufbau für Ballett reichen. So überzeugend wie kaum
ein anderes Buch kann diese Bilderschau von dem bestimmten und doch reichhaltigen
Stilwillen unserer Epoche sprechen und Wirkung erzielen.
In einer prägnanten Einleitung deutet der Herausgeber auf die ästhetischen
Ziele, die das Glas erschließt: Öffnung und Durchbrechung der Wand, seit der
Gotik erstrebt und verwirklicht, wird erst jetzt vollendet, indem sie sich zu einer
Außenhaut auflöst, die tragfähig in sich ist und zugleich Abschließung und Tren-
nung erreicht. „Die große Eigenart des Glases: es ist da und es ist nicht da. Es
ist die große geheimnisvolle Membrane, zart und stark zugleich. Es schließt und
öffnet, und nicht nur in einer, sondern in vielen Richtungen." Neben der kräftigen
Farbwirkung stellt sich „die viel stärkere Wirkung des Glases erst da ein, wo es
zur Sichtbarmachung räumlicher Tiefen aus sich selbst und seiner ureigensten An-
wendung heraus auftritt. Erst hier zeigt es ganz rein, nur auf seinen eigenen,
schlichtesten Charakter bezogen, die Gewalt, die ihm allein innewohnt".
Berlin. Klaus Berger.
Maria Salditt, Hegels Shakespeare-Interpretation. Springer,
Berlin 1927. 46 S. (Philosophische Forschungen herausgeg. v. K. Jaspers, H. 5.)
Kierkegaard hat das revolutionär-protestantische Moment in Hegels Philo-
sophie zu äußerster Schärfe entwickelt. Er verlegt das Prinzip der Dialektik in die
vereinzelte Seele. Im Sich-vernichten vor Gott gewinnt der Mensch seine Wirklich-
keit. Diesem religiös-anarchischen Individualismus muß die Versöhnung, die bei
Hegel der Weltgeist in seinen objektiven Bildungen zustande bringt und für die er
sich der Individuen nur „bedient", als Betrug am Wirklichen gelten, als das Um-
hertreiben in einem toten Begriffskreis. Die Verf. macht sich Kierkegaards Hegel-
Kritik zu eigen, aber nicht in der religiösen Erfahrung, sondern in dem Menschen-
darsteller Shakespeare findet sie ihren Kronzeugen. Der historische Gesichtspunkt:
Hegels Stellung in der Geschichte des Shakespeare-Verständnisses zu zeichnen, liegt
ihr fern. Shakespeare ist ihr eine philosophische Instanz gegen Hegel, und nur um
diese Instanz zur Geltung zu bringen, betrachtet sie Hegels Urteile über Shake-
speare. Der Lehre Hegels von der Realität des Unendlichen, Überindividuellen soll
in dem tragischen Menschen der Shakespeare-Welt eine endliche individuelle Rea-
lität gegenübergestellt werden. An Lear, Hamlet, Macbeth, Othello wird gezeigt,
wie sie in der „Krise der Selbstentfremdung" ihre metaphysische Realität, ihre
„Weltgestalt" gewinnen. Aber dieser die höchste Wesentlichkeit erzeugende kritische
Augenblick, in dem alle Schalen einer äußerlichen Objektivität von dem Individuum
abfallen, muß für Hegel das Unwesentliche, Vorübergehende sein, die sich selbst
Überlasseue Sphäre des Zufalls. Der Mensch Shakespeares ist ihm die „auf sich
selbst verwiesene Individualität". So verfehlt er den Sinn der Existenz und der Ver-
nichtung bei Shakespeare: „Hegel hat eine Anschauung des Unterganges von oben
her" (S. 28). Er sieht dem Untergang des Shakespeare-Menschen, der im Abfallen
jeder Allgemeingeltung „sich selbst versucht", zu und „gibt die Erklärung aus einem
an sich bestehenden Allgemeinen heraus. Sie ist vernichtend für jeden, der sich
selbst versucht. Bei Shakespeare ist der Versuch das Wesentliche — die Wirklich-
keit — »ein Ansatz, ein neuer Akt«" (S. 43).