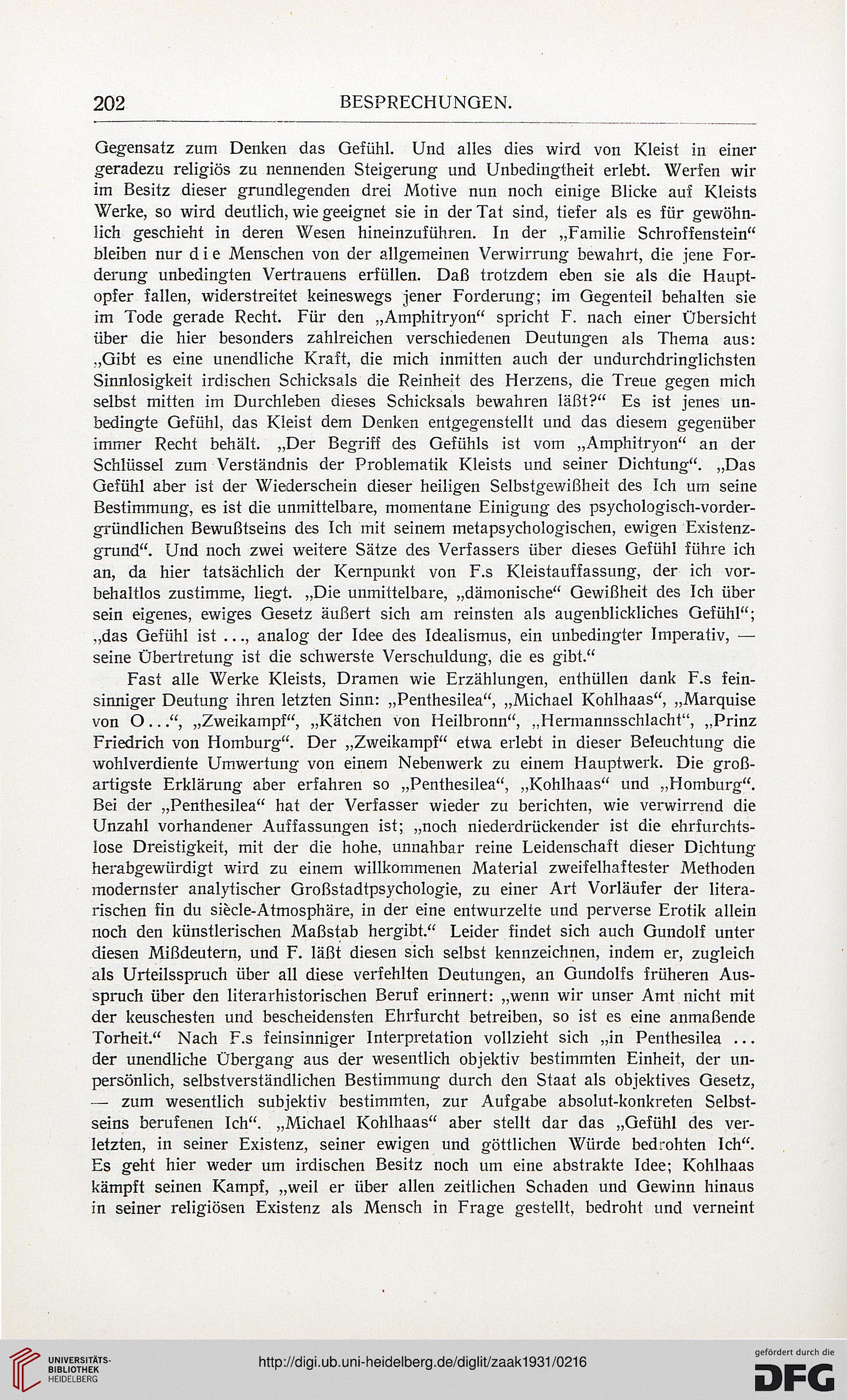202
BESPRECHUNGEN.
Gegensatz zum Denken das Gefühl. Und alles dies wird von Kleist in einer
geradezu religiös zu nennenden Steigerung und Unbedingtheit erlebt. Werfen wir
im Besitz dieser grundlegenden drei Motive nun noch einige Blicke auf Kleists
Werke, so wird deutlich, wie geeignet sie in der Tat sind, tiefer als es für gewöhn-
lich geschieht in deren Wesen hineinzuführen. In der „Familie Schroffenstein"
bleiben nur d i e Menschen von der allgemeinen Verwirrung bewahrt, die jene For-
derung unbedingten Vertrauens erfüllen. Daß trotzdem eben sie als die Haupt-
opfer fallen, widerstreitet keineswegs jener Forderung; im Gegenteil behalten sie
im Tode gerade Recht. Für den „Amphitryon" spricht F. nach einer Übersicht
über die hier besonders zahlreichen verschiedenen Deutungen als Thema aus:
„Gibt es eine unendliche Kraft, die mich inmitten auch der undurchdringlichsten
Sinnlosigkeit irdischen Schicksals die Reinheit des Herzens, die Treue gegen mich
selbst mitten im Durchleben dieses Schicksals bewahren läßt?" Es ist jenes un-
bedingte Gefühl, das Kleist dem Denken entgegenstellt und das diesem gegenüber
immer Recht behält. „Der Begriff des Gefühls ist vom „Amphitryon" an der
Schlüssel zum Verständnis der Problematik Kleists und seiner Dichtung". „Das
Gefühl aber ist der Wiederschein dieser heiligen Selbstgewißheit des Ich um seine
Bestimmung, es ist die unmittelbare, momentane Einigung des psychologisch-vorder-
gründlichen Bewußtseins des Ich mit seinem metapsychologischen, ewigen Existenz-
grund". Und noch zwei weitere Sätze des Verfassers über dieses Gefühl führe ich
an, da hier tatsächlich der Kernpunkt von F.s Kleistauffassung, der ich vor-
behaltlos zustimme, liegt. „Die unmittelbare, „dämonische" Gewißheit des Ich über
sein eigenes, ewiges Gesetz äußert sich am reinsten als augenblickliches Gefühl";
„das Gefühl ist ..., analog der Idee des Idealismus, ein unbedingter Imperativ, —
seine Übertretung ist die schwerste Verschuldung, die es gibt."
Fast alle Werke Kleists, Dramen wie Erzählungen, enthüllen dank F.s fein-
sinniger Deutung ihren letzten Sinn: „Penthesilea", „Michael Kohlhaas", „Marquise
von O...", „Zweikampf", „Kätchen von Heilbronn", „Hermannsschlacht", „Prinz
Friedrich von Homburg". Der „Zweikampf" etwa erlebt in dieser Beleuchtung die
wohlverdiente Umwertung von einem Nebenwerk zu einem Hauptwerk. Die groß-
artigste Erklärung aber erfahren so „Penthesilea", „Kohlhaas" und „Homburg".
Bei der „Penthesilea" hat der Verfasser wieder zu berichten, wie verwirrend die
Unzahl vorhandener Auffassungen ist; „noch niederdrückender ist die ehrfurchts-
lose Dreistigkeit, mit der die hohe, unnahbar reine Leidenschaft dieser Dichtung
herabgewürdigt wird zu einem willkommenen Material zweifelhaftester Methoden
modernster analytischer Großstadtpsychologie, zu einer Art Vorläufer der litera-
rischen h'n du siecle-Atmosphäre, in der eine entwurzelte und perverse Erotik allein
noch den künstlerischen Maßstab hergibt." Leider findet sich auch Gundolf unter
diesen Mißdeutern, und F. läßt diesen sich selbst kennzeichnen, indem er, zugleich
als Urteilsspruch über all diese verfehlten Deutungen, an Gundolfs früheren Aus-
spruch über den literarhistorischen Beruf erinnert: „wenn wir unser Amt nicht mit
der keuschesten und bescheidensten Ehrfurcht betreiben, so ist es eine anmaßende
Torheit." Nach F.s feinsinniger Interpretation vollzieht sich „in Penthesilea ...
der unendliche Übergang aus der wesentlich objektiv bestimmten Einheit, der un-
persönlich, selbstverständlichen Bestimmung durch den Staat als objektives Gesetz,
— zum wesentlich subjektiv bestimmten, zur Aufgabe absolut-konkreten Selbst-
seins berufenen Ich". „Michael Kohlhaas" aber stellt dar das „Gefühl des ver-
letzten, in seiner Existenz, seiner ewigen und göttlichen Würde bedrohten Ich".
Es geht hier weder um irdischen Besitz noch um eine abstrakte Idee; Kohlhaas
kämpft seinen Kampf, „weil er über allen zeitlichen Schaden und Gewinn hinaus
in seiner religiösen Existenz als Mensch in Frage gestellt, bedroht und verneint
BESPRECHUNGEN.
Gegensatz zum Denken das Gefühl. Und alles dies wird von Kleist in einer
geradezu religiös zu nennenden Steigerung und Unbedingtheit erlebt. Werfen wir
im Besitz dieser grundlegenden drei Motive nun noch einige Blicke auf Kleists
Werke, so wird deutlich, wie geeignet sie in der Tat sind, tiefer als es für gewöhn-
lich geschieht in deren Wesen hineinzuführen. In der „Familie Schroffenstein"
bleiben nur d i e Menschen von der allgemeinen Verwirrung bewahrt, die jene For-
derung unbedingten Vertrauens erfüllen. Daß trotzdem eben sie als die Haupt-
opfer fallen, widerstreitet keineswegs jener Forderung; im Gegenteil behalten sie
im Tode gerade Recht. Für den „Amphitryon" spricht F. nach einer Übersicht
über die hier besonders zahlreichen verschiedenen Deutungen als Thema aus:
„Gibt es eine unendliche Kraft, die mich inmitten auch der undurchdringlichsten
Sinnlosigkeit irdischen Schicksals die Reinheit des Herzens, die Treue gegen mich
selbst mitten im Durchleben dieses Schicksals bewahren läßt?" Es ist jenes un-
bedingte Gefühl, das Kleist dem Denken entgegenstellt und das diesem gegenüber
immer Recht behält. „Der Begriff des Gefühls ist vom „Amphitryon" an der
Schlüssel zum Verständnis der Problematik Kleists und seiner Dichtung". „Das
Gefühl aber ist der Wiederschein dieser heiligen Selbstgewißheit des Ich um seine
Bestimmung, es ist die unmittelbare, momentane Einigung des psychologisch-vorder-
gründlichen Bewußtseins des Ich mit seinem metapsychologischen, ewigen Existenz-
grund". Und noch zwei weitere Sätze des Verfassers über dieses Gefühl führe ich
an, da hier tatsächlich der Kernpunkt von F.s Kleistauffassung, der ich vor-
behaltlos zustimme, liegt. „Die unmittelbare, „dämonische" Gewißheit des Ich über
sein eigenes, ewiges Gesetz äußert sich am reinsten als augenblickliches Gefühl";
„das Gefühl ist ..., analog der Idee des Idealismus, ein unbedingter Imperativ, —
seine Übertretung ist die schwerste Verschuldung, die es gibt."
Fast alle Werke Kleists, Dramen wie Erzählungen, enthüllen dank F.s fein-
sinniger Deutung ihren letzten Sinn: „Penthesilea", „Michael Kohlhaas", „Marquise
von O...", „Zweikampf", „Kätchen von Heilbronn", „Hermannsschlacht", „Prinz
Friedrich von Homburg". Der „Zweikampf" etwa erlebt in dieser Beleuchtung die
wohlverdiente Umwertung von einem Nebenwerk zu einem Hauptwerk. Die groß-
artigste Erklärung aber erfahren so „Penthesilea", „Kohlhaas" und „Homburg".
Bei der „Penthesilea" hat der Verfasser wieder zu berichten, wie verwirrend die
Unzahl vorhandener Auffassungen ist; „noch niederdrückender ist die ehrfurchts-
lose Dreistigkeit, mit der die hohe, unnahbar reine Leidenschaft dieser Dichtung
herabgewürdigt wird zu einem willkommenen Material zweifelhaftester Methoden
modernster analytischer Großstadtpsychologie, zu einer Art Vorläufer der litera-
rischen h'n du siecle-Atmosphäre, in der eine entwurzelte und perverse Erotik allein
noch den künstlerischen Maßstab hergibt." Leider findet sich auch Gundolf unter
diesen Mißdeutern, und F. läßt diesen sich selbst kennzeichnen, indem er, zugleich
als Urteilsspruch über all diese verfehlten Deutungen, an Gundolfs früheren Aus-
spruch über den literarhistorischen Beruf erinnert: „wenn wir unser Amt nicht mit
der keuschesten und bescheidensten Ehrfurcht betreiben, so ist es eine anmaßende
Torheit." Nach F.s feinsinniger Interpretation vollzieht sich „in Penthesilea ...
der unendliche Übergang aus der wesentlich objektiv bestimmten Einheit, der un-
persönlich, selbstverständlichen Bestimmung durch den Staat als objektives Gesetz,
— zum wesentlich subjektiv bestimmten, zur Aufgabe absolut-konkreten Selbst-
seins berufenen Ich". „Michael Kohlhaas" aber stellt dar das „Gefühl des ver-
letzten, in seiner Existenz, seiner ewigen und göttlichen Würde bedrohten Ich".
Es geht hier weder um irdischen Besitz noch um eine abstrakte Idee; Kohlhaas
kämpft seinen Kampf, „weil er über allen zeitlichen Schaden und Gewinn hinaus
in seiner religiösen Existenz als Mensch in Frage gestellt, bedroht und verneint