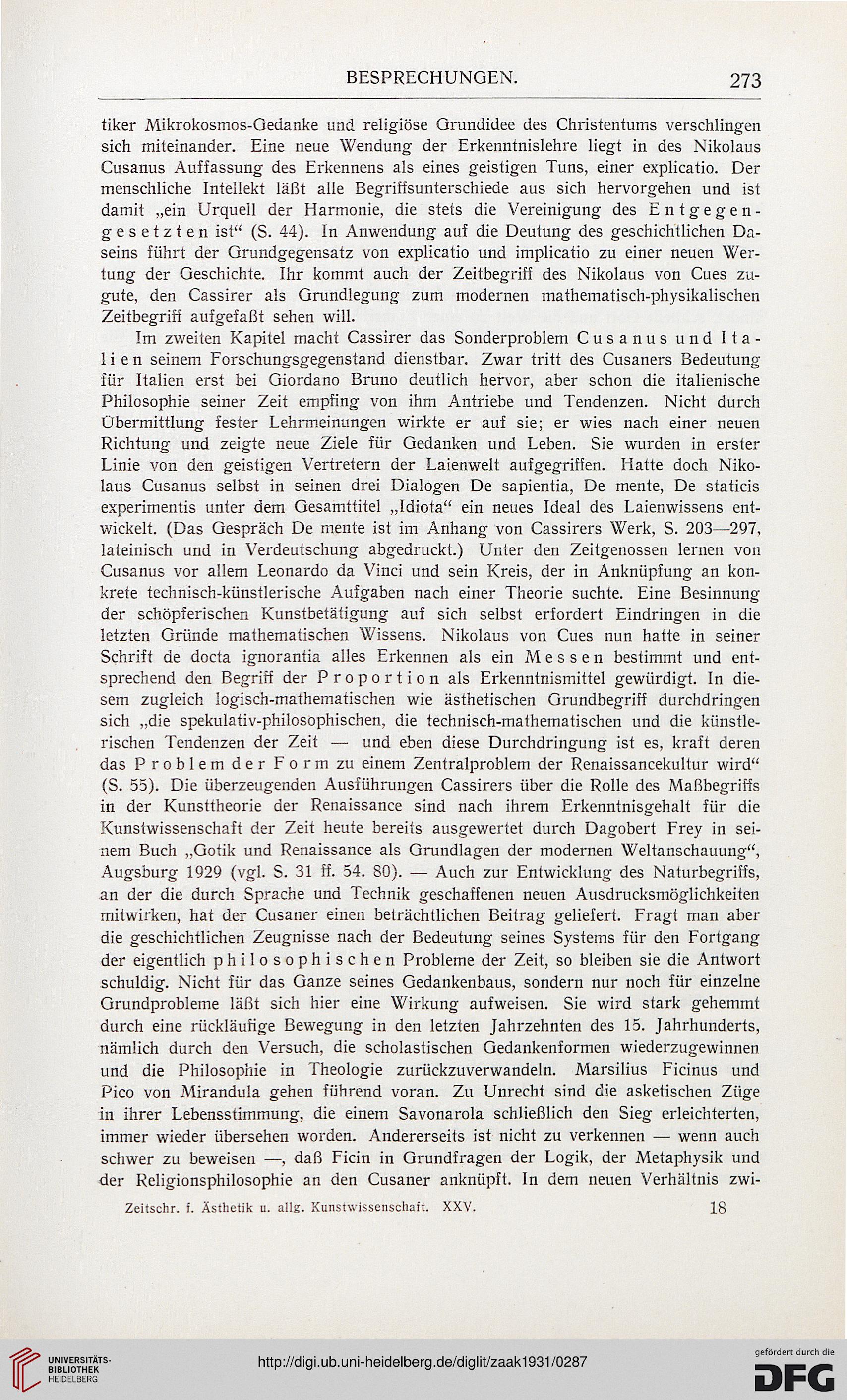BESPRECHUNGEN.
273
tiker Mikrokosmos-Gedanke und religiöse Grundidee des Christentums verschlingen
sich miteinander. Eine neue Wendung der Erkenntnislehre liegt in des Nikolaus
Cusanus Auffassung des Erkennens als eines geistigen Tuns, einer explicatio. Der
menschliche Intellekt läßt alle Begriffsunterschiede aus sich hervorgehen und ist
damit „ein Urquell der Harmonie, die stets die Vereinigung des Entgegen-
gesetzten ist" (S. 44). In Anwendung auf die Deutung des geschichtlichen Da-
seins führt der Grundgegensatz von explicatio und implicatio zu einer neuen Wer-
tung der Geschichte. Ihr kommt auch der Zeitbegriff des Nikolaus von Cues zu-
gute, den Cassirer als Grundlegung zum modernen mathematisch-physikalischen
Zeitbegriff aufgefaßt sehen will.
Im zweiten Kapitel macht Cassirer das Sonderproblem Cusanus und Ita-
lien seinem Forschungsgegenstand dienstbar. Zwar tritt des Cusaners Bedeutung
für Italien erst bei Giordano Bruno deutlich hervor, aber schon die italienische
Philosophie seiner Zeit empfing von ihm Antriebe und Tendenzen. Nicht durch
Übermittlung fester Lehrmeinungen wirkte er auf sie; er wies nach einer neuen
Richtung und zeigte neue Ziele für Gedanken und Leben. Sie wurden in erster
Linie von den geistigen Vertretern der Laienwelt aufgegriffen. Hatte doch Niko-
laus Cusanus selbst in seinen drei Dialogen De sapientia, De mente, De staticis
experimentis unter dem Gesamttitel „Idiota" ein neues Ideal des Laienwissens ent-
wickelt. (Das Gespräch De mente ist im Anhang von Cassirers Werk, S. 203—297,
lateinisch und in Verdeutschung abgedruckt.) Unter den Zeitgenossen lernen von
Cusanus vor allem Leonardo da Vinci und sein Kreis, der in Anknüpfung an kon-
krete technisch-künstlerische Aufgaben nach einer Theorie suchte. Eine Besinnung
der schöpferischen Kunstbetätigung auf sich selbst erfordert Eindringen in die
letzten Gründe mathematischen Wissens. Nikolaus von Cues nun hatte in seiner
Schrift de docta ignorantia alles Erkennen als ein Messe n bestimmt und ent-
sprechend den Begriff der Proportion als Erkenntnismittel gewürdigt. In die-
sem zugleich logisch-mathematischen wie ästhetischen Grundbegriff durchdringen
sich „die spekulativ-philosophischen, die technisch-mathematischen und die künstle-
rischen Tendenzen der Zeit — und eben diese Durchdringung ist es, kraft deren
das Problem der Form zu einem Zentralproblem der Renaissancekultur wird"
(S. 55). Die überzeugenden Ausführungen Cassirers über die Rolle des Maßbegriffs
in der Kunsttheorie der Renaissance sind nach ihrem Erkenntnisgehalt für die
Kunstwissenschaft der Zeit heute bereits ausgewertet durch Dagobert Frey in sei-
nem Buch „Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung",
Augsburg 1929 (vgl. S. 31 ff. 54. 80). — Auch zur Entwicklung des Naturbegriffs,
an der die durch Sprache und Technik geschaffenen neuen Ausdrucksmöglichkeiten
mitwirken, hat der Cusaner einen beträchtlichen Beitrag geliefert. Fragt man aber
die geschichtlichen Zeugnisse nach der Bedeutung seines Systems für den Fortgang
der eigentlich philosophischen Probleme der Zeit, so bleiben sie die Antwort
schuldig. Nicht für das Ganze seines Gedankenbaus, sondern nur noch für einzelne
Grundprobleine läßt sich hier eine Wirkung aufweisen. Sie wird stark gehemmt
durch eine rückläufige Bewegung in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts,
nämlich durch den Versuch, die scholastischen Gedankenformen wiederzugewinnen
und die Philosophie in Theologie zurückzuverwandeln. Marsilius Ficinus und
Pico von Mirandula gehen führend voran. Zu Unrecht sind die asketischen Züge
in ihrer Lebensstimmung, die einem Savonarola schließlich den Sieg erleichterten,
immer wieder übersehen worden. Andererseits ist nicht zu verkennen — wenn auch
schwer zu beweisen —, daß Ficin in Grundfragen der Logik, der Metaphysik und
der Religionsphilosophie an den Cusaner anknüpft. In dem neuen Verhältnis zwi-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXV. 18
273
tiker Mikrokosmos-Gedanke und religiöse Grundidee des Christentums verschlingen
sich miteinander. Eine neue Wendung der Erkenntnislehre liegt in des Nikolaus
Cusanus Auffassung des Erkennens als eines geistigen Tuns, einer explicatio. Der
menschliche Intellekt läßt alle Begriffsunterschiede aus sich hervorgehen und ist
damit „ein Urquell der Harmonie, die stets die Vereinigung des Entgegen-
gesetzten ist" (S. 44). In Anwendung auf die Deutung des geschichtlichen Da-
seins führt der Grundgegensatz von explicatio und implicatio zu einer neuen Wer-
tung der Geschichte. Ihr kommt auch der Zeitbegriff des Nikolaus von Cues zu-
gute, den Cassirer als Grundlegung zum modernen mathematisch-physikalischen
Zeitbegriff aufgefaßt sehen will.
Im zweiten Kapitel macht Cassirer das Sonderproblem Cusanus und Ita-
lien seinem Forschungsgegenstand dienstbar. Zwar tritt des Cusaners Bedeutung
für Italien erst bei Giordano Bruno deutlich hervor, aber schon die italienische
Philosophie seiner Zeit empfing von ihm Antriebe und Tendenzen. Nicht durch
Übermittlung fester Lehrmeinungen wirkte er auf sie; er wies nach einer neuen
Richtung und zeigte neue Ziele für Gedanken und Leben. Sie wurden in erster
Linie von den geistigen Vertretern der Laienwelt aufgegriffen. Hatte doch Niko-
laus Cusanus selbst in seinen drei Dialogen De sapientia, De mente, De staticis
experimentis unter dem Gesamttitel „Idiota" ein neues Ideal des Laienwissens ent-
wickelt. (Das Gespräch De mente ist im Anhang von Cassirers Werk, S. 203—297,
lateinisch und in Verdeutschung abgedruckt.) Unter den Zeitgenossen lernen von
Cusanus vor allem Leonardo da Vinci und sein Kreis, der in Anknüpfung an kon-
krete technisch-künstlerische Aufgaben nach einer Theorie suchte. Eine Besinnung
der schöpferischen Kunstbetätigung auf sich selbst erfordert Eindringen in die
letzten Gründe mathematischen Wissens. Nikolaus von Cues nun hatte in seiner
Schrift de docta ignorantia alles Erkennen als ein Messe n bestimmt und ent-
sprechend den Begriff der Proportion als Erkenntnismittel gewürdigt. In die-
sem zugleich logisch-mathematischen wie ästhetischen Grundbegriff durchdringen
sich „die spekulativ-philosophischen, die technisch-mathematischen und die künstle-
rischen Tendenzen der Zeit — und eben diese Durchdringung ist es, kraft deren
das Problem der Form zu einem Zentralproblem der Renaissancekultur wird"
(S. 55). Die überzeugenden Ausführungen Cassirers über die Rolle des Maßbegriffs
in der Kunsttheorie der Renaissance sind nach ihrem Erkenntnisgehalt für die
Kunstwissenschaft der Zeit heute bereits ausgewertet durch Dagobert Frey in sei-
nem Buch „Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung",
Augsburg 1929 (vgl. S. 31 ff. 54. 80). — Auch zur Entwicklung des Naturbegriffs,
an der die durch Sprache und Technik geschaffenen neuen Ausdrucksmöglichkeiten
mitwirken, hat der Cusaner einen beträchtlichen Beitrag geliefert. Fragt man aber
die geschichtlichen Zeugnisse nach der Bedeutung seines Systems für den Fortgang
der eigentlich philosophischen Probleme der Zeit, so bleiben sie die Antwort
schuldig. Nicht für das Ganze seines Gedankenbaus, sondern nur noch für einzelne
Grundprobleine läßt sich hier eine Wirkung aufweisen. Sie wird stark gehemmt
durch eine rückläufige Bewegung in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts,
nämlich durch den Versuch, die scholastischen Gedankenformen wiederzugewinnen
und die Philosophie in Theologie zurückzuverwandeln. Marsilius Ficinus und
Pico von Mirandula gehen führend voran. Zu Unrecht sind die asketischen Züge
in ihrer Lebensstimmung, die einem Savonarola schließlich den Sieg erleichterten,
immer wieder übersehen worden. Andererseits ist nicht zu verkennen — wenn auch
schwer zu beweisen —, daß Ficin in Grundfragen der Logik, der Metaphysik und
der Religionsphilosophie an den Cusaner anknüpft. In dem neuen Verhältnis zwi-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXV. 18