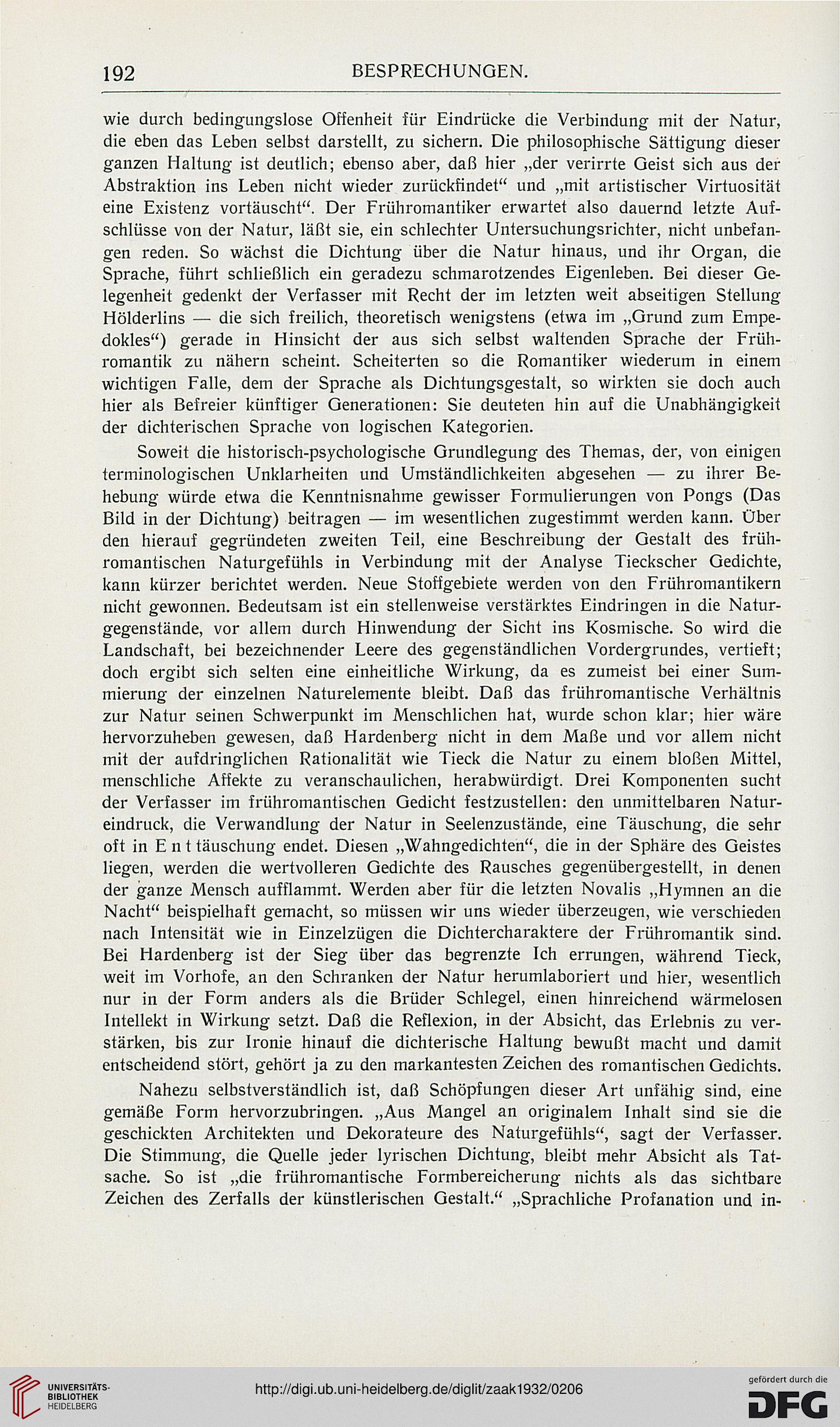192
BESPRECHUNGEN.
wie durch bedingungslose Offenheit für Eindrücke die Verbindung mit der Natur,
die eben das Leben selbst darstellt, zu sichern. Die philosophische Sättigung dieser
ganzen Haltung ist deutlich; ebenso aber, daß hier „der verirrte Geist sich aus der
Abstraktion ins Leben nicht wieder zurückfindet" und „mit artistischer Virtuosität
eine Existenz vortäuscht". Der Frühromantiker erwartet also dauernd letzte Auf-
schlüsse von der Natur, läßt sie, ein schlechter Untersuchungsrichter, nicht unbefan-
gen reden. So wächst die Dichtung über die Natur hinaus, und ihr Organ, die
Sprache, führt schließlich ein geradezu schmarotzendes Eigenleben. Bei dieser Ge-
legenheit gedenkt der Verfasser mit Recht der im letzten weit abseitigen Stellung
Hölderlins — die sich freilich, theoretisch wenigstens (etwa im „Grund zum Empe-
dokles") gerade in Hinsicht der aus sich selbst waltenden Sprache der Früh-
romantik zu nähern scheint. Scheiterten so die Romantiker wiederum in einem
wichtigen Falle, dem der Sprache als Dichtungsgestalt, so wirkten sie doch auch
hier als Befreier künftiger Generationen: Sie deuteten hin auf die Unabhängigkeit
der dichterischen Sprache von logischen Kategorien.
Soweit die historisch-psychologische Grundlegung des Themas, der, von einigen
terminologischen Unklarheiten und Umständlichkeiten abgesehen — zu ihrer Be-
hebung würde etwa die Kenntnisnahme gewisser Formulierungen von Pongs (Das
Bild in der Dichtung) beitragen — im wesentlichen zugestimmt werden kann. Über
den hierauf gegründeten zweiten Teil, eine Beschreibung der Gestalt des früh-
romantischen Naturgefühls in Verbindung mit der Analyse Tieckscher Gedichte,
kann kürzer berichtet werden. Neue Stoffgebiete werden von den Frühromantikern
nicht gewonnen. Bedeutsam ist ein stellenweise verstärktes Eindringen in die Natur-
gegenstände, vor allem durch Hinwendung der Sicht ins Kosmische. So wird die
Landschaft, bei bezeichnender Leere des gegenständlichen Vordergrundes, vertieft;
doch ergibt sich selten eine einheitliche Wirkung, da es zumeist bei einer Sum-
mierung der einzelnen Naturelemente bleibt. Daß das frühromantische Verhältnis
zur Natur seinen Schwerpunkt im Menschlichen hat, wurde schon klar; hier wäre
hervorzuheben gewesen, daß Hardenberg nicht in dem Maße und vor allem nicht
mit der aufdringlichen Rationalität wie Tieck die Natur zu einem bloßen Mittel,
menschliche Affekte zu veranschaulichen, herabwürdigt. Drei Komponenten sucht
der Verfasser im frühromantischen Gedicht festzustellen: den unmittelbaren Natur-
eindruck, die Verwandlung der Natur in Seelenzustände, eine Täuschung, die sehr
oft in E n t täuschung endet. Diesen „Wahngedichten", die in der Sphäre des Geistes
liegen, werden die wertvolleren Gedichte des Rausches gegenübergestellt, in denen
der ganze Mensch aufflammt. Werden aber für die letzten Novalis „Hymnen an die
Nacht" beispielhaft gemacht, so müssen wir uns wieder überzeugen, wie verschieden
nach Intensität wie in Einzelzügen die Dichtercharaktere der Frühromantik sind.
Bei Hardenberg ist der Sieg über das begrenzte Ich errungen, während Tieck,
weit im Vorhofe, an den Schranken der Natur herumlaboriert und hier, wesentlich
nur in der Form anders als die Brüder Schlegel, einen hinreichend wärmelosen
Intellekt in Wirkung setzt. Daß die Reflexion, in der Absicht, das Erlebnis zu ver-
stärken, bis zur Ironie hinauf die dichterische Haltung bewußt macht und damit
entscheidend stört, gehört ja zu den markantesten Zeichen des romantischen Gedichts.
Nahezu selbstverständlich ist, daß Schöpfungen dieser Art unfähig sind, eine
gemäße Form hervorzubringen. „Aus Mangel an originalem Inhalt sind sie die
geschickten Architekten und Dekorateure des Naturgefühls", sagt der Verfasser.
Die Stimmung, die Quelle jeder lyrischen Dichtung, bleibt mehr Absicht als Tat-
sache. So ist „die frühromantische Formbereicherung nichts als das sichtbare
Zeichen des Zerfalls der künstlerischen Gestalt." „Sprachliche Profanation und in-
BESPRECHUNGEN.
wie durch bedingungslose Offenheit für Eindrücke die Verbindung mit der Natur,
die eben das Leben selbst darstellt, zu sichern. Die philosophische Sättigung dieser
ganzen Haltung ist deutlich; ebenso aber, daß hier „der verirrte Geist sich aus der
Abstraktion ins Leben nicht wieder zurückfindet" und „mit artistischer Virtuosität
eine Existenz vortäuscht". Der Frühromantiker erwartet also dauernd letzte Auf-
schlüsse von der Natur, läßt sie, ein schlechter Untersuchungsrichter, nicht unbefan-
gen reden. So wächst die Dichtung über die Natur hinaus, und ihr Organ, die
Sprache, führt schließlich ein geradezu schmarotzendes Eigenleben. Bei dieser Ge-
legenheit gedenkt der Verfasser mit Recht der im letzten weit abseitigen Stellung
Hölderlins — die sich freilich, theoretisch wenigstens (etwa im „Grund zum Empe-
dokles") gerade in Hinsicht der aus sich selbst waltenden Sprache der Früh-
romantik zu nähern scheint. Scheiterten so die Romantiker wiederum in einem
wichtigen Falle, dem der Sprache als Dichtungsgestalt, so wirkten sie doch auch
hier als Befreier künftiger Generationen: Sie deuteten hin auf die Unabhängigkeit
der dichterischen Sprache von logischen Kategorien.
Soweit die historisch-psychologische Grundlegung des Themas, der, von einigen
terminologischen Unklarheiten und Umständlichkeiten abgesehen — zu ihrer Be-
hebung würde etwa die Kenntnisnahme gewisser Formulierungen von Pongs (Das
Bild in der Dichtung) beitragen — im wesentlichen zugestimmt werden kann. Über
den hierauf gegründeten zweiten Teil, eine Beschreibung der Gestalt des früh-
romantischen Naturgefühls in Verbindung mit der Analyse Tieckscher Gedichte,
kann kürzer berichtet werden. Neue Stoffgebiete werden von den Frühromantikern
nicht gewonnen. Bedeutsam ist ein stellenweise verstärktes Eindringen in die Natur-
gegenstände, vor allem durch Hinwendung der Sicht ins Kosmische. So wird die
Landschaft, bei bezeichnender Leere des gegenständlichen Vordergrundes, vertieft;
doch ergibt sich selten eine einheitliche Wirkung, da es zumeist bei einer Sum-
mierung der einzelnen Naturelemente bleibt. Daß das frühromantische Verhältnis
zur Natur seinen Schwerpunkt im Menschlichen hat, wurde schon klar; hier wäre
hervorzuheben gewesen, daß Hardenberg nicht in dem Maße und vor allem nicht
mit der aufdringlichen Rationalität wie Tieck die Natur zu einem bloßen Mittel,
menschliche Affekte zu veranschaulichen, herabwürdigt. Drei Komponenten sucht
der Verfasser im frühromantischen Gedicht festzustellen: den unmittelbaren Natur-
eindruck, die Verwandlung der Natur in Seelenzustände, eine Täuschung, die sehr
oft in E n t täuschung endet. Diesen „Wahngedichten", die in der Sphäre des Geistes
liegen, werden die wertvolleren Gedichte des Rausches gegenübergestellt, in denen
der ganze Mensch aufflammt. Werden aber für die letzten Novalis „Hymnen an die
Nacht" beispielhaft gemacht, so müssen wir uns wieder überzeugen, wie verschieden
nach Intensität wie in Einzelzügen die Dichtercharaktere der Frühromantik sind.
Bei Hardenberg ist der Sieg über das begrenzte Ich errungen, während Tieck,
weit im Vorhofe, an den Schranken der Natur herumlaboriert und hier, wesentlich
nur in der Form anders als die Brüder Schlegel, einen hinreichend wärmelosen
Intellekt in Wirkung setzt. Daß die Reflexion, in der Absicht, das Erlebnis zu ver-
stärken, bis zur Ironie hinauf die dichterische Haltung bewußt macht und damit
entscheidend stört, gehört ja zu den markantesten Zeichen des romantischen Gedichts.
Nahezu selbstverständlich ist, daß Schöpfungen dieser Art unfähig sind, eine
gemäße Form hervorzubringen. „Aus Mangel an originalem Inhalt sind sie die
geschickten Architekten und Dekorateure des Naturgefühls", sagt der Verfasser.
Die Stimmung, die Quelle jeder lyrischen Dichtung, bleibt mehr Absicht als Tat-
sache. So ist „die frühromantische Formbereicherung nichts als das sichtbare
Zeichen des Zerfalls der künstlerischen Gestalt." „Sprachliche Profanation und in-