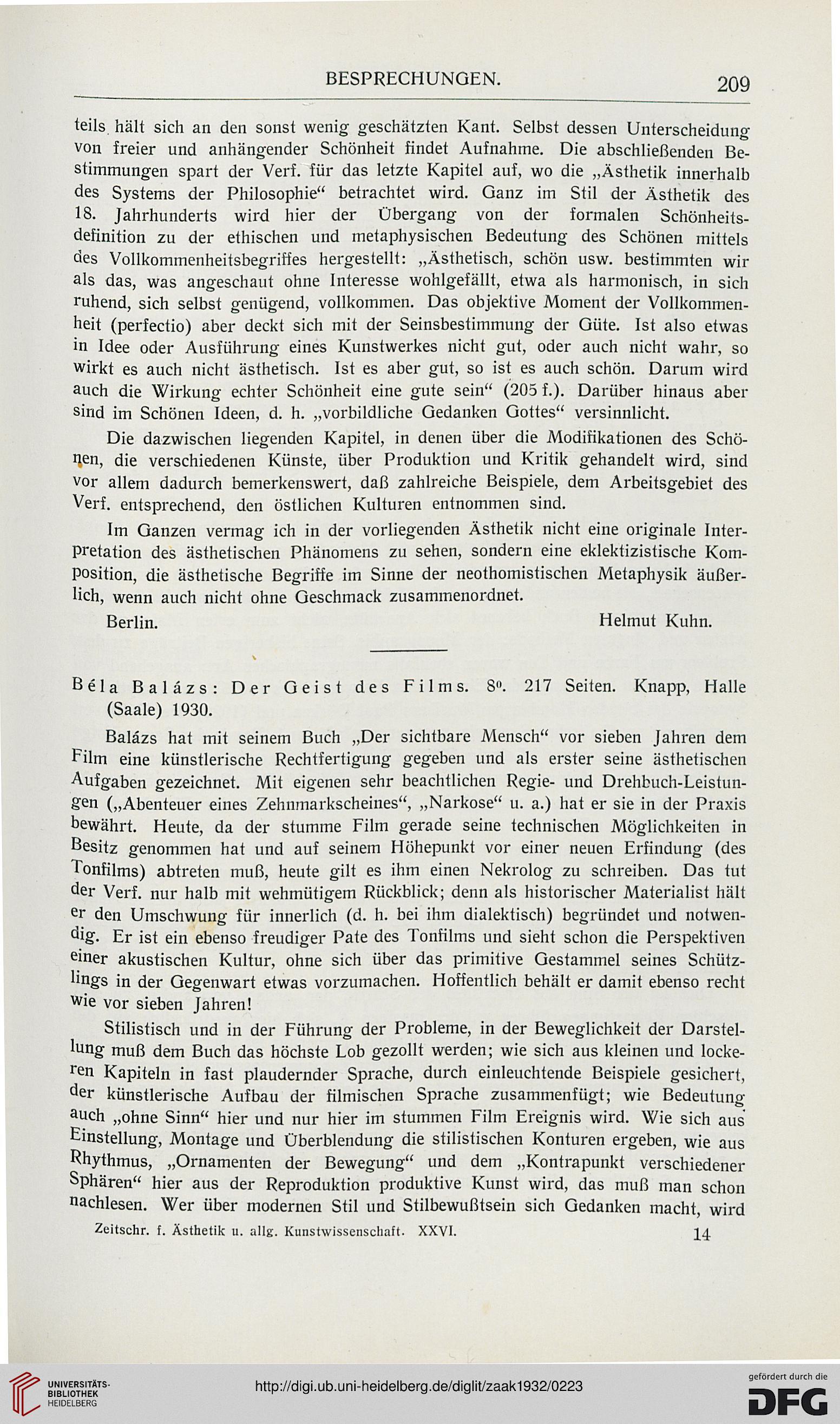BESPRECHUNGEN.
209
teils hält sich an den sonst wenig geschätzten Kant. Selbst dessen Unterscheidung
von freier und anhängender Schönheit findet Aufnahme. Die abschließenden Be-
stimmungen spart der Verf. für das letzte Kapitel auf, wo die „Ästhetik innerhalb
des Systems der Philosophie" betrachtet wird. Ganz im Stil der Ästhetik des
18. Jahrhunderts wird hier der Übergang von der formalen Schönheits-
definition zu der ethischen und metaphysischen Bedeutung des Schönen mittels
des Vollkommenheitsbegriffes hergestellt: „Ästhetisch, schön usw. bestimmten wir
als das, was angeschaut ohne Interesse wohlgefällt, etwa als harmonisch, in sich
ruhend, sich selbst genügend, vollkommen. Das objektive Moment der Vollkommen-
heit (perfectio) aber deckt sich mit der Seinsbestimmung der Güte. Ist also etwas
in Idee oder Ausführung eines Kunstwerkes nicht gut, oder auch nicht wahr, so
wirkt es auch nicht ästhetisch. Ist es aber gut, so ist es auch schön. Darum wird
auch die Wirkung echter Schönheit eine gute sein" (205 f.). Darüber hinaus aber
sind im Schönen Ideen, d. h. „vorbildliche Gedanken Gottes" versinnlicht.
Die dazwischen liegenden Kapitel, in denen über die Modifikationen des Scho-
len, die verschiedenen Künste, über Produktion und Kritik gehandelt wird, sind
vor allem dadurch bemerkenswert, daß zahlreiche Beispiele, dem Arbeitsgebiet des
Verf. entsprechend, den östlichen Kulturen entnommen sind.
Im Ganzen vermag ich in der vorliegenden Ästhetik nicht eine originale Inter-
pretation des ästhetischen Phänomens zu sehen, sondern eine eklektizistische Korn-
Position, die ästhetische Begriffe im Sinne der neothomistischen Metaphysik äußer-
lich, wenn auch nicht ohne Geschmack zusammenordnet.
Berlin. Helmut Kuhn.
Bela Baläzs: Der Geist des Films. 8». 217 Seiten. Knapp, Halle
(Saale) 1930.
Baläzs hat mit seinem Buch „Der sichtbare Mensch" vor sieben Jahren dem
Film eine künstlerische Rechtfertigung gegeben und als erster seine ästhetischen
Aufgaben gezeichnet. Mit eigenen sehr beachtlichen Regie- und Drehbuch-Leistun-
gen („Abenteuer eines Zehnmarkscheines", „Narkose" u. a.) hat er sie in der Praxis
bewährt. Heute, da der stumme Film gerade seine technischen Möglichkeiten in
Besitz genommen hat und auf seinem Höhepunkt vor einer neuen Erfindung (des
Tonfilms) abtreten muß, heute gilt es ihm einen Nekrolog zu schreiben. Das tut
der Verf. nur halb mit wehmütigem Rückblick; denn als historischer Materialist hält
er den Umschwung für innerlich (d. h. bei ihm dialektisch) begründet und notwen-
dig. Er ist ein ebenso freudiger Pate des Tonfilms und sieht schon die Perspektiven
einer akustischen Kultur, ohne sich über das primitive Gestammel seines Schütz-
lings in der Gegenwart etwas vorzumachen. Hoffentlich behält er damit ebenso recht
wie vor sieben Jahren!
Stilistisch und in der Führung der Probleme, in der Beweglichkeit der Darstel-
lung muß dem Buch das höchste Lob gezollt werden; wie sich aus kleinen und locke-
ren Kapiteln in fast plaudernder Sprache, durch einleuchtende Beispiele gesichert,
der künstlerische Aufbau der filmischen Sprache zusammenfügt; wie Bedeutung
auch „ohne Sinn" hier und nur hier im stummen Film Ereignis wird. Wie sich aus
Einstellung, Montage und Überblendung die stilistischen Konturen ergeben, wie aus
Rhythmus, „Ornamenten der Bewegung" und dem „Kontrapunkt verschiedener
Sphären" hier aus der Reproduktion produktive Kunst wird, das muß man schon
nachlesen. Wer über modernen Stil und Stilbewußtsein sich Gedanken macht, wird
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVI. 14
209
teils hält sich an den sonst wenig geschätzten Kant. Selbst dessen Unterscheidung
von freier und anhängender Schönheit findet Aufnahme. Die abschließenden Be-
stimmungen spart der Verf. für das letzte Kapitel auf, wo die „Ästhetik innerhalb
des Systems der Philosophie" betrachtet wird. Ganz im Stil der Ästhetik des
18. Jahrhunderts wird hier der Übergang von der formalen Schönheits-
definition zu der ethischen und metaphysischen Bedeutung des Schönen mittels
des Vollkommenheitsbegriffes hergestellt: „Ästhetisch, schön usw. bestimmten wir
als das, was angeschaut ohne Interesse wohlgefällt, etwa als harmonisch, in sich
ruhend, sich selbst genügend, vollkommen. Das objektive Moment der Vollkommen-
heit (perfectio) aber deckt sich mit der Seinsbestimmung der Güte. Ist also etwas
in Idee oder Ausführung eines Kunstwerkes nicht gut, oder auch nicht wahr, so
wirkt es auch nicht ästhetisch. Ist es aber gut, so ist es auch schön. Darum wird
auch die Wirkung echter Schönheit eine gute sein" (205 f.). Darüber hinaus aber
sind im Schönen Ideen, d. h. „vorbildliche Gedanken Gottes" versinnlicht.
Die dazwischen liegenden Kapitel, in denen über die Modifikationen des Scho-
len, die verschiedenen Künste, über Produktion und Kritik gehandelt wird, sind
vor allem dadurch bemerkenswert, daß zahlreiche Beispiele, dem Arbeitsgebiet des
Verf. entsprechend, den östlichen Kulturen entnommen sind.
Im Ganzen vermag ich in der vorliegenden Ästhetik nicht eine originale Inter-
pretation des ästhetischen Phänomens zu sehen, sondern eine eklektizistische Korn-
Position, die ästhetische Begriffe im Sinne der neothomistischen Metaphysik äußer-
lich, wenn auch nicht ohne Geschmack zusammenordnet.
Berlin. Helmut Kuhn.
Bela Baläzs: Der Geist des Films. 8». 217 Seiten. Knapp, Halle
(Saale) 1930.
Baläzs hat mit seinem Buch „Der sichtbare Mensch" vor sieben Jahren dem
Film eine künstlerische Rechtfertigung gegeben und als erster seine ästhetischen
Aufgaben gezeichnet. Mit eigenen sehr beachtlichen Regie- und Drehbuch-Leistun-
gen („Abenteuer eines Zehnmarkscheines", „Narkose" u. a.) hat er sie in der Praxis
bewährt. Heute, da der stumme Film gerade seine technischen Möglichkeiten in
Besitz genommen hat und auf seinem Höhepunkt vor einer neuen Erfindung (des
Tonfilms) abtreten muß, heute gilt es ihm einen Nekrolog zu schreiben. Das tut
der Verf. nur halb mit wehmütigem Rückblick; denn als historischer Materialist hält
er den Umschwung für innerlich (d. h. bei ihm dialektisch) begründet und notwen-
dig. Er ist ein ebenso freudiger Pate des Tonfilms und sieht schon die Perspektiven
einer akustischen Kultur, ohne sich über das primitive Gestammel seines Schütz-
lings in der Gegenwart etwas vorzumachen. Hoffentlich behält er damit ebenso recht
wie vor sieben Jahren!
Stilistisch und in der Führung der Probleme, in der Beweglichkeit der Darstel-
lung muß dem Buch das höchste Lob gezollt werden; wie sich aus kleinen und locke-
ren Kapiteln in fast plaudernder Sprache, durch einleuchtende Beispiele gesichert,
der künstlerische Aufbau der filmischen Sprache zusammenfügt; wie Bedeutung
auch „ohne Sinn" hier und nur hier im stummen Film Ereignis wird. Wie sich aus
Einstellung, Montage und Überblendung die stilistischen Konturen ergeben, wie aus
Rhythmus, „Ornamenten der Bewegung" und dem „Kontrapunkt verschiedener
Sphären" hier aus der Reproduktion produktive Kunst wird, das muß man schon
nachlesen. Wer über modernen Stil und Stilbewußtsein sich Gedanken macht, wird
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVI. 14