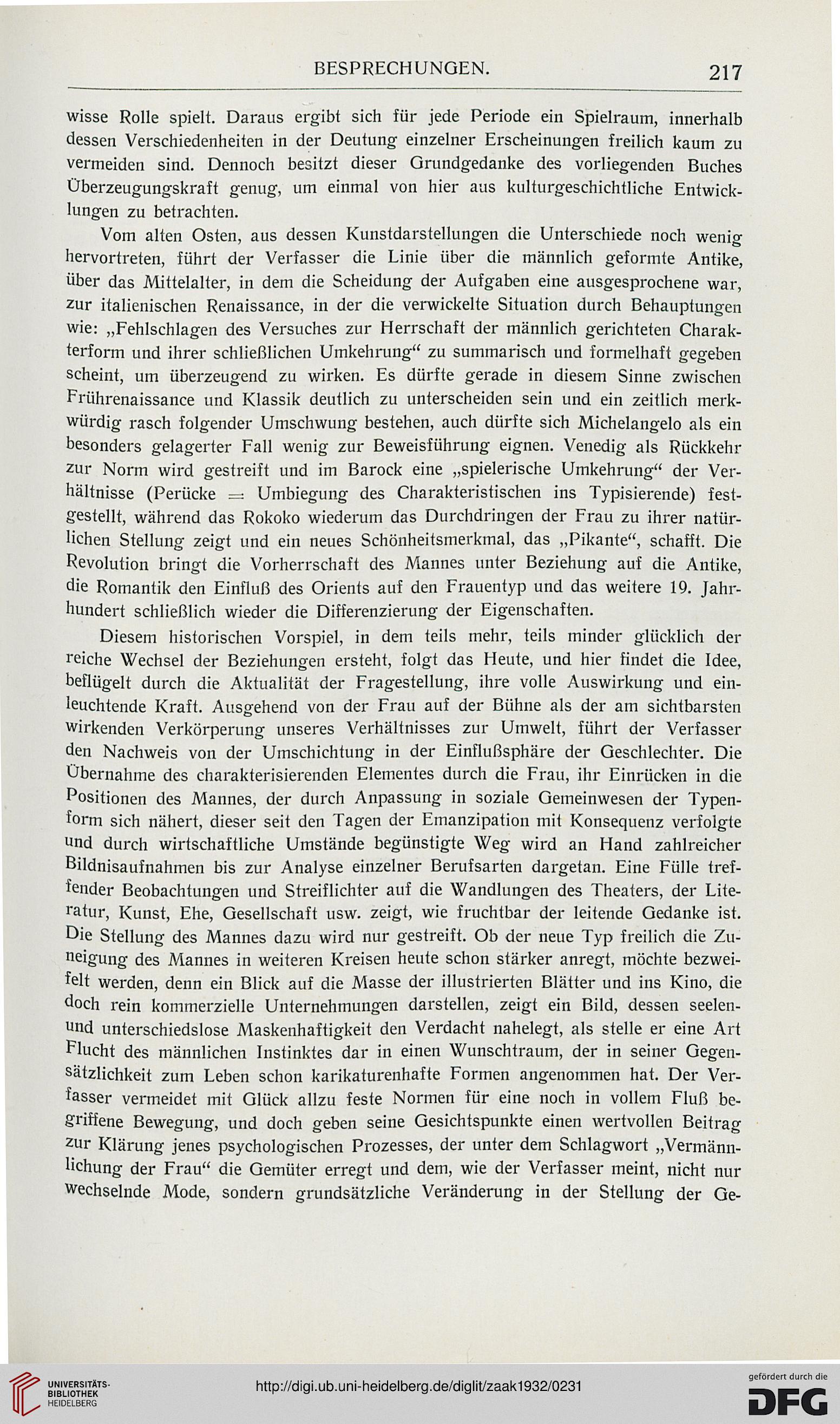BESPRECHUNGEN.
217
wisse Rolle spielt. Daraus ergibt sich für jede Periode ein Spielraum, innerhalb
dessen Verschiedenheiten in der Deutung- einzelner Erscheinungen freilich kaum zu
vermeiden sind. Dennoch besitzt dieser Grundgedanke des vorliegenden Buches
Überzeugungskraft genug, um einmal von hier aus kulturgeschichtliche Entwick-
lungen zu betrachten.
Vom alten Osten, aus dessen Kunstdarstellungen die Unterschiede noch wenig
hervortreten, führt der Verfasser die Linie über die männlich geformte Antike,
über das Mittelalter, in dem die Scheidung der Aufgaben eine ausgesprochene war,
zur italienischen Renaissance, in der die verwickelte Situation durch Behauptungen
wie: „Fehlschlagen des Versuches zur Herrschaft der männlich gerichteten Charak-
terform und ihrer schließlichen Umkehrung" zu summarisch und formelhaft gegeben
scheint, um überzeugend zu wirken. Es dürfte gerade in diesem Sinne zwischen
Frührenaissance und Klassik deutlich zu unterscheiden sein und ein zeitlich merk-
würdig rasch folgender Umschwung bestehen, auch dürfte sich Michelangelo als ein
besonders gelagerter Fall wenig zur Beweisführung eignen. Venedig als Rückkehr
zur Norm wird gestreift und im Barock eine „spielerische Umkehrung" der Ver-
hältnisse (Perücke = Umbiegung des Charakteristischen ins Typisierende) fest-
gestellt, während das Rokoko wiederum das Durchdringen der Frau zu ihrer natür-
lichen Stellung zeigt und ein neues Schönheitsmerkmal, das „Pikante", schafft. Die
Revolution bringt die Vorherrschaft des Mannes unter Beziehung auf die Antike,
die Romantik den Einfluß des Orients auf den Frauentyp und das weitere 19. Jahr-
hundert schließlich wieder die Differenzierung der Eigenschaften.
Diesem historischen Vorspiel, in dem teils mehr, teils minder glücklich der
reiche Wechsel der Beziehungen ersteht, folgt das Heute, und hier findet die Idee,
beflügelt durch die Aktualität der Fragestellung, ihre volle Auswirkung und ein-
leuchtende Kraft. Ausgehend von der Frau auf der Bühne als der am sichtbarsten
wirkenden Verkörperung unseres Verhältnisses zur Umwelt, führt der Verfasser
den Nachweis von der Umschichtung in der Einflußsphäre der Geschlechter. Die
Übernahme des charakterisierenden Elementes durch die Frau, ihr Einrücken in die
Positionen des Mannes, der durch Anpassung in soziale Gemeinwesen der Typen-
form sich nähert, dieser seit den Tagen der Emanzipation mit Konsequenz verfolgte
und durch wirtschaftliche Umstände begünstigte Weg wird an Hand zahlreicher
Bildnisaufnahmen bis zur Analyse einzelner Berufsarten dargetan. Eine Fülle tref-
fender Beobachtungen und Streiflichter auf die Wandlungen des Theaters, der Lite-
ratur, Kunst, Ehe, Gesellschaft usw. zeigt, wie fruchtbar der leitende Gedanke ist.
Die Stellung des Mannes dazu wird nur gestreift. Ob der neue Typ freilich die Zu-
neigung des Mannes in weiteren Kreisen heute schon stärker anregt, möchte bezwei-
felt werden, denn ein Blick auf die Masse der illustrierten Blätter und ins Kino, die
doch rein kommerzielle Unternehmungen darstellen, zeigt ein Bild, dessen seelen-
und unterschiedslose Maskenhaftigkeit den Verdacht nahelegt, als stelle er eine Art
Flucht des männlichen Instinktes dar in einen Wunschtraum, der in seiner Gegen-
sätzlichkeit zum Leben schon karikaturenhafte Formen angenommen hat. Der Ver-
fasser vermeidet mit Glück allzu feste Normen für eine noch in vollem Fluß be-
griffene Bewegung, und doch geben seine Gesichtspunkte einen wertvollen Beitrag
zur Klärung jenes psychologischen Prozesses, der unter dem Schlagwort „Vermänn-
üchung der Frau" die Gemüter erregt und dem, wie der Verfasser meint, nicht nur
wechselnde Mode, sondern grundsätzliche Veränderung in der Stellung der Ge-
217
wisse Rolle spielt. Daraus ergibt sich für jede Periode ein Spielraum, innerhalb
dessen Verschiedenheiten in der Deutung- einzelner Erscheinungen freilich kaum zu
vermeiden sind. Dennoch besitzt dieser Grundgedanke des vorliegenden Buches
Überzeugungskraft genug, um einmal von hier aus kulturgeschichtliche Entwick-
lungen zu betrachten.
Vom alten Osten, aus dessen Kunstdarstellungen die Unterschiede noch wenig
hervortreten, führt der Verfasser die Linie über die männlich geformte Antike,
über das Mittelalter, in dem die Scheidung der Aufgaben eine ausgesprochene war,
zur italienischen Renaissance, in der die verwickelte Situation durch Behauptungen
wie: „Fehlschlagen des Versuches zur Herrschaft der männlich gerichteten Charak-
terform und ihrer schließlichen Umkehrung" zu summarisch und formelhaft gegeben
scheint, um überzeugend zu wirken. Es dürfte gerade in diesem Sinne zwischen
Frührenaissance und Klassik deutlich zu unterscheiden sein und ein zeitlich merk-
würdig rasch folgender Umschwung bestehen, auch dürfte sich Michelangelo als ein
besonders gelagerter Fall wenig zur Beweisführung eignen. Venedig als Rückkehr
zur Norm wird gestreift und im Barock eine „spielerische Umkehrung" der Ver-
hältnisse (Perücke = Umbiegung des Charakteristischen ins Typisierende) fest-
gestellt, während das Rokoko wiederum das Durchdringen der Frau zu ihrer natür-
lichen Stellung zeigt und ein neues Schönheitsmerkmal, das „Pikante", schafft. Die
Revolution bringt die Vorherrschaft des Mannes unter Beziehung auf die Antike,
die Romantik den Einfluß des Orients auf den Frauentyp und das weitere 19. Jahr-
hundert schließlich wieder die Differenzierung der Eigenschaften.
Diesem historischen Vorspiel, in dem teils mehr, teils minder glücklich der
reiche Wechsel der Beziehungen ersteht, folgt das Heute, und hier findet die Idee,
beflügelt durch die Aktualität der Fragestellung, ihre volle Auswirkung und ein-
leuchtende Kraft. Ausgehend von der Frau auf der Bühne als der am sichtbarsten
wirkenden Verkörperung unseres Verhältnisses zur Umwelt, führt der Verfasser
den Nachweis von der Umschichtung in der Einflußsphäre der Geschlechter. Die
Übernahme des charakterisierenden Elementes durch die Frau, ihr Einrücken in die
Positionen des Mannes, der durch Anpassung in soziale Gemeinwesen der Typen-
form sich nähert, dieser seit den Tagen der Emanzipation mit Konsequenz verfolgte
und durch wirtschaftliche Umstände begünstigte Weg wird an Hand zahlreicher
Bildnisaufnahmen bis zur Analyse einzelner Berufsarten dargetan. Eine Fülle tref-
fender Beobachtungen und Streiflichter auf die Wandlungen des Theaters, der Lite-
ratur, Kunst, Ehe, Gesellschaft usw. zeigt, wie fruchtbar der leitende Gedanke ist.
Die Stellung des Mannes dazu wird nur gestreift. Ob der neue Typ freilich die Zu-
neigung des Mannes in weiteren Kreisen heute schon stärker anregt, möchte bezwei-
felt werden, denn ein Blick auf die Masse der illustrierten Blätter und ins Kino, die
doch rein kommerzielle Unternehmungen darstellen, zeigt ein Bild, dessen seelen-
und unterschiedslose Maskenhaftigkeit den Verdacht nahelegt, als stelle er eine Art
Flucht des männlichen Instinktes dar in einen Wunschtraum, der in seiner Gegen-
sätzlichkeit zum Leben schon karikaturenhafte Formen angenommen hat. Der Ver-
fasser vermeidet mit Glück allzu feste Normen für eine noch in vollem Fluß be-
griffene Bewegung, und doch geben seine Gesichtspunkte einen wertvollen Beitrag
zur Klärung jenes psychologischen Prozesses, der unter dem Schlagwort „Vermänn-
üchung der Frau" die Gemüter erregt und dem, wie der Verfasser meint, nicht nur
wechselnde Mode, sondern grundsätzliche Veränderung in der Stellung der Ge-