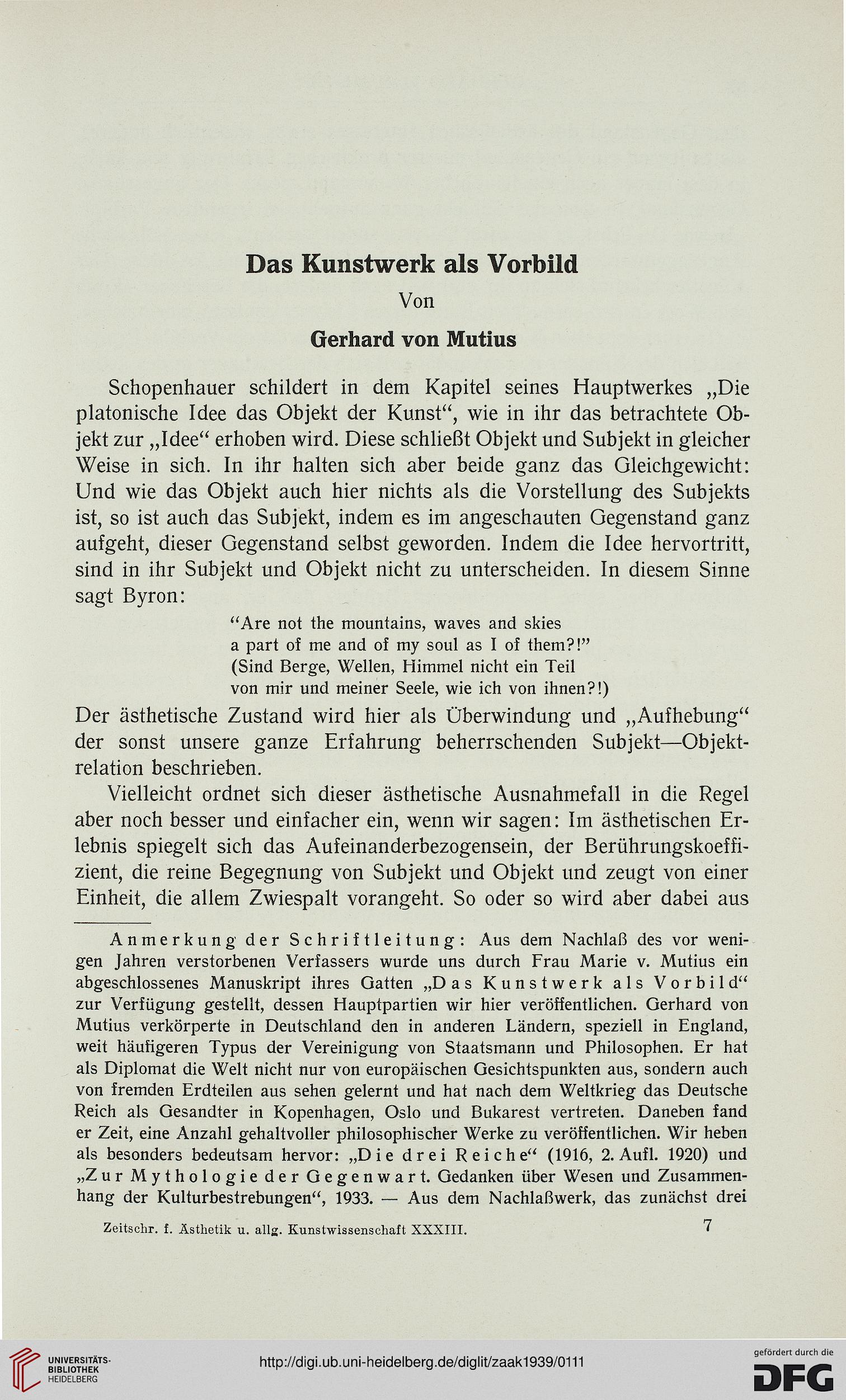Das Kunstwerk als Vorbild
Von
Gerhard von Mutius
Schopenhauer schildert in dem Kapitel seines Hauptwerkes „Die
platonische Idee das Objekt der Kunst", wie in ihr das betrachtete Ob-
jekt zur „Idee" erhoben wird. Diese schließt Objekt und Subjekt in gleicher
Weise in sich. In ihr halten sich aber beide ganz das Gleichgewicht:
Und wie das Objekt auch hier nichts als die Vorstellung des Subjekts
ist, so ist auch das Subjekt, indem es im angeschauten Gegenstand ganz
aufgeht, dieser Gegenstand selbst geworden. Indem die Idee hervortritt,
sind in ihr Subjekt und Objekt nicht zu unterscheiden. In diesem Sinne
sagt Byron:
"Are not the mountains, waves and skies
a part of me and of my soul as I of them?!"
(Sind Berge, Wellen, Himmel nicht ein Teil
von mir und meiner Seele, wie ich von ihnen?!)
Der ästhetische Zustand wird hier als Überwindung und „Aufhebung"
der sonst unsere ganze Erfahrung beherrschenden Subjekt—Objekt-
relation beschrieben.
Vielleicht ordnet sich dieser ästhetische Ausnahmefall in die Regel
aber noch besser und einfacher ein, wenn wir sagen: Im ästhetischen Er-
lebnis spiegelt sich das Aufeinanderbezogensein, der Berührungskoeffi-
zient, die reine Begegnung von Subjekt und Objekt und zeugt von einer
Einheit, die allem Zwiespalt vorangeht. So oder so wird aber dabei aus
Anmerkung' der Schriftleitung: Aus dem Nachlaß des vor weni-
gen Jahren verstorbenen Verfassers wurde uns durch Frau Marie v. Mutius ein
abgeschlossenes Manuskript ihres Gatten „Das Kunstwerk als Vorbild"
zur Verfügung gestellt, dessen Hauptpartien wir hier veröffentlichen. Gerhard von
Mutius verkörperte in Deutschland den in anderen Ländern, speziell in England,
weit häufigeren Typus der Vereinigung von Staatsmann und Philosophen. Er hat
als Diplomat die Welt nicht nur von europäischen Gesichtspunkten aus, sondern auch
von fremden Erdteilen aus sehen gelernt und hat nach dem Weltkrieg das Deutsche
Reich als Gesandter in Kopenhagen, Oslo und Bukarest vertreten. Daneben fand
er Zeit, eine Anzahl gehaltvoller philosophischer Werke zu veröffentlichen. Wir heben
als besonders bedeutsam hervor: „Die drei Reiche" (1916, 2. Auf1. 1920) und
„Zur Mythologie der Gegenwart. Gedanken über Wesen und Zusammen-
hang der Kulturbestrebungen", 1933. — Aus dem Nachlaßwerk, das zunächst drei
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 7
Von
Gerhard von Mutius
Schopenhauer schildert in dem Kapitel seines Hauptwerkes „Die
platonische Idee das Objekt der Kunst", wie in ihr das betrachtete Ob-
jekt zur „Idee" erhoben wird. Diese schließt Objekt und Subjekt in gleicher
Weise in sich. In ihr halten sich aber beide ganz das Gleichgewicht:
Und wie das Objekt auch hier nichts als die Vorstellung des Subjekts
ist, so ist auch das Subjekt, indem es im angeschauten Gegenstand ganz
aufgeht, dieser Gegenstand selbst geworden. Indem die Idee hervortritt,
sind in ihr Subjekt und Objekt nicht zu unterscheiden. In diesem Sinne
sagt Byron:
"Are not the mountains, waves and skies
a part of me and of my soul as I of them?!"
(Sind Berge, Wellen, Himmel nicht ein Teil
von mir und meiner Seele, wie ich von ihnen?!)
Der ästhetische Zustand wird hier als Überwindung und „Aufhebung"
der sonst unsere ganze Erfahrung beherrschenden Subjekt—Objekt-
relation beschrieben.
Vielleicht ordnet sich dieser ästhetische Ausnahmefall in die Regel
aber noch besser und einfacher ein, wenn wir sagen: Im ästhetischen Er-
lebnis spiegelt sich das Aufeinanderbezogensein, der Berührungskoeffi-
zient, die reine Begegnung von Subjekt und Objekt und zeugt von einer
Einheit, die allem Zwiespalt vorangeht. So oder so wird aber dabei aus
Anmerkung' der Schriftleitung: Aus dem Nachlaß des vor weni-
gen Jahren verstorbenen Verfassers wurde uns durch Frau Marie v. Mutius ein
abgeschlossenes Manuskript ihres Gatten „Das Kunstwerk als Vorbild"
zur Verfügung gestellt, dessen Hauptpartien wir hier veröffentlichen. Gerhard von
Mutius verkörperte in Deutschland den in anderen Ländern, speziell in England,
weit häufigeren Typus der Vereinigung von Staatsmann und Philosophen. Er hat
als Diplomat die Welt nicht nur von europäischen Gesichtspunkten aus, sondern auch
von fremden Erdteilen aus sehen gelernt und hat nach dem Weltkrieg das Deutsche
Reich als Gesandter in Kopenhagen, Oslo und Bukarest vertreten. Daneben fand
er Zeit, eine Anzahl gehaltvoller philosophischer Werke zu veröffentlichen. Wir heben
als besonders bedeutsam hervor: „Die drei Reiche" (1916, 2. Auf1. 1920) und
„Zur Mythologie der Gegenwart. Gedanken über Wesen und Zusammen-
hang der Kulturbestrebungen", 1933. — Aus dem Nachlaßwerk, das zunächst drei
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 7