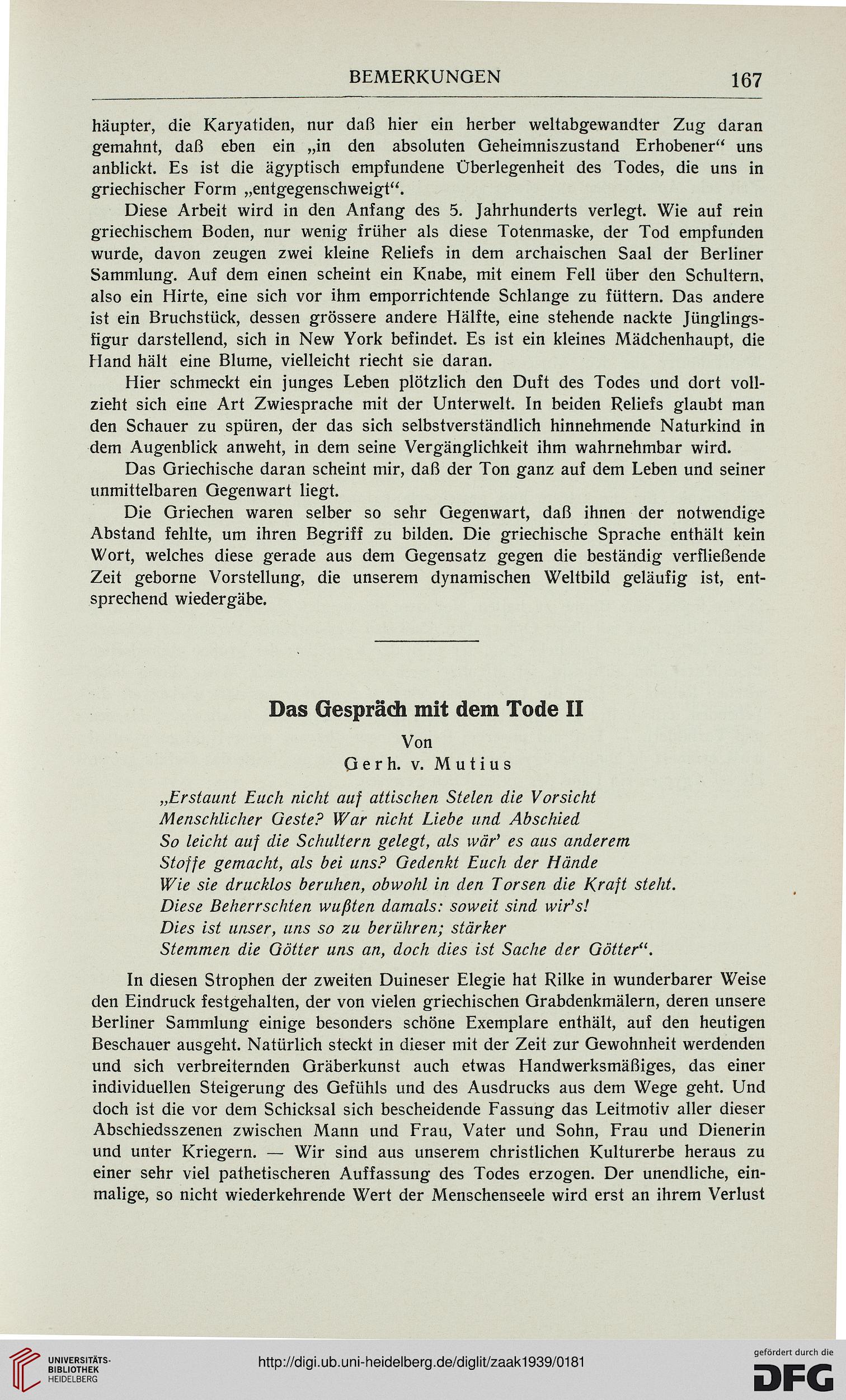BEMERKUNGEN
167
häupter, die Karyatiden, nur daß hier ein herber weitabgewandter Zug daran
gemahnt, daß eben ein „in den absoluten Geheimniszustand Erhobener" uns
anblickt. Es ist die ägyptisch empfundene Überlegenheit des Todes, die uns in
griechischer Form „entgegenschweigt".
Diese Arbeit wird in den Anfang des 5. Jahrhunderts verlegt. Wie auf rein
griechischem Boden, nur wenig früher als diese Totenmaske, der Tod empfunden
wurde, davon zeugen zwei kleine Reliefs in dem archaischen Saal der Berliner
Sammlung. Auf dem einen scheint ein Knabe, mit einem Fell über den Schultern,
also ein Hirte, eine sich vor ihm emporrichtende Schlange zu füttern. Das andere
ist ein Bruchstück, dessen grössere andere Hälfte, eine stehende nackte Jünglings-
figur darstellend, sich in New York befindet. Es ist ein kleines Mädchenhaupt, die
Hand hält eine Blume, vielleicht riecht sie daran.
Hier schmeckt ein junges Leben plötzlich den Duft des Todes und dort voll-
zieht sich eine Art Zwiesprache mit der Unterwelt. In beiden Reliefs glaubt man
den Schauer zu spüren, der das sich selbstverständlich hinnehmende Naturkind in
dem Augenblick anweht, in dem seine Vergänglichkeit ihm wahrnehmbar wird.
Das Griechische daran scheint mir, daß der Ton ganz auf dem Leben und seiner
unmittelbaren Gegenwart liegt.
Die Griechen waren selber so sehr Gegenwart, daß ihnen der notwendige
Abstand fehlte, um ihren Begriff zu bilden. Die griechische Sprache enthält kein
Wort, welches diese gerade aus dem Gegensatz gegen die beständig verfließende
Zeit geborne Vorstellung, die unserem dynamischen Weltbild geläufig ist, ent-
sprechend wiedergäbe.
Das Gespräch mit dem Tode II
Von
Qerh. v. Mutius
„Erstaunt Euch nicht auf attischen Stelen die Vorsicht
Menschlicher Geste? War nicht Liebe und Abschied
So leicht auf die Schultern gelegt, als war' es aus anderem
Stoffe gemacht, als bei uns? Gedenkt Euch der Hände
Wie sie drucklos beruhen, obwohl in den Torsen die Kraft steht.
Diese Beherrschten wußten damals: soweit sind wir's!
Dies ist unser, uns so zu berühren; stärker
Stemmen die Götter uns an, doch dies ist Sache der Götter".
In diesen Strophen der zweiten Duineser Elegie hat Rilke in wunderbarer Weise
den Eindruck festgehalten, der von vielen griechischen Grabdenkmälern, deren unsere
Berliner Sammlung einige besonders schöne Exemplare enthält, auf den heutigen
Beschauer ausgeht. Natürlich steckt in dieser mit der Zeit zur Gewohnheit werdenden
und sich verbreiternden Gräberkunst auch etwas Handwerksmäßiges, das einer
individuellen Steigerung des Gefühls und des Ausdrucks aus dem Wege geht. Und
doch ist die vor dem Schicksal sich bescheidende Fassung das Leitmotiv aller dieser
Abschiedsszenen zwischen Mann und Frau, Vater und Sohn, Frau und Dienerin
und unter Kriegern. — Wir sind aus unserem christlichen Kulturerbe heraus zu
einer sehr viel pathetischeren Auffassung des Todes erzogen. Der unendliche, ein-
malige, so nicht wiederkehrende Wert der Menschenseele wird erst an ihrem Verlust
167
häupter, die Karyatiden, nur daß hier ein herber weitabgewandter Zug daran
gemahnt, daß eben ein „in den absoluten Geheimniszustand Erhobener" uns
anblickt. Es ist die ägyptisch empfundene Überlegenheit des Todes, die uns in
griechischer Form „entgegenschweigt".
Diese Arbeit wird in den Anfang des 5. Jahrhunderts verlegt. Wie auf rein
griechischem Boden, nur wenig früher als diese Totenmaske, der Tod empfunden
wurde, davon zeugen zwei kleine Reliefs in dem archaischen Saal der Berliner
Sammlung. Auf dem einen scheint ein Knabe, mit einem Fell über den Schultern,
also ein Hirte, eine sich vor ihm emporrichtende Schlange zu füttern. Das andere
ist ein Bruchstück, dessen grössere andere Hälfte, eine stehende nackte Jünglings-
figur darstellend, sich in New York befindet. Es ist ein kleines Mädchenhaupt, die
Hand hält eine Blume, vielleicht riecht sie daran.
Hier schmeckt ein junges Leben plötzlich den Duft des Todes und dort voll-
zieht sich eine Art Zwiesprache mit der Unterwelt. In beiden Reliefs glaubt man
den Schauer zu spüren, der das sich selbstverständlich hinnehmende Naturkind in
dem Augenblick anweht, in dem seine Vergänglichkeit ihm wahrnehmbar wird.
Das Griechische daran scheint mir, daß der Ton ganz auf dem Leben und seiner
unmittelbaren Gegenwart liegt.
Die Griechen waren selber so sehr Gegenwart, daß ihnen der notwendige
Abstand fehlte, um ihren Begriff zu bilden. Die griechische Sprache enthält kein
Wort, welches diese gerade aus dem Gegensatz gegen die beständig verfließende
Zeit geborne Vorstellung, die unserem dynamischen Weltbild geläufig ist, ent-
sprechend wiedergäbe.
Das Gespräch mit dem Tode II
Von
Qerh. v. Mutius
„Erstaunt Euch nicht auf attischen Stelen die Vorsicht
Menschlicher Geste? War nicht Liebe und Abschied
So leicht auf die Schultern gelegt, als war' es aus anderem
Stoffe gemacht, als bei uns? Gedenkt Euch der Hände
Wie sie drucklos beruhen, obwohl in den Torsen die Kraft steht.
Diese Beherrschten wußten damals: soweit sind wir's!
Dies ist unser, uns so zu berühren; stärker
Stemmen die Götter uns an, doch dies ist Sache der Götter".
In diesen Strophen der zweiten Duineser Elegie hat Rilke in wunderbarer Weise
den Eindruck festgehalten, der von vielen griechischen Grabdenkmälern, deren unsere
Berliner Sammlung einige besonders schöne Exemplare enthält, auf den heutigen
Beschauer ausgeht. Natürlich steckt in dieser mit der Zeit zur Gewohnheit werdenden
und sich verbreiternden Gräberkunst auch etwas Handwerksmäßiges, das einer
individuellen Steigerung des Gefühls und des Ausdrucks aus dem Wege geht. Und
doch ist die vor dem Schicksal sich bescheidende Fassung das Leitmotiv aller dieser
Abschiedsszenen zwischen Mann und Frau, Vater und Sohn, Frau und Dienerin
und unter Kriegern. — Wir sind aus unserem christlichen Kulturerbe heraus zu
einer sehr viel pathetischeren Auffassung des Todes erzogen. Der unendliche, ein-
malige, so nicht wiederkehrende Wert der Menschenseele wird erst an ihrem Verlust