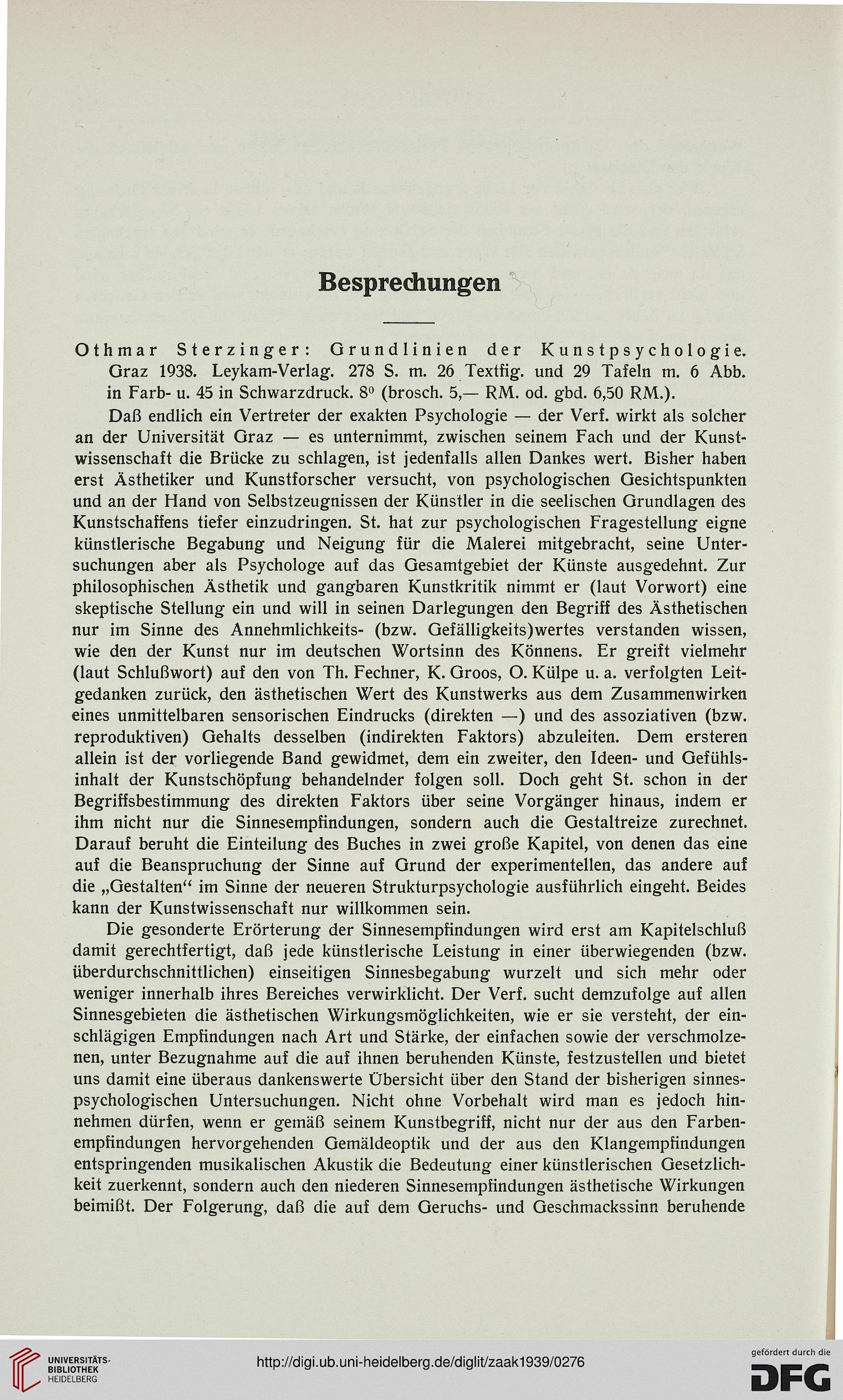Besprechungen
Othmar Sterzinger: Grundlinien der Kunstpsychologie.
Graz 1938. Leykam-Verlag. 278 S. m. 26 Textfig. und 29 Tafeln m. 6 Abb.
in Färb- u. 45 in Schwarzdruck. 8° (brosch. 5 — RM. od. gbd. 6,50 RM.).
Daß endlich ein Vertreter der exakten Psychologie — der Verf. wirkt als solcher
an der Universität Graz — es unternimmt, zwischen seinem Fach und der Kunst-
wissenschaft die Brücke zu schlagen, ist jedenfalls allen Dankes wert. Bisher haben
erst Ästhetiker und Kunstforscher versucht, von psychologischen Gesichtspunkten
und an der Hand von Selbstzeugnissen der Künstler in die seelischen Grundlagen des
Kunstschaffens tiefer einzudringen. St. hat zur psychologischen Fragestellung eigne
künstlerische Begabung und Neigung für die Malerei mitgebracht, seine Unter-
suchungen aber als Psychologe auf das Gesamtgebiet der Künste ausgedehnt. Zur
philosophischen Ästhetik und gangbaren Kunstkritik nimmt er (laut Vorwort) eine
skeptische Stellung ein und will in seinen Darlegungen den Begriff des Ästhetischen
nur im Sinne des Annehmlichkeits- (bzw. Gefälligkeits)wertes verstanden wissen,
wie den der Kunst nur im deutschen Wortsinn des Könnens. Er greift vielmehr
(laut Schlußwort) auf den von Th. Fechner, K. Groos, O. Külpe u. a. verfolgten Leit-
gedanken zurück, den ästhetischen Wert des Kunstwerks aus dem Zusammenwirken
eines unmittelbaren sensorischen Eindrucks (direkten —) und des assoziativen (bzw.
reproduktiven) Gehalts desselben (indirekten Faktors) abzuleiten. Dem ersteren
allein ist der vorliegende Band gewidmet, dem ein zweiter, den Ideen- und Gefühls-
inhalt der Kunstschöpfung behandelnder folgen soll. Doch geht St. schon in der
Begriffsbestimmung des direkten Faktors über seine Vorgänger hinaus, indem er
ihm nicht nur die Sinnesempfindungen, sondern auch die Gestaltreize zurechnet.
Darauf beruht die Einteilung des Buches in zwei große Kapitel, von denen das eine
auf die Beanspruchung der Sinne auf Grund der experimentellen, das andere auf
die „Gestalten" im Sinne der neueren Strukturpsychologie ausführlich eingeht. Beides
kann der Kunstwissenschaft nur willkommen sein.
Die gesonderte Erörterung der Sinnesempfindungen wird erst am Kapitelschluß
damit gerechtfertigt, daß jede künstlerische Leistung in einer überwiegenden (bzw.
überdurchschnittlichen) einseitigen Sinnesbegabung wurzelt und sich mehr oder
weniger innerhalb ihres Bereiches verwirklicht. Der Verf. sucht demzufolge auf allen
Sinnesgebieten die ästhetischen Wirkungsmöglichkeiten, wie er sie versteht, der ein-
schlägigen Empfindungen nach Art und Stärke, der einfachen sowie der verschmolze-
nen, unter Bezugnahme auf die auf ihnen beruhenden Künste, festzustellen und bietet
uns damit eine überaus dankenswerte Übersicht über den Stand der bisherigen sinnes-
psychologischen Untersuchungen. Nicht ohne Vorbehalt wird man es jedoch hin-
nehmen dürfen, wenn er gemäß seinem Kunstbegriff, nicht nur der aus den Farben-
empfindungen hervorgehenden Gemäldeoptik und der aus den Klangempfindungen
entspringenden musikalischen Akustik die Bedeutung einer künstlerischen Gesetzlich-
keit zuerkennt, sondern auch den niederen Sinnesempfindungen ästhetische Wirkungen
beimißt. Der Folgerung, daß die auf dem Geruchs- und Geschmackssinn beruhende
Othmar Sterzinger: Grundlinien der Kunstpsychologie.
Graz 1938. Leykam-Verlag. 278 S. m. 26 Textfig. und 29 Tafeln m. 6 Abb.
in Färb- u. 45 in Schwarzdruck. 8° (brosch. 5 — RM. od. gbd. 6,50 RM.).
Daß endlich ein Vertreter der exakten Psychologie — der Verf. wirkt als solcher
an der Universität Graz — es unternimmt, zwischen seinem Fach und der Kunst-
wissenschaft die Brücke zu schlagen, ist jedenfalls allen Dankes wert. Bisher haben
erst Ästhetiker und Kunstforscher versucht, von psychologischen Gesichtspunkten
und an der Hand von Selbstzeugnissen der Künstler in die seelischen Grundlagen des
Kunstschaffens tiefer einzudringen. St. hat zur psychologischen Fragestellung eigne
künstlerische Begabung und Neigung für die Malerei mitgebracht, seine Unter-
suchungen aber als Psychologe auf das Gesamtgebiet der Künste ausgedehnt. Zur
philosophischen Ästhetik und gangbaren Kunstkritik nimmt er (laut Vorwort) eine
skeptische Stellung ein und will in seinen Darlegungen den Begriff des Ästhetischen
nur im Sinne des Annehmlichkeits- (bzw. Gefälligkeits)wertes verstanden wissen,
wie den der Kunst nur im deutschen Wortsinn des Könnens. Er greift vielmehr
(laut Schlußwort) auf den von Th. Fechner, K. Groos, O. Külpe u. a. verfolgten Leit-
gedanken zurück, den ästhetischen Wert des Kunstwerks aus dem Zusammenwirken
eines unmittelbaren sensorischen Eindrucks (direkten —) und des assoziativen (bzw.
reproduktiven) Gehalts desselben (indirekten Faktors) abzuleiten. Dem ersteren
allein ist der vorliegende Band gewidmet, dem ein zweiter, den Ideen- und Gefühls-
inhalt der Kunstschöpfung behandelnder folgen soll. Doch geht St. schon in der
Begriffsbestimmung des direkten Faktors über seine Vorgänger hinaus, indem er
ihm nicht nur die Sinnesempfindungen, sondern auch die Gestaltreize zurechnet.
Darauf beruht die Einteilung des Buches in zwei große Kapitel, von denen das eine
auf die Beanspruchung der Sinne auf Grund der experimentellen, das andere auf
die „Gestalten" im Sinne der neueren Strukturpsychologie ausführlich eingeht. Beides
kann der Kunstwissenschaft nur willkommen sein.
Die gesonderte Erörterung der Sinnesempfindungen wird erst am Kapitelschluß
damit gerechtfertigt, daß jede künstlerische Leistung in einer überwiegenden (bzw.
überdurchschnittlichen) einseitigen Sinnesbegabung wurzelt und sich mehr oder
weniger innerhalb ihres Bereiches verwirklicht. Der Verf. sucht demzufolge auf allen
Sinnesgebieten die ästhetischen Wirkungsmöglichkeiten, wie er sie versteht, der ein-
schlägigen Empfindungen nach Art und Stärke, der einfachen sowie der verschmolze-
nen, unter Bezugnahme auf die auf ihnen beruhenden Künste, festzustellen und bietet
uns damit eine überaus dankenswerte Übersicht über den Stand der bisherigen sinnes-
psychologischen Untersuchungen. Nicht ohne Vorbehalt wird man es jedoch hin-
nehmen dürfen, wenn er gemäß seinem Kunstbegriff, nicht nur der aus den Farben-
empfindungen hervorgehenden Gemäldeoptik und der aus den Klangempfindungen
entspringenden musikalischen Akustik die Bedeutung einer künstlerischen Gesetzlich-
keit zuerkennt, sondern auch den niederen Sinnesempfindungen ästhetische Wirkungen
beimißt. Der Folgerung, daß die auf dem Geruchs- und Geschmackssinn beruhende