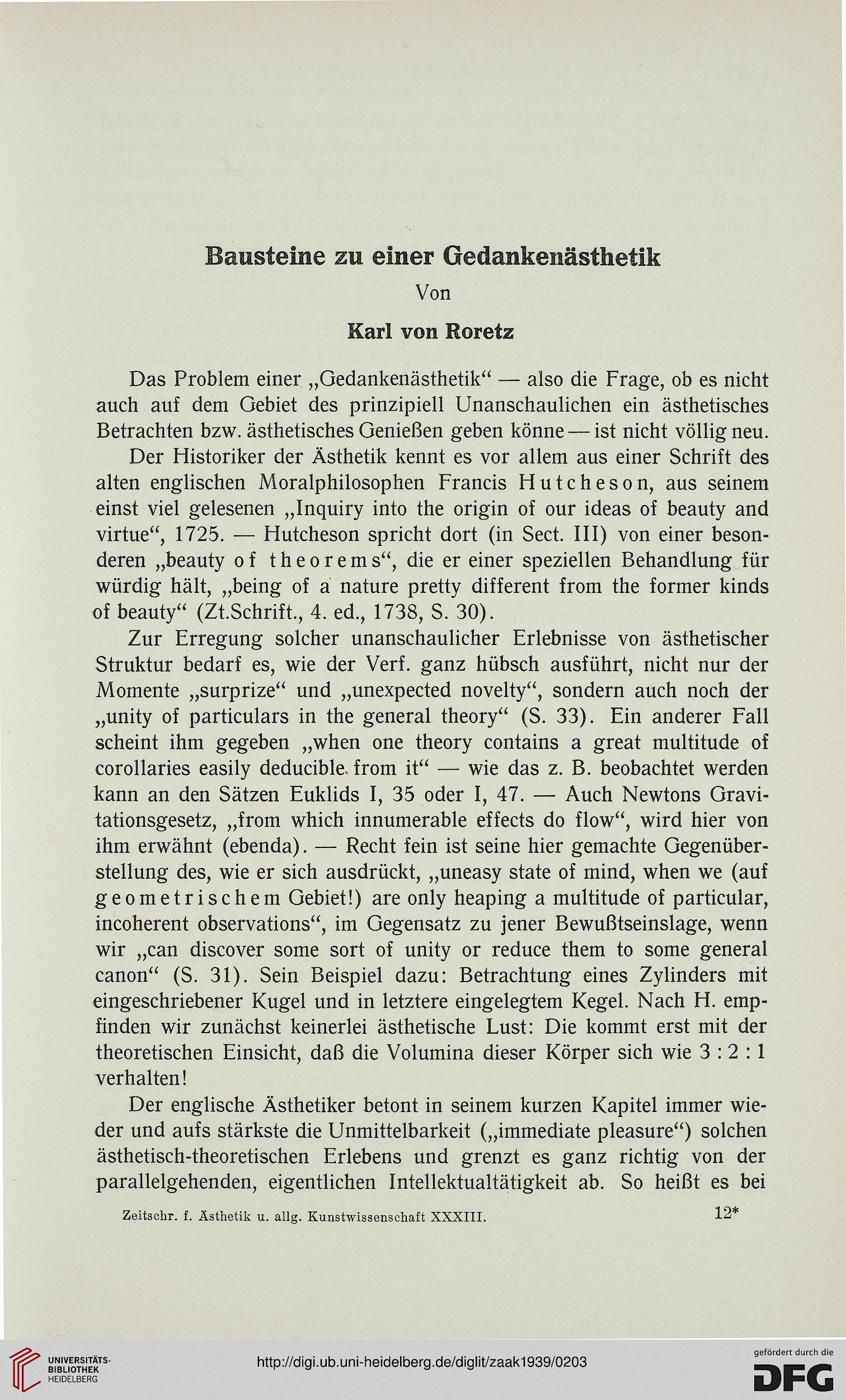Bausteine zu einer Gedankenästhetik
Von
Karl von Roretz
Das Problem einer „Gedankenästhetik" — also die Frage, ob es nicht
auch auf dem Gebiet des prinzipiell Unanschaulichen ein ästhetisches
Betrachten bzw. ästhetisches Genießen geben könne — ist nicht völlig neu.
Der Historiker der Ästhetik kennt es vor allem aus einer Schrift des
alten englischen Moralphilosophen Francis Hutcheson, aus seinem
einst viel gelesenen „Inquiry into the origin of our ideas of beauty and
virtue", 1725. — Hutcheson spricht dort (in Sect. III) von einer beson-
deren „beauty of theorems", die er einer speziellen Behandlung für
würdig hält, „being of a nature pretty different from the former kinds
of beauty" (Zt.Schrift., 4. ed., 1738, S. 30).
Zur Erregung solcher unanschaulicher Erlebnisse von ästhetischer
Struktur bedarf es, wie der Verf. ganz hübsch ausführt, nicht nur der
Momente „surprize" und „unexpected novelty", sondern auch noch der
„unity of particulars in the general theory" (S. 33). Ein anderer Fall
scheint ihm gegeben „when one theory contains a great multitude of
corollaries easily deducible. from it" — wie das z. B. beobachtet werden
kann an den Sätzen Euklids I, 35 oder I, 47. — Auch Newtons Gravi-
tationsgesetz, „from which innumerable effects do flow", wird hier von
ihm erwähnt (ebenda). — Recht fein ist seine hier gemachte Gegenüber-
stellung des, wie er sich ausdrückt, „uneasy state of mind, when we (auf
geometrischem Gebiet!) are only heaping a multitude of particular,
incoherent observations", im Gegensatz zu jener Bewußtseinslage, wenn
wir „can discover some sort of unity or reduce them to some general
canon" (S. 31). Sein Beispiel dazu: Betrachtung eines Zylinders mit
eingeschriebener Kugel und in letztere eingelegtem Kegel. Nach H. emp-
finden wir zunächst keinerlei ästhetische Lust: Die kommt erst mit der
theoretischen Einsicht, daß die Volumina dieser Körper sich wie 3:2:1
verhalten!
Der englische Ästhetiker betont in seinem kurzen Kapitel immer wie-
der und aufs stärkste die Unmittelbarkeit („immediate pleasure") solchen
ästhetisch-theoretischen Erlebens und grenzt es ganz richtig von der
parallelgehenden, eigentlichen Intellektualtätigkeit ab. So heißt es bei
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 12*
Von
Karl von Roretz
Das Problem einer „Gedankenästhetik" — also die Frage, ob es nicht
auch auf dem Gebiet des prinzipiell Unanschaulichen ein ästhetisches
Betrachten bzw. ästhetisches Genießen geben könne — ist nicht völlig neu.
Der Historiker der Ästhetik kennt es vor allem aus einer Schrift des
alten englischen Moralphilosophen Francis Hutcheson, aus seinem
einst viel gelesenen „Inquiry into the origin of our ideas of beauty and
virtue", 1725. — Hutcheson spricht dort (in Sect. III) von einer beson-
deren „beauty of theorems", die er einer speziellen Behandlung für
würdig hält, „being of a nature pretty different from the former kinds
of beauty" (Zt.Schrift., 4. ed., 1738, S. 30).
Zur Erregung solcher unanschaulicher Erlebnisse von ästhetischer
Struktur bedarf es, wie der Verf. ganz hübsch ausführt, nicht nur der
Momente „surprize" und „unexpected novelty", sondern auch noch der
„unity of particulars in the general theory" (S. 33). Ein anderer Fall
scheint ihm gegeben „when one theory contains a great multitude of
corollaries easily deducible. from it" — wie das z. B. beobachtet werden
kann an den Sätzen Euklids I, 35 oder I, 47. — Auch Newtons Gravi-
tationsgesetz, „from which innumerable effects do flow", wird hier von
ihm erwähnt (ebenda). — Recht fein ist seine hier gemachte Gegenüber-
stellung des, wie er sich ausdrückt, „uneasy state of mind, when we (auf
geometrischem Gebiet!) are only heaping a multitude of particular,
incoherent observations", im Gegensatz zu jener Bewußtseinslage, wenn
wir „can discover some sort of unity or reduce them to some general
canon" (S. 31). Sein Beispiel dazu: Betrachtung eines Zylinders mit
eingeschriebener Kugel und in letztere eingelegtem Kegel. Nach H. emp-
finden wir zunächst keinerlei ästhetische Lust: Die kommt erst mit der
theoretischen Einsicht, daß die Volumina dieser Körper sich wie 3:2:1
verhalten!
Der englische Ästhetiker betont in seinem kurzen Kapitel immer wie-
der und aufs stärkste die Unmittelbarkeit („immediate pleasure") solchen
ästhetisch-theoretischen Erlebens und grenzt es ganz richtig von der
parallelgehenden, eigentlichen Intellektualtätigkeit ab. So heißt es bei
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 12*